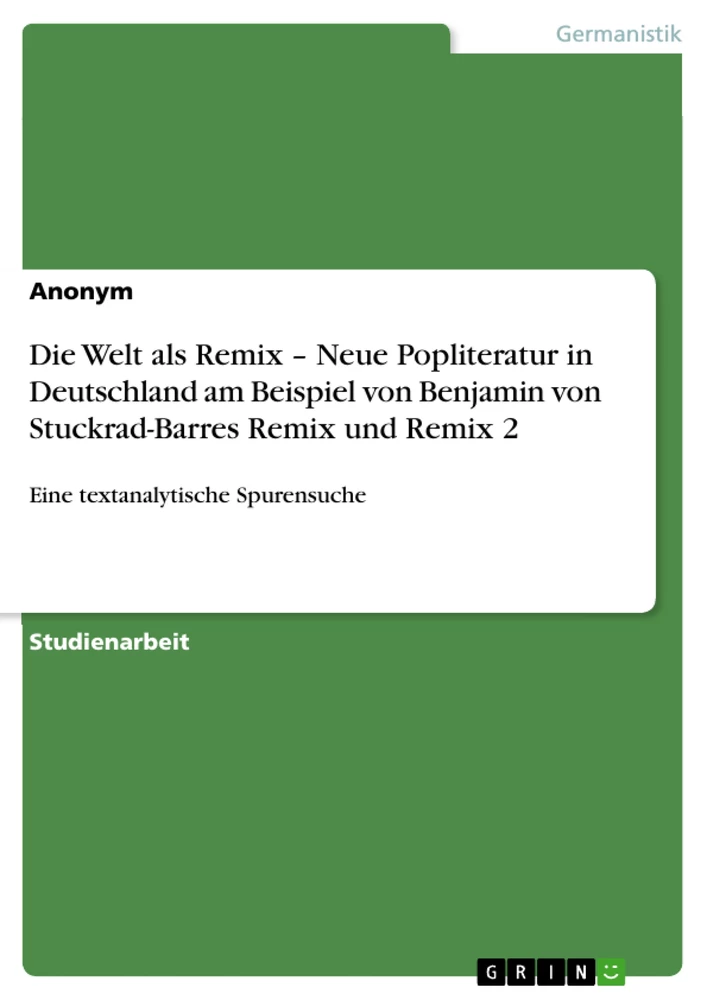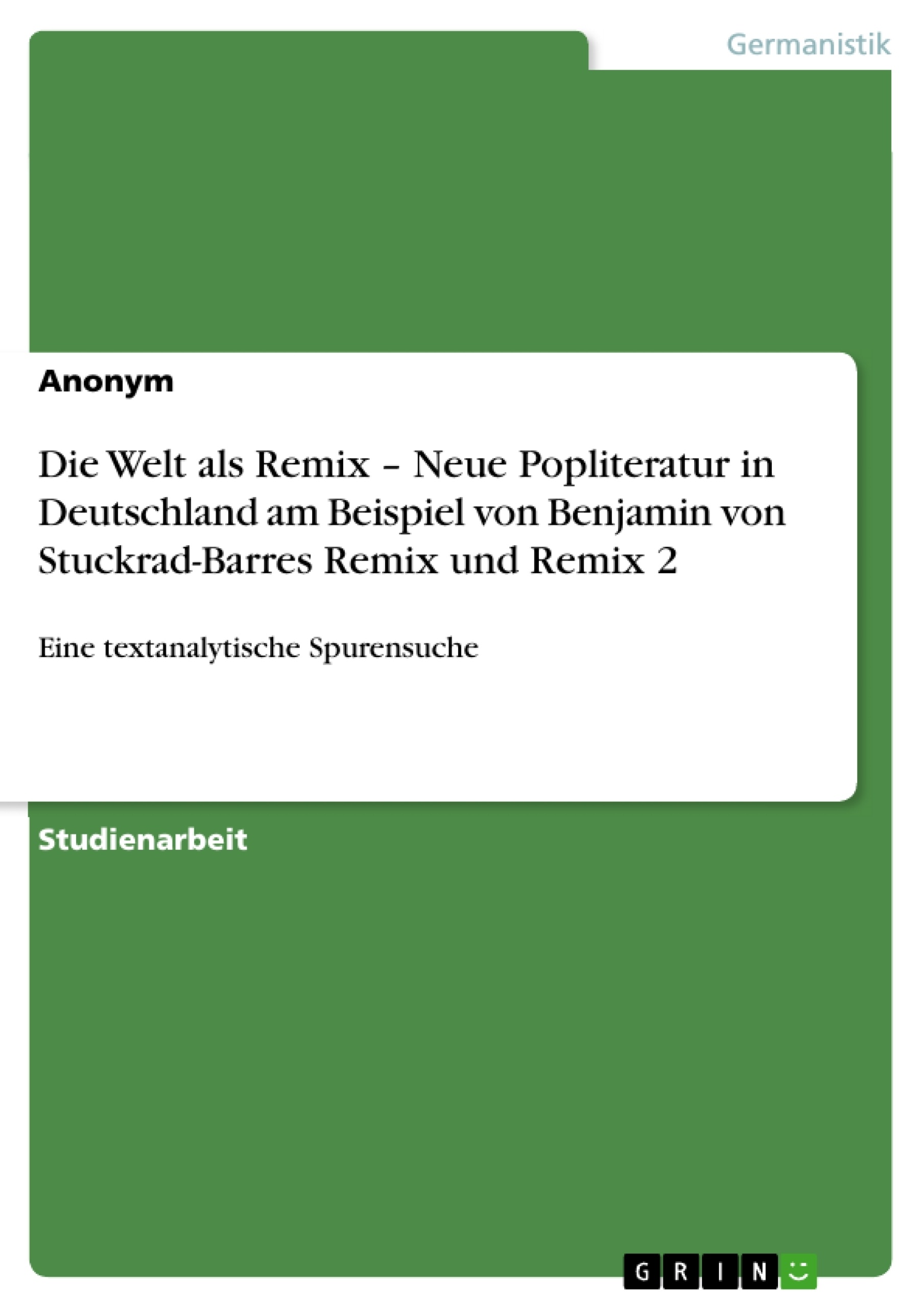Basierend auf dem literaturwissenschaftlichen Forschungsstand soll in einem ersten Schritt geklärt werden, welchen Hintergrund das Phänomen Popliteratur hat, wodurch diese literarische Strömung entstanden ist.
Der Begriff Popliteratur wird dabei anhand der wichtigsten Meinungen umrissen und hinsichtlich seiner stilistischen Kernpunkte präzisiert. Die Heterogenität soll dabei aufgelöst, die Programmatik (oder zumindest wesentliche Kennzeichen) entwickelt und aufgezeigt werden. Dabei verfolgt diese Arbeit einen holistischen Ansatz: das Phänomen Popliteratur soll als Ganzes erklärt und definiert werden, sofern dies aufgrund der relativen Unschärfe und der Heterogenität des Genres möglich ist. Es kann und soll nicht auf einzelne Besonderheiten eingegangen werden,
dafür ist die innere Heterogenität zu groß. Es wird sich dabei aber zeigen, dass nicht alles, was unter dem Begriff Popliteratur subsumiert ist, auch tatsächlich diese Bezeichnung zu Recht trägt.
Es soll insbesondere die Frage geklärt werden, welches die besonderen Kennzeichen sind, die einen zeitgenössischen Text von den unzähligen anderen Gegenwartsliteraturen abheben und ihn dem Genre Pop zuordnen lässt. Da der Verfasser dabei die jüngere Popliteratur im Blick hat – aufgrund des beschränkten Rahmens dieser Arbeit kann auf die früheren popliterarischen Ausformungen der 1960er und 1970er Jahre nur kurz eingegangen werden –, sollen die theoretischen Überlegungen und Ergebnisse in einem abschließenden Schritt praktisch zur Anwendung gelangen.
Es schließt sich eine knappe Textanalyse mit dem Ziel an, die theoretisch gewonnenen Erkenntnisse über Popliteratur zu konkretisieren und in der Textarbeit zu belegen. Untersuchungsgegenstand sind dabei die 1999 und 2004 erschienenen Textsammlungen „Remix“ und „Remix 2“ von Benjamin von Stuckrad-Barre. Diese beiden Bücher eignen sich sehr gut für eine textanalytische Spurensuche, da bereits die Titel andeuten, dass hier Kernelemente der Popliteratur (wie etwa die relative thematische Wichtigkeit von Musik) in äußerst dichter Form zu finden sind. Die Textsammlungen bestehen aus sehr heterogenen Textformen und eignen sich m.E. daher besonders gut, die typischen Merkmale eines popliterarischen Genres aufzuzeigen und die theoretischen Vorüberlegungen zu präzisieren, aber auch um einen neuen Aspekt zu beleuchten: das Verhältnis von literarischem und journalistischem Schreiben in der Popliteratur.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vom Dadaismus zur neuen deutschen Popliteratur – eine literaturhistorische Einordnung
- Dadaismus und Beat-Generation
- Pop-Art und Postmoderne: Leslie Fiedler
- Popliteratur in Deutschland: Neuer Realismus
- Die neue deutsche Popliteratur
- Popliteratur im Fokus der popular culture
- Schreiben am Rande der Oberfläche – Zur Programmatik und Charakteristik der neuen Popliteratur
- Die Oberfläche als Topos
- Stilistisch-ästhetische und formale Aspekte von Popliteratur
- Remix und Remix 2: typisch Pop? Eine textanalytische Spurensuche
- Zu Inhalt, Form und Stil
- Zur Frage der Oberfläche
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den umstrittenen Begriff „Popliteratur“ und versucht, dessen vage Definitionen zu präzisieren. Sie verfolgt einen holistischen Ansatz, um das Phänomen als Ganzes zu erfassen und die stilistischen Kernpunkte herauszuarbeiten. Die Arbeit analysiert die literaturhistorische Entwicklung von Popliteratur, beginnend bei ihren Ursprüngen bis hin zur neueren deutschen Popliteratur. Die Analyse von Benjamin von Stuckrad-Barres „Remix“ und „Remix 2“ dient als Fallbeispiel zur Veranschaulichung der theoretischen Erkenntnisse.
- Literaturhistorische Einordnung von Popliteratur
- Definition und Charakteristika der neuen deutschen Popliteratur
- Stilistische und formale Aspekte von Popliteratur
- Textanalyse von „Remix“ und „Remix 2“ von Benjamin von Stuckrad-Barre
- Das Verhältnis von literarischem und journalistischem Schreiben in der Popliteratur
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Unschärfe des Begriffs „Popliteratur“ und die Schwierigkeiten, ihn klar zu definieren. Sie hebt die Heterogenität des Genres und das Fehlen einer einheitlichen Programmatik hervor. Die Arbeit zielt darauf ab, diese Problematik zu untersuchen und den Versuch einer Grenzziehung zu wagen, indem sie die literaturhistorische Entwicklung beleuchtet und anhand einer Textanalyse an konkreten Beispielen veranschaulicht.
Vom Dadaismus zur neuen deutschen Popliteratur – eine literaturhistorische Einordnung: Dieses Kapitel verfolgt die literaturhistorische Entwicklung, die zur Entstehung der Popliteratur geführt hat. Es untersucht die Einflüsse von Dadaismus, Beat-Generation, Pop-Art und Postmoderne und setzt diese in Beziehung zur Entwicklung des Neuen Realismus und schließlich zur neuen deutschen Popliteratur. Der Fokus liegt auf der Klärung der historischen und ideologischen Wurzeln, um ein besseres Verständnis des Genres zu ermöglichen und die oft geäußerte Kritik an der heutigen Popliteratur zu kontextualisieren.
Schreiben am Rande der Oberfläche – Zur Programmatik und Charakteristik der neuen Popliteratur: Dieses Kapitel widmet sich der Programmatik und den stilistischen Merkmalen der neuen Popliteratur. Es analysiert die „Oberfläche“ als Topos und untersucht stilistisch-ästhetische und formale Aspekte. Der Abschnitt beleuchtet die spezifischen Merkmale, die einen zeitgenössischen Text als Popliteratur ausweisen und ihn von anderen Genres der Gegenwartsliteratur unterscheiden.
Remix und Remix 2: typisch Pop? Eine textanalytische Spurensuche: Dieses Kapitel analysiert die Textsammlungen „Remix“ und „Remix 2“ von Benjamin von Stuckrad-Barre als Fallbeispiel. Es untersucht Inhalt, Form und Stil der Texte und beleuchtet das Verhältnis von literarischem und journalistischem Schreiben. Die Analyse konzentriert sich auf charakteristische Aspekte, die die theoretischen Ausführungen der vorherigen Kapitel veranschaulichen und einen neuen Aspekt, nämlich die Heterogenität der Textsorten innerhalb der Sammlung, beleuchten.
Schlüsselwörter
Popliteratur, neue deutsche Popliteratur, Benjamin von Stuckrad-Barre, Remix, Remix 2, Literaturgeschichte, Stilistik, Textanalyse, Oberfläche, Popkultur, Popularität, Medien, Konsum, Heterogenität, Programmatik.
Häufig gestellte Fragen zu "Vom Dadaismus zur neuen deutschen Popliteratur"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht den vielschichtigen und umstrittenen Begriff "Popliteratur", versucht dessen vage Definitionen zu präzisieren und analysiert die literaturhistorische Entwicklung vom Dadaismus bis zur neuen deutschen Popliteratur. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der stilistischen und formalen Charakterisierung sowie der Analyse von Benjamin von Stuckrad-Barres "Remix" und "Remix 2" als Fallbeispiele.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: die literaturhistorische Einordnung von Popliteratur (Dadaismus, Beat-Generation, Pop-Art, Postmoderne, Neuer Realismus); die Definition und Charakteristika der neuen deutschen Popliteratur; stilistische und formale Aspekte von Popliteratur; Textanalyse von "Remix" und "Remix 2"; und das Verhältnis von literarischem und journalistischem Schreiben in der Popliteratur. Der Topos der "Oberfläche" spielt dabei eine zentrale Rolle.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verfolgt einen holistischen Ansatz, um das Phänomen "Popliteratur" ganzheitlich zu erfassen. Sie kombiniert literaturhistorische Betrachtung mit stilistischer und textanalytischer Untersuchung. Die Analyse von "Remix" und "Remix 2" dient als empirische Grundlage zur Veranschaulichung der theoretischen Erkenntnisse.
Welche Autoren und Werke werden analysiert?
Der Fokus liegt auf der neuen deutschen Popliteratur, wobei Benjamin von Stuckrad-Barre mit seinen Werken "Remix" und "Remix 2" als zentrales Fallbeispiel dient. Die Arbeit beleuchtet aber auch die historischen Vorläufer und Einflüsse, wie Dadaismus, Beat-Generation, Pop-Art und den Neuen Realismus.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit liefert eine präzisere Definition von "Popliteratur", zeichnet deren literaturhistorische Entwicklung nach und analysiert die spezifischen stilistischen und formalen Merkmale der neuen deutschen Popliteratur. Die Textanalyse von "Remix" und "Remix 2" veranschaulicht die theoretischen Erkenntnisse und beleuchtet die Heterogenität der Textsorten innerhalb der Sammlung. Die Arbeit trägt dazu bei, die oft geäußerte Kritik an der heutigen Popliteratur zu kontextualisieren.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Popliteratur, neue deutsche Popliteratur, Benjamin von Stuckrad-Barre, Remix, Remix 2, Literaturgeschichte, Stilistik, Textanalyse, Oberfläche, Popkultur, Popularität, Medien, Konsum, Heterogenität, Programmatik.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit richtet sich an Leserinnen und Leser, die sich für Literaturwissenschaft, insbesondere für Gegenwartsliteratur und Popliteratur interessieren. Sie ist besonders relevant für Studierende der Germanistik und vergleichbarer Fächer.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2007, Die Welt als Remix – Neue Popliteratur in Deutschland am Beispiel von Benjamin von Stuckrad-Barres Remix und Remix 2, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83215