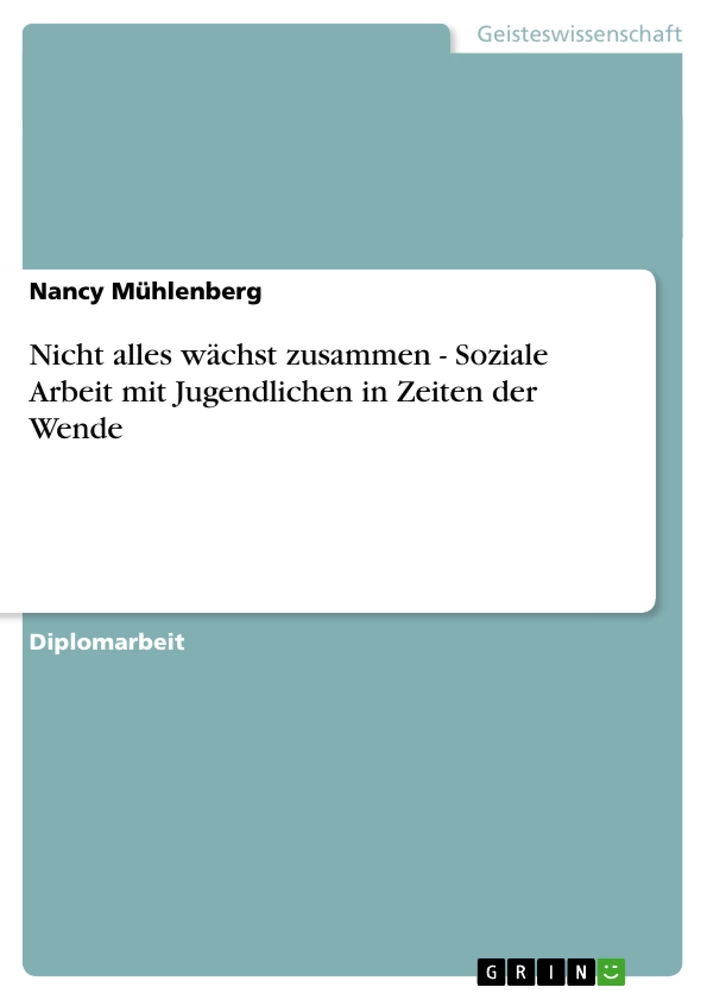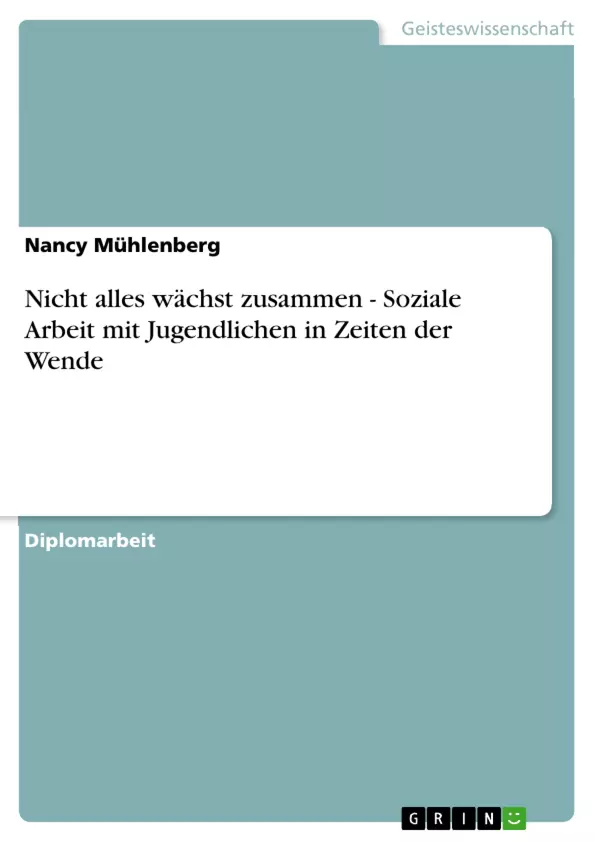Motivation dieser Diplomarbeit ist meine eigene Vergangenheit. Ich wurde in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR) geboren und bin dort aufgewachsen. Die Wende und die Wiedervereinigung habe ich somit auch miterlebt.
Diese Diplomarbeit sehe ich zum einen als eine Möglichkeit, mich mit dem System auseinanderzusetzen und damit bekannt zu machen, und zum anderen als eine Chance zur Aufarbeitung.
Grund für das Interesse ist für mich vor allem, daß ich verstehen will.
Ich will verstehen, warum das alles damals passiert ist und warum auf einmal alles schlecht war, obwohl es mir persönlich und meiner Familie gar nicht so schlecht ging.
Was war falsch am System und warum funktionierte es nicht? Und vor allem, war wirklich alles so schlecht?
Mir als Kind ging es doch gut. Wir hatten immer was zu essen und trinken. In der Freizeit wurde es nie langweilig, es war immer irgendwo etwas los und man konnte auch einfach nur mal so ins Pionierhaus gehen.
Auch für meinen späteren Beruf sah ich einer rosigen Zukunft entgegen. Schon damals wußte ich ganz genau, daß ich auf jeden Fall mal arbeiten gehe, Kinder haben werde und verheiratet bin.
Sind doch auf jeden Fall eine schöne Gegenwart und eine sichere Zukunft gewesen, oder waren sie etwa zu schön und zu sicher?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Jugend in der DDR
- Gesellschaftliche Grundlagen
- Gesetzliche Grundlagen
- Der Aufbau des Bildungssystems
- Der Aufbau des Sozialsystems
- Soziale Arbeit mit Jugendlichen in der DDR
- Aufbau der Sozialen Arbeit mit Jugendlichen in der DDR
- Die Kirche als Träger der Sozialen Arbeit mit Jugendlichen
- Aspekte der Sozialen Arbeit mit Jugendlichen
- Die Jugend in der „alten“ BRD
- Gesellschaftliche Grundlagen
- Gesetzliche Grundlagen
- Der Aufbau des Bildungssystems
- Der Aufbau des Sozialsystems
- Soziale Arbeit mit Jugendlichen in der alten BRD
- Aufbau, Träger und Aspekte der Sozialen Arbeit mit Jugendlichen in der alten BRD
- Die Soziale Arbeit mit Jugendlichen im vereinigten Deutschland
- Veränderungen in der Sozialen Arbeit mit Jugendlichen nach der Einführung des KJHG
- Vorteile und Nachteile für die Jugendarbeit aus Sicht der DDR
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Soziale Arbeit mit Jugendlichen in der DDR und im Vergleich dazu in der alten BRD, um die Veränderungen nach der Wiedervereinigung zu beleuchten. Die Arbeit basiert auf den persönlichen Erfahrungen der Autorin, die in der DDR aufgewachsen ist. Das Ziel ist es, das System der Sozialen Arbeit in der DDR zu verstehen und zu analysieren, um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten mit dem westdeutschen System aufzuzeigen.
- Jugend in der DDR: Gesellschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen
- Soziales System der DDR: Bildung und Sozialpolitik
- Soziale Arbeit mit Jugendlichen in der DDR: Aufbau, Träger und Methoden
- Vergleich der Sozialen Arbeit in Ost und West
- Veränderungen nach der Wiedervereinigung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit wird durch die persönlichen Erfahrungen der Autorin in der DDR motiviert und zielt darauf ab, das damalige System und die Veränderungen nach der Wende zu verstehen. Die Autorin hinterfragt kritisch die gängige Darstellung des Systems und sucht nach einem tieferen Verständnis der damaligen Lebenswirklichkeit.
Die Jugend in der DDR: Dieses Kapitel untersucht die gesellschaftlichen und gesetzlichen Grundlagen der Jugend in der DDR. Es beleuchtet die Rolle des Staates, der Familie und der Freien Deutschen Jugend (FDJ) im Leben junger Menschen. Der Aufbau des Bildungssystems mit seinen drei Erziehungs- und Bildungssäulen sowie das Sozialsystem mit Bereichen wie Gesundheitswesen, Rentensystem und Familienpolitik werden analysiert und in ihren Zusammenhängen dargestellt. Das Kapitel legt den Fokus auf die Verflechtung verschiedener staatlicher Institutionen und deren Einfluss auf die Lebensgestaltung Jugendlicher.
Soziale Arbeit mit Jugendlichen in der DDR: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Soziale Arbeit mit Jugendlichen in der DDR, einschließlich des Aufbaus, der Träger (insbesondere die Kirche) und der verschiedenen Aspekte der Jugendarbeit. Es wird untersucht, wie die Soziale Arbeit in das bestehende politische und gesellschaftliche System integriert war und welche Rolle die FDJ spielte. Besonderes Augenmerk liegt auf den spezifischen Formen der Jugendarbeit und deren Unterschiede zu heutigen Konzepten.
Die Jugend in der „alten“ BRD: Dieses Kapitel bietet einen vergleichenden Überblick über die gesellschaftlichen und gesetzlichen Grundlagen der Jugend in der alten Bundesrepublik. Es beschreibt den Aufbau des Bildungssystems und des Sozialsystems der BRD, um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten mit dem System der DDR aufzuzeigen und einen fundierten Vergleich für die spätere Analyse der Sozialen Arbeit zu schaffen.
Soziale Arbeit mit Jugendlichen in der alten BRD: Das Kapitel beleuchtet den Aufbau, die Träger und die verschiedenen Aspekte der Sozialen Arbeit mit Jugendlichen in der alten BRD. Es dient als Vergleichsbasis zum ostdeutschen System und bereitet den Weg für die Analyse der Veränderungen nach der Wiedervereinigung. Der Schwerpunkt liegt auf den strukturellen Unterschieden und Gemeinsamkeiten beider Systeme.
Die Soziale Arbeit mit Jugendlichen im vereinigten Deutschland: Dieses Kapitel analysiert die Veränderungen in der Sozialen Arbeit mit Jugendlichen nach der Einführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG). Es untersucht die Vorteile und Nachteile dieser Veränderungen aus der Perspektive der DDR und beleuchtet die Herausforderungen des Integrationsprozesses im Bereich der Jugendhilfe.
Schlüsselwörter
Soziale Arbeit, Jugendliche, DDR, BRD, Wiedervereinigung, Jugendhilfe, Bildungssystem, Sozialsystem, FDJ, Kirche, KJHG, gesellschaftliche Grundlagen, gesetzliche Grundlagen, Vergleich, Veränderungen.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Soziale Arbeit mit Jugendlichen in der DDR und der BRD
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Soziale Arbeit mit Jugendlichen in der DDR im Vergleich zur alten BRD und analysiert die Veränderungen nach der Wiedervereinigung. Sie basiert auf den persönlichen Erfahrungen der Autorin, die in der DDR aufgewachsen ist.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Die Jugend in der DDR, Soziale Arbeit mit Jugendlichen in der DDR, Die Jugend in der „alten“ BRD, Soziale Arbeit mit Jugendlichen in der alten BRD, Die Soziale Arbeit mit Jugendlichen im vereinigten Deutschland und Fazit. Jedes Kapitel beleuchtet die jeweiligen gesellschaftlichen, gesetzlichen und systemischen Rahmenbedingungen sowie die konkrete Ausgestaltung der Sozialen Arbeit.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die gesellschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen der Jugend in Ost und West, die jeweiligen Sozialsysteme (inkl. Bildung und Sozialpolitik), den Aufbau, die Träger und Methoden der Sozialen Arbeit in beiden Systemen, den Vergleich der Systeme und die Veränderungen nach der Wiedervereinigung, insbesondere durch die Einführung des KJHG.
Wie wird der Vergleich zwischen DDR und BRD durchgeführt?
Der Vergleich erfolgt auf verschiedenen Ebenen: Gesellschaftliche und gesetzliche Grundlagen werden gegenübergestellt, die Strukturen des Bildungssystems und des Sozialsystems werden analysiert und die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Organisation und Durchführung der Sozialen Arbeit werden herausgearbeitet. Der Fokus liegt auf der Identifizierung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden, um ein umfassendes Verständnis der jeweiligen Systeme zu ermöglichen.
Welche Rolle spielt die persönliche Erfahrung der Autorin?
Die persönlichen Erfahrungen der Autorin, die in der DDR aufgewachsen ist, bilden die Grundlage und Motivation für die Arbeit. Sie ermöglichen eine differenzierte Perspektive und tragen zu einem tieferen Verständnis der damaligen Lebenswirklichkeit bei.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Beschreibung der verwendeten Quellen ist in der vorliegenden Inhaltsangabe nicht enthalten. Nähere Informationen dazu finden sich in der vollständigen Diplomarbeit.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen der Arbeit werden im Kapitel "Fazit" zusammengefasst. Die Inhaltsangabe enthält keine detaillierten Angaben zu den Schlussfolgerungen, diese sind nur in der vollständigen Diplomarbeit nachzulesen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Soziale Arbeit, Jugendliche, DDR, BRD, Wiedervereinigung, Jugendhilfe, Bildungssystem, Sozialsystem, FDJ, Kirche, KJHG, gesellschaftliche Grundlagen, gesetzliche Grundlagen, Vergleich, Veränderungen.
Wie ist der Aufbau des Inhaltsverzeichnisses?
Das Inhaltsverzeichnis ist hierarchisch aufgebaut und gliedert die Arbeit in Kapitel und Unterkapitel. Es umfasst Kapitel zu den gesellschaftlichen und rechtlichen Grundlagen in der DDR und BRD, zu den Systemen der Sozialen Arbeit in beiden Staaten und zu den Veränderungen nach der Wiedervereinigung. Die genaue Struktur ist im bereitgestellten Inhaltsverzeichnis ersichtlich.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Die Arbeit richtet sich an Personen, die sich für die Geschichte der Sozialen Arbeit in Deutschland, insbesondere im Kontext der DDR und der Wiedervereinigung interessieren. Sie ist für Wissenschaftler, Studenten und alle, die sich mit den Veränderungen im Bereich der Jugendhilfe auseinandersetzen möchten, relevant.
- Citation du texte
- Nancy Mühlenberg (Auteur), 2002, Nicht alles wächst zusammen - Soziale Arbeit mit Jugendlichen in Zeiten der Wende, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/8345