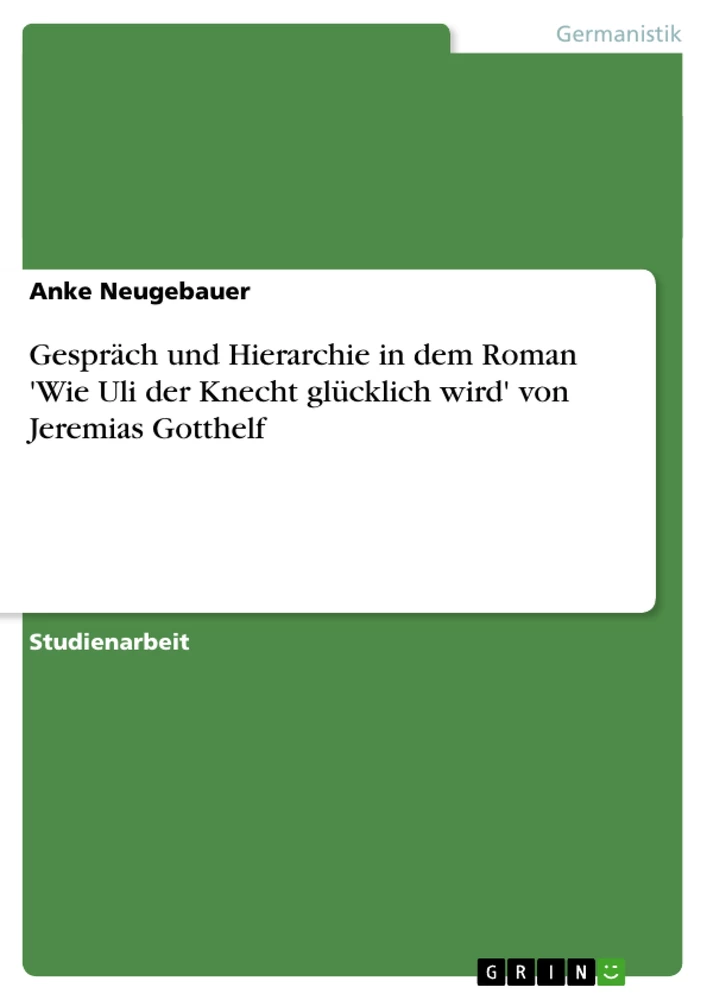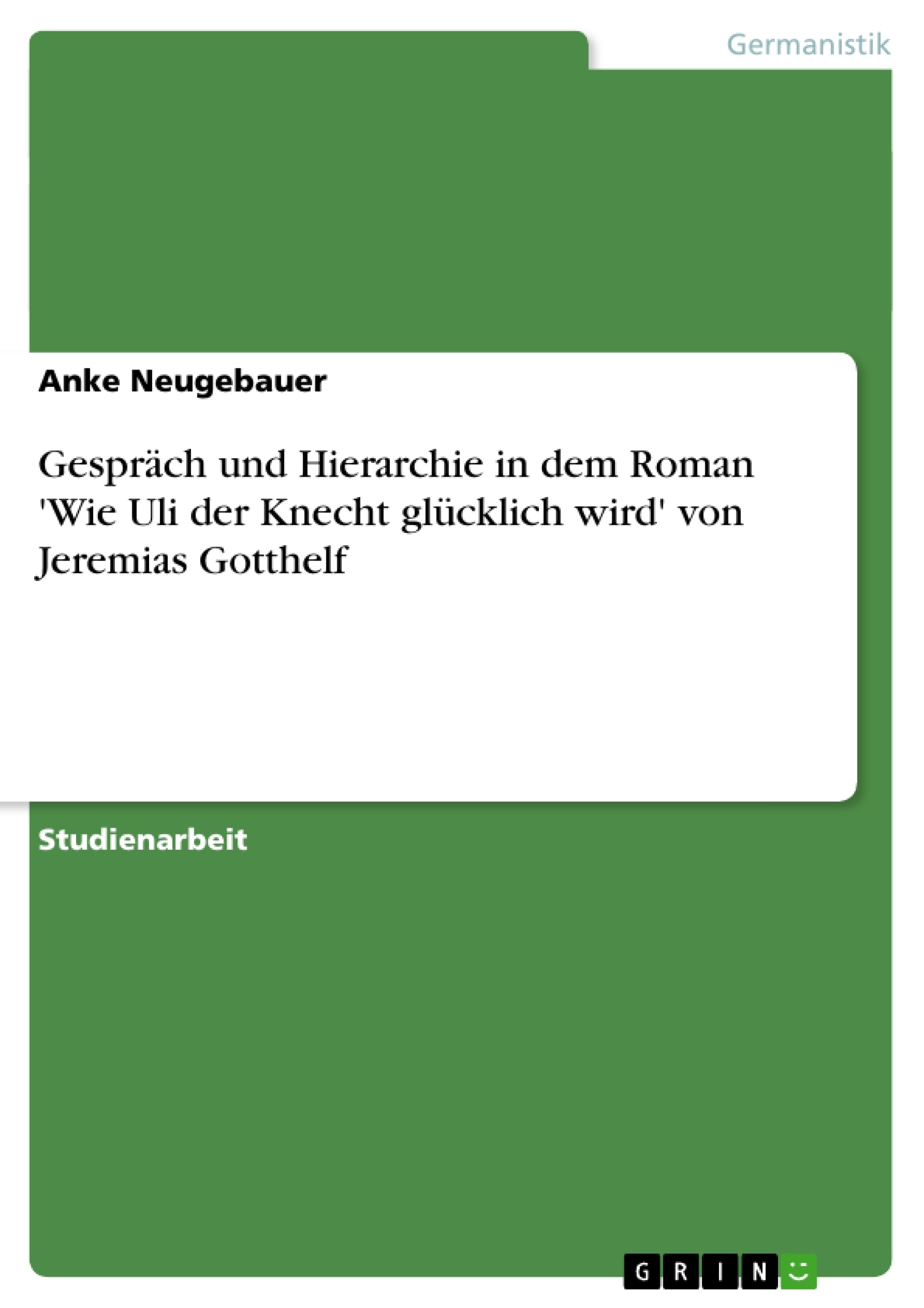Innerhalb des Romans nehmen Gespräche einen auffallend großen Raum ein und bestimmen den Handlungsverlauf, indem sie Handlung initiieren oder verhindern. Im Folgenden soll daher untersucht werden, welche Funktion sie im Zusammenhang mit den dargestellten hierarchischen Verhältnissen einnehmen. Von besonderem Interesse werden dabei die Gespräche und das Gesprächsverhalten zwischen den Figuren sein, die unterschiedlichen Positionen innerhalb der erwähnten besitzständischen Ordnung angehören und deren Wirkung auf die Entwicklung des Protagonisten Uli. Aus diesem Grund stehen die Gespräche Ulis mit dem Bodenbauern Johannes, dem Glunggebauern Joggeli und seiner Frau und den Pfarrerfiguren im Vordergrund. Erst in zweiter Linie werden wichtige Gespräche mit anderen Nebenfiguren eine Rolle spielen. Diese Auswahl dient gleichzeitig dazu, das umfangreiche Thema einzugrenzen. Da die Verwendung der dialektalen und der hochdeutschen Sprache ein wichtiges Merkmal der Dichtung Gotthelfs ist, fließt deren Bedeutung im Zusammenhang mit der Gestaltung der Gespräche und Figuren in die Untersuchung ein. Um die Gespräche im Hinblick auf die Fragestellung zu analysieren, werden zum Teil die Methoden und Kategorien der germanistischen Gesprächsforschung und der historischen Dialogforschung zu Hilfe genommen. Beide sprachwissenschaftlichen Disziplinen gehen davon aus, dass der Begriff des Gesprächs sich in erster Linie auf den Dialog in gesprochener Sprache bezieht und dialogische Sprachhandlungen meint, zwischen mindestens zwei Personen, die der menschlichen Verständigung dienen. Die literarisch-fiktionalen Gespräche, welche hier zum Untersuchungsgegenstand werden, stellen eine besondere Form der Gesprächsgattungen dar. Sie grenzen sich von den natürlichen Gesprächen dadurch ab, dass sie künstlerische, stilisierte Entwürfe sind, die keine reale Gesprächssituation abbilden, aber auf dem Wirklichen basieren. So lassen sich aufgrund von fiktionalen Gesprächen Rückschlüsse auf zeitgenössische Gesprächswirklichkeiten in den verschiedenen Kommunikations- und Praxisbereichen ziehen
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Aufbau und Stil im Uli-Roman
- Die bäuerliche Welt
- Die Gespräche zwischen Herr und Knecht
- Das erste Gespräch als Strafpredigt
- Das Gespräch als Annäherung der Stände – Eine Kinderlehre während der Nacht
- Der Meister als Lebensratgeber
- Der Kampf um Ordnung – Die Gespräche zwischen Meisterknecht und Glunggebauern
- Die Helferfiguren
- Der Baumwollhändler als Verkörperung des Zeitgeistes
- Die Reden der Pfarrerfiguren
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Funktion von Gesprächen im Roman "Wie Uli der Knecht glücklich wird" von Jeremias Gotthelf im Kontext der dargestellten hierarchischen Verhältnisse. Der Fokus liegt auf Gesprächen zwischen Figuren unterschiedlicher sozialer Stellung und deren Einfluss auf Ulis Entwicklung. Die Analyse berücksichtigt auch die Verwendung von Dialekt und Hochdeutsch.
- Die Rolle von Gesprächen in der Gestaltung der Handlung
- Die Darstellung hierarchischer Strukturen und sozialer Beziehungen
- Der Einfluss von Sprache (Dialekt vs. Hochdeutsch) auf die Charakterisierung der Figuren
- Die religiösen und moralischen Aspekte im Roman
- Die Kritik an den gesellschaftlichen Veränderungen im 19. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und beschreibt die Zielsetzung, die auf die Analyse der Funktion von Gesprächen im Roman "Wie Uli der Knecht glücklich wird" im Hinblick auf die dargestellten hierarchischen Verhältnisse abzielt. Besonderes Augenmerk wird auf die Gespräche zwischen Figuren unterschiedlicher sozialer Positionen und deren Wirkung auf Ulis Entwicklung gelegt. Die methodische Vorgehensweise wird ebenfalls skizziert, wobei die Berücksichtigung der sprachwissenschaftlichen Erkenntnisse der Gesprächsforschung hervorgehoben wird.
Der Aufbau und Stil im Uli-Roman: Dieses Kapitel analysiert den Aufbau und Stil des Romans "Wie Uli der Knecht glücklich wird". Es beleuchtet die didaktische Intention des Autors, die sich an einer bäuerlichen Leserschaft orientierte. Die Beziehung zwischen Uli und seinem Meister Johannes wird als zentrales Element des ersten Teils des Romans herausgestellt, während der zweite Teil Ulis Treue und Stärke in einem neuen Kontext prüft. Die Kapitel beschreibt den geographischen Rahmen der Handlung und den Realismus der Darstellung, insbesondere die Verwendung des Berner Dialekts zur Charakterisierung der Figuren und zur Herstellung von Nähe zum Leser.
Die bäuerliche Welt: Dieses Kapitel untersucht die Darstellung der bäuerlichen Welt im Roman. Gotthelfs christlich geprägtes Weltbild und seine Idealisierung der bäuerlichen Gemeinschaft als Ort des wahren christlichen Lebens werden diskutiert. Die strenge, patriarchalische Hierarchie innerhalb der bäuerlichen Familie, die den Bauern als Oberhaupt hat, wird analysiert. Ein Zitat aus dem Roman verdeutlicht den erzieherischen Auftrag der Meisterleute gegenüber ihren Untergebenen und die religiöse Begründung der hierarchischen Ordnung. Gotthelfs Kritik am Zeitgeist der Individualisierung und Säkularisierung und seine Verteidigung der traditionellen Dienstverhältnisse werden erläutert.
Schlüsselwörter
Jeremias Gotthelf, Wie Uli der Knecht glücklich wird, Gespräch, Hierarchie, bäuerliche Gesellschaft, Dialekt, Hochdeutsch, christliches Weltbild, soziale Beziehungen, 19. Jahrhundert, Erziehungsroman, Meister-Knecht-Beziehung.
Häufig gestellte Fragen zu "Wie Uli der Knecht glücklich wird"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Funktion von Gesprächen im Roman "Wie Uli der Knecht glücklich wird" von Jeremias Gotthelf. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der hierarchischen Verhältnisse und dem Einfluss von Gesprächen zwischen Figuren unterschiedlicher sozialer Stellung auf Ulis Entwicklung. Die Analyse berücksichtigt dabei auch die sprachliche Gestaltung, insbesondere den Gebrauch von Dialekt und Hochdeutsch.
Welche Themen werden im Roman behandelt und wie werden sie in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Themen, darunter die Rolle von Gesprächen in der Handlungsgestaltung, die Darstellung hierarchischer Strukturen und sozialer Beziehungen, den Einfluss von Sprache (Dialekt vs. Hochdeutsch) auf die Figurencharakterisierung, die religiösen und moralischen Aspekte, sowie die Kritik an gesellschaftlichen Veränderungen im 19. Jahrhundert. Die Analyse erfolgt durch eine detaillierte Untersuchung der Gespräche zwischen den Figuren.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Eine Einleitung, die die Zielsetzung und den methodischen Ansatz beschreibt; ein Kapitel zum Aufbau und Stil des Romans, mit Fokus auf die didaktische Intention und die Darstellung der bäuerlichen Welt; ein Kapitel zu den Gesprächen zwischen Herr und Knecht, einschliesslich der Analyse der Gesprächsfunktion; ein Kapitel zu den Gesprächen zwischen Meisterknecht und Glunggebauern; ein Kapitel zu den Reden der Pfarrerfiguren; und schließlich ein Schlusskapitel. Jedes Kapitel analysiert spezifische Aspekte der Gespräche und deren Bedeutung im Kontext des Romans.
Wie wird die bäuerliche Welt im Roman dargestellt?
Das Kapitel zur bäuerlichen Welt untersucht Gotthelfs christlich geprägtes Weltbild und seine Idealisierung der bäuerlichen Gemeinschaft. Es analysiert die strenge, patriarchalische Hierarchie innerhalb der bäuerlichen Familie und den erzieherischen Auftrag der Meisterleute gegenüber ihren Untergebenen. Gotthelfs Kritik am Zeitgeist der Individualisierung und Säkularisierung und seine Verteidigung traditioneller Dienstverhältnisse werden ebenfalls diskutiert.
Welche Rolle spielt die Sprache (Dialekt und Hochdeutsch) in der Analyse?
Die Arbeit berücksichtigt den Einfluss von Sprache (Dialekt vs. Hochdeutsch) auf die Charakterisierung der Figuren und die Darstellung sozialer Beziehungen. Die Verwendung des Berner Dialekts zur Herstellung von Nähe zum Leser und zur Charakterisierung der Figuren wird analysiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter zur Beschreibung des Inhalts sind: Jeremias Gotthelf, Wie Uli der Knecht glücklich wird, Gespräch, Hierarchie, bäuerliche Gesellschaft, Dialekt, Hochdeutsch, christliches Weltbild, soziale Beziehungen, 19. Jahrhundert, Erziehungsroman, Meister-Knecht-Beziehung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Funktion von Gesprächen im Roman "Wie Uli der Knecht glücklich wird" im Kontext der dargestellten hierarchischen Verhältnisse zu untersuchen. Der Fokus liegt auf den Gesprächen zwischen Figuren unterschiedlicher sozialer Stellung und deren Einfluss auf Ulis Entwicklung.
- Citation du texte
- Anke Neugebauer (Auteur), 2007, Gespräch und Hierarchie in dem Roman 'Wie Uli der Knecht glücklich wird' von Jeremias Gotthelf, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83636