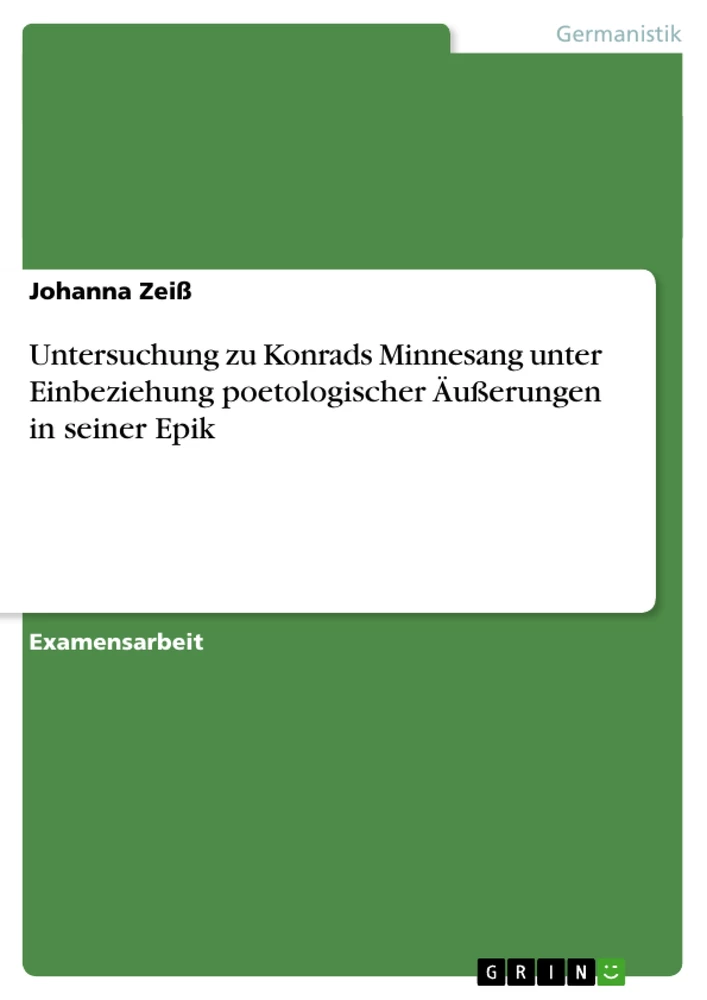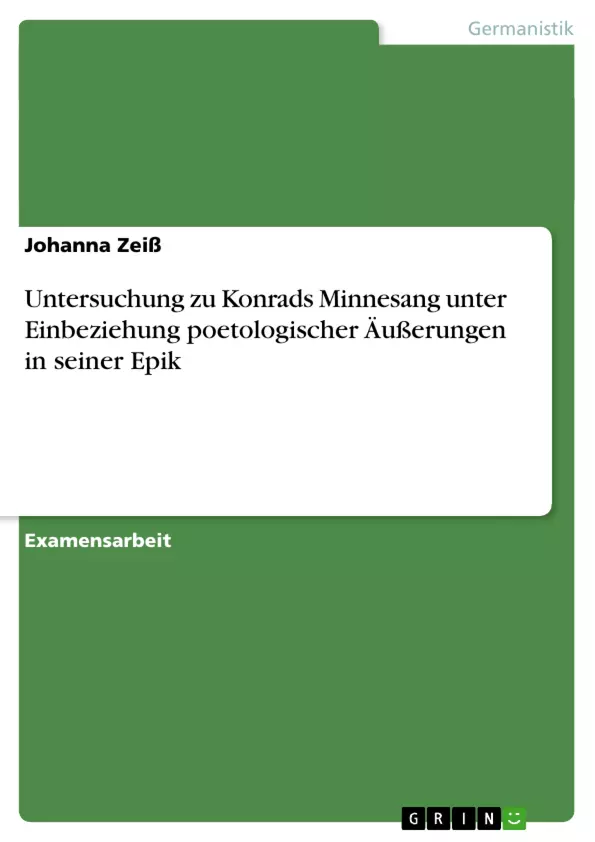Ziel dieser Arbeit soll es sein, anhand von Überlegungen zur Poetologie Konrads, die den Prologen zu ‘Partonopier und Meliur’ und zum ‘Trojanerkrieg’ entnommen werden, einen Teil seines lyrischen Werks, genauer gesagt die Lieder 13, 26 und 30, als Produktionen kenntlich zu machen, die mit einem gewissen Wahrscheinlichkeitsgrad schriftlich und zunächst einmal ‘zum eigenen Vergnügen’ entstanden sind. Die kunstvolle überbordende Reimfreudigkeit dieser Minnelieder, die in Auftragswerken in dieser ausgeprägten Form so nicht zu finden ist, steht unter anderem in Zusammenhang mit der von ihm in den Prologen geforderten delectare-Funktion, die seiner Ansicht nach das dominierende Moment im Falle einer Produktion ohne Zuhörerschaft sein sollte. Die Überbewertung von ‘Freude’ beim Zusammenfall von Produzent und Rezipient lässt sich mittels eines Kompensationsversuches erklären, bei dem durch Klangästhetik die mangelnde prodesse-Funktion bei eigener Rezeption in den Hintergrund tritt.
Die Arbeit ist so gegliedert, dass zunächst der soziokulturelle Hintergrund, zum Beispiel Konrads sozialer Status in Basel und die Zusammensetzung des Basler Gönnerkreises, in Erinnerung gerufen werden. Danach erfolgt die Analyse der beiden Prologe, die seine Einstellung zur Dichtung und sein Selbstverständnis als Dichter beleuchten soll, sowie ein Kapitel, das sich anhand exemplarischer Betrachtungen ausschließlich mit der Ausgestaltung der Reime in seinen Minneliedern beschäftigt, damit ein klareres Bild von Konrads meisterlicher Reimkunst und dessen Extraordinarität in manchen Liedern innerhalb des Gesamtœuvres gewonnen werden kann. Schließlich wird ein Blick auf die textinterne Sprechsituation der Lieder geworfen. Diese lässt, neben den verallgemeinernden Tendenzen und dem Hang zur Minnelehre, erkennen, dass einige seiner Lieder durch ihre deiktischen Verweise auf eine Vortragssituation vor Publikum hindeuten, dabei die Lieder 26 und 30 allerdings erneut aus der Reihe fallen, da sie weder Publikumsaufforderungen enthalten, noch es vorstellbar erscheint, dass diese reimlastigen Lieder, deren formale Untersuchung breiteren Raum einnehmen wird, Ad-hoc-Produktionen vor Publikum waren. Dadurch wird meine während der Analyse der Prologe aufgestellte These bezüglich des konkret verstandenen Dichtens zum eigenen Vergnügen im Falle dieser zwei Lieder bestätigt.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einführung
- 1. Werk und Wirkung Konrads von Würzburg
- 2. Konrad als Dichter
- 2.1 Zum poetologischen Konzept
- 2.1.1 Ez ist ein gar vil nütze dinc
- 2.1.2 Dichtkunst als Gottesgabe
- 2.2 Konrads Minnesang
- 2.2.1 Klangspiele
- 2.2.2 Zur Imagination von Publikum und Sänger in den Minneliedern
- 2.1 Zum poetologischen Konzept
- 3. Konrads Lieder als Kunststücke im späten 13. Jahrhundert
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, anhand von Überlegungen zur Poetologie Konrads, die den Prologen zu 'Partonopier und Meliur' und zum ‘Trojanerkrieg' entnommen werden, einen Teil seines lyrischen Werks, genauer gesagt die Lieder 13, 26 und 30, als Produktionen kenntlich zu machen, die mit einem gewissen Wahrscheinlichkeitsgrad schriftlich und zunächst einmal ‘zum eigenen Vergnügen' entstanden sind.
- Die kunstvolle, überbordende Reimfreudigkeit dieser Minnelieder steht in Zusammenhang mit der von Konrad geforderten delectare-Funktion.
- Die Überbewertung von ‘Freude' beim Zusammenfall von Produzent und Rezipient lässt sich mittels eines Kompensationsversuches erklären.
- Die Arbeit untersucht Konrads Einstellung zur Dichtung und sein Selbstverständnis als Dichter.
- Es wird die Ausgestaltung der Reime in seinen Minneliedern analysiert, um ein klareres Bild von Konrads meisterlicher Reimkunst zu gewinnen.
- Die Sprechsituation der Lieder wird unter Berücksichtigung von verallgemeinernden Tendenzen und dem Hang zur Minnelehre analysiert.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet den soziokulturellen Hintergrund, insbesondere Konrads sozialen Status in Basel und die Zusammensetzung des Basler Gönnerkreises.
Das zweite Kapitel analysiert die Prologe von 'Partonopier und Meliur' und dem 'Trojanerkrieg', um Konrads Einstellung zur Dichtung und sein Selbstverständnis als Dichter aufzuzeigen.
Das dritte Kapitel konzentriert sich auf die Ausgestaltung der Reime in den Minneliedern Konrads, um die Besonderheiten seiner Reimkunst und deren Extraordinarität in einzelnen Liedern innerhalb seines Gesamtwerks zu erforschen.
Das vierte Kapitel wirft einen Blick auf die textinterne Sprechsituation der Lieder und untersucht, wie die Lieder 26 und 30 aus der Reihe fallen, da sie weder Publikumsaufforderungen enthalten, noch als Ad-hoc-Produktionen vor Publikum vorstellbar sind.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt Konrads Poetologie, Minnesang, Reimkunst, Sprechsituation, delectare-Funktion, prodesse-Funktion, Kunststück, schriftliche Produktion, eigenes Vergnügen, Basler Gönnerkreis, Publikum und Textinterne Rezeption.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere an Konrad von Würzburgs Reimkunst?
Konrad ist bekannt für seine meisterliche und oft überbordende Reimfreudigkeit, die weit über die Anforderungen seiner Zeit hinausging und als Zeichen seines poetischen Selbstverständnisses gilt.
Was bedeutet die "delectare-Funktion" in Konrads Werk?
Sie beschreibt das Ziel der Dichtung, Vergnügen und Freude zu bereiten, was Konrad besonders bei Werken betont, die er "zum eigenen Vergnügen" verfasste.
Welche Rolle spielt der Basler Gönnerkreis für Konrad?
Der soziale Status Konrads in Basel und die Zusammensetzung seines Gönnerkreises beeinflussten maßgeblich die Produktion und Rezeption seiner literarischen Werke.
Unterscheiden sich Konrads Minnelieder von seinen Auftragswerken?
Ja, die Analyse zeigt, dass bestimmte Lieder (wie 13, 26 und 30) eine formale Komplexität aufweisen, die eher auf eine schriftliche Produktion für sich selbst als auf den Ad-hoc-Vortrag hindeutet.
Gilt Dichtkunst für Konrad als Gottesgabe?
Ja, in seinen poetologischen Prologen stellt Konrad die Dichtkunst als eine göttliche Gabe dar, die eine moralische und ästhetische Verpflichtung mit sich bringt.
- Quote paper
- Johanna Zeiß (Author), 2007, Untersuchung zu Konrads Minnesang unter Einbeziehung poetologischer Äußerungen in seiner Epik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83702