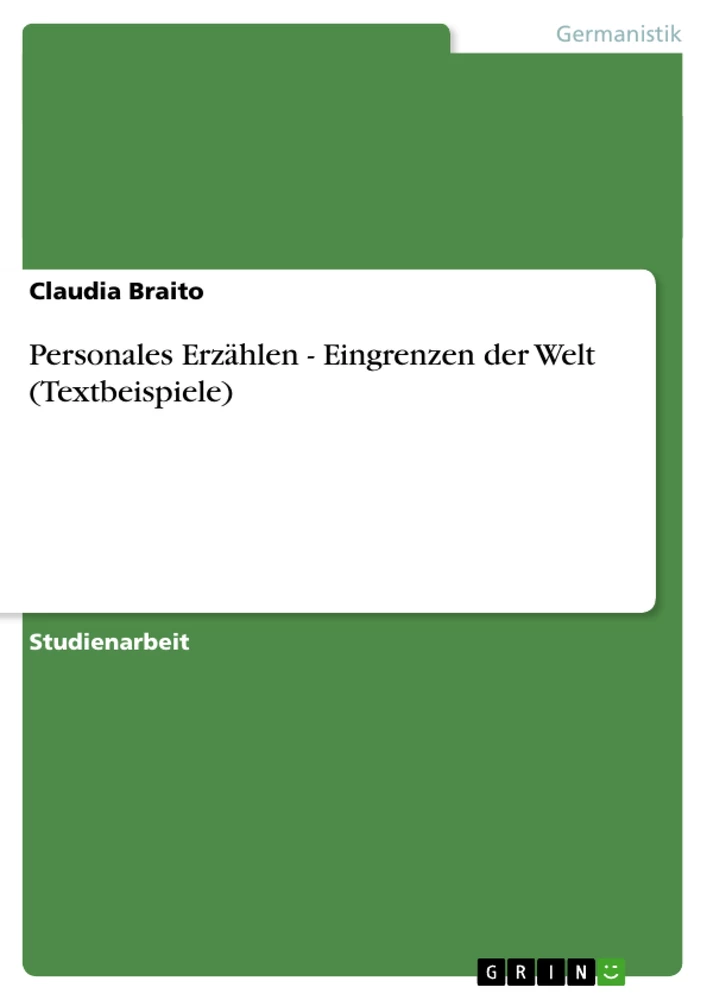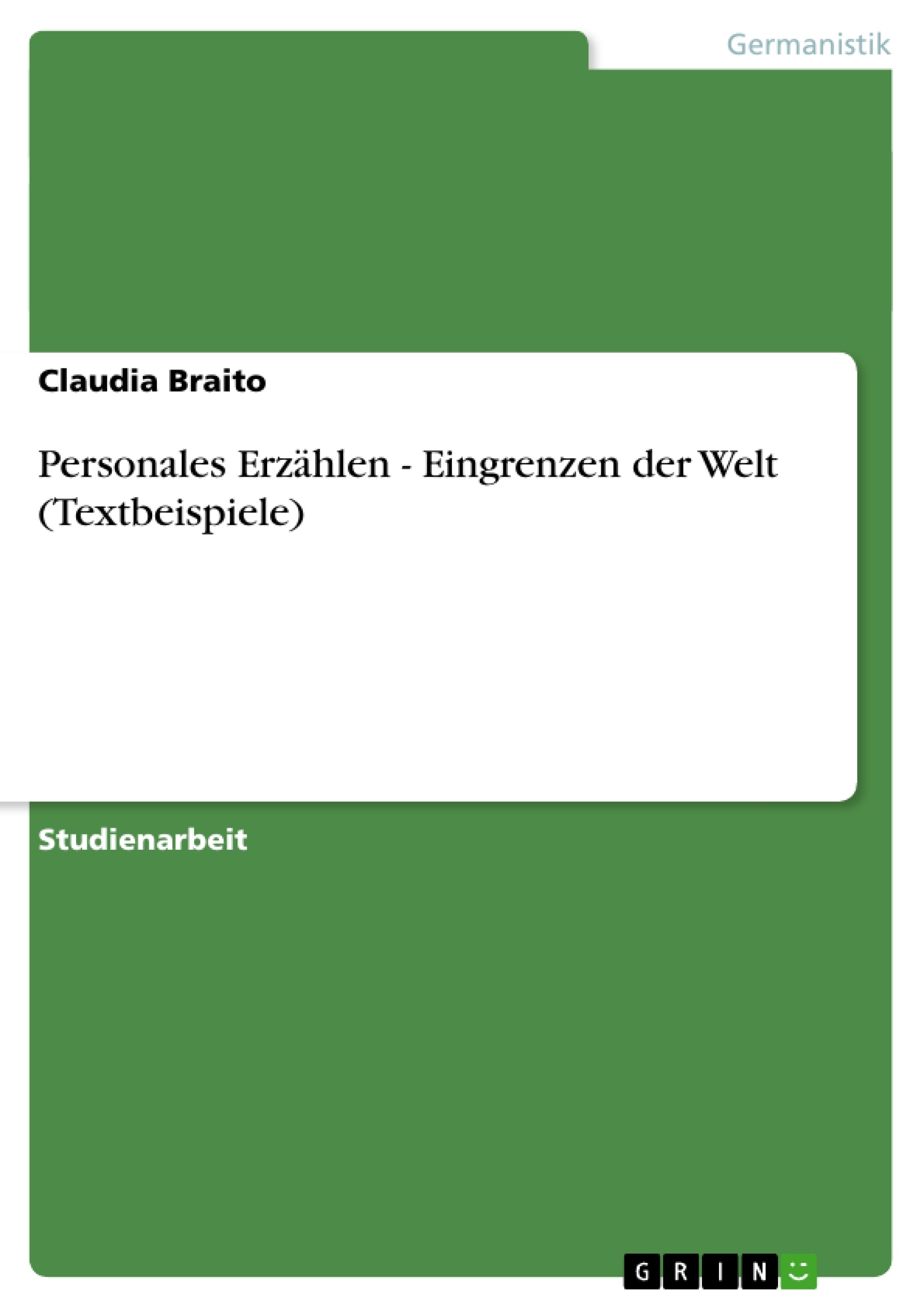Der personale Roman ist durch das Zusammenwirken von auktorialem und Ich-Erzählstil in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden. Von diesem Zeitpunkt an gewann der personale Roman immer mehr an Bedeutung. Sein Aufstieg wurde durch einige Faktoren besonders begünstigt:
1. Durch das philosophische Prinzip Objektivierung, welches im Roman zur Dramatisierung wird. Der personale Roman ist also „erzählerlos“ in dem Sinn, dass der Erzähler und dessen Einstellung/Gefühle nicht sichtbar werden. Es wird gezeigt, vorgeführt, dargestellt. Der personale Roman gleicht also einer Darstellung.
Der Leser im personalen Roman kann mit einem Zuschauer bei einem Schauspiel verglichen werden. 2. Durch eine erzähltechnische Neuerung (Einhaltung einer bestimmten Perspektive). 3. Durch ein neues Thema (Unterbewusstsein und Bewusstsein).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Theoretische Einführung
- 1.1. Definition
- 1.2. Charakteristische Merkmale der personalen Erzählsituation
- 1.3. Die geschichtliche Entwicklung der personalen Erzählung bzw. des personalen Romans
- 1.4. Die drei typischen Erzählsituationen (laut Stanzel)
- 1.4.1. Die auktoriale Erzählsituation
- 1.4.2. Die Ich-Erzählsituation
- 1.4.3. Die personale Erzählsituation
- 1.5. Der Typenkreis (nach Stanzel)
- 1.6. Die drei Konstituenten der Erzählsituationen
- 1.7. Übergangsformen zur personalen Erzählsituation
- 1.7.1. Von der auktorialen zur personalen Erzählsituation
- 1.7.2. Von der Ich-Erzählsituation zur personalen Erzählsituation
- 1.8. Weitere Theorien
- 1.9. Die Verwirklichung des personalen Erzählverhaltens
- 1.9.1. Der innere Monolog
- 1.9.2. Die erlebte Rede
- 1.9.3. Der Bewusstseinsroman
- 2. Erarbeitete Beispiele
- 2.1. Anna Seghers: „Das siebte Kreuz“
- 2.1.1. Fakten und formale Kennzeichen des Buches
- 2.1.2. Die Autorin
- 2.1.3. Der Inhalt
- 2.1.4. Die Leseprobe
- 2.1.5. Die historischen Hintergründe bzw. der Bezug zur Realität
- 2.2. Elias Canetti: „Die Blendung“
- 2.2.1. Fakten und formale Kennzeichen des Buches
- 2.2.2. Der Autor
- 2.2.3. Der Inhalt
- 2.2.4. Die Leseprobe
- 2.2.5. Die historischen Hintergründe bzw. der Bezug zur Realität
- 3. Nachweise
- 3.1. Zitate
- 3.2. Literaturangaben
- 3.3. Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der personalen Erzählsituation in der Literatur. Ziel ist es, die charakteristischen Merkmale dieser Erzähltechnik zu definieren und ihre geschichtliche Entwicklung nachzuvollziehen. Die Arbeit analysiert verschiedene theoretische Ansätze und veranschaulicht diese anhand von Beispielanalysen ausgewählter Romane.
- Definition und Charakteristika der personalen Erzählsituation
- Geschichtliche Entwicklung des personalen Romans
- Vergleich mit anderen Erzählperspektiven (auktorial, Ich-Erzählung)
- Analyse der Rolle des Erzählers und der Perspektivfigur
- Illustrative Beispiele aus der Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
1. Theoretische Einführung: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Einführung in die Theorie der personalen Erzählsituation. Es definiert den Begriff „personal“, beschreibt die charakteristischen Merkmale dieser Erzählweise, verfolgt ihre historische Entwicklung und vergleicht sie mit anderen Erzählformen wie der auktorialen und Ich-Erzählung. Es werden verschiedene theoretische Ansätze vorgestellt und die Rolle des Erzählers sowie die Perspektive der Figur im personalen Roman beleuchtet. Die Kapitel unterstreichen die Bedeutung von Techniken wie dem inneren Monolog und der erlebten Rede für die Erzeugung von Unmittelbarkeit und Illusion beim Leser.
2. Erarbeitete Beispiele: Dieses Kapitel präsentiert detaillierte Analysen von Anna Seghers’ „Das siebte Kreuz“ und Elias Canettis „Die Blendung“. Für jedes Werk werden Fakten, formale Kennzeichen, die Autorenbiografie, der Inhalt und relevante historische Hintergründe vorgestellt. Die Analysen fokussieren auf die Anwendung der im ersten Kapitel erläuterten theoretischen Konzepte und untersuchen, wie die jeweilige Erzählperspektive die Darstellung der Geschichte und der Figuren beeinflusst. Die ausgewählten Textauszüge veranschaulichen die praktischen Anwendung der personalen Erzählweise.
Schlüsselwörter
Personale Erzählsituation, Erzählperspektive, Erzähler, Romanfigur, auktoriale Erzählung, Ich-Erzählung, innerer Monolog, erlebte Rede, Bewusstseinsroman, Anna Seghers, Das siebte Kreuz, Elias Canetti, Die Blendung, Illusion, Unmittelbarkeit, Objektivierung.
Häufig gestellte Fragen zu: Personale Erzählsituation in der Literatur
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit befasst sich umfassend mit der personalen Erzählsituation in der Literatur. Sie definiert die charakteristischen Merkmale dieser Erzähltechnik, verfolgt ihre geschichtliche Entwicklung und analysiert verschiedene theoretische Ansätze. Die Arbeit veranschaulicht die Theorie anhand detaillierter Beispielanalysen der Romane „Das siebte Kreuz“ von Anna Seghers und „Die Blendung“ von Elias Canetti.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit deckt folgende Themen ab: Definition und Charakteristika der personalen Erzählsituation, die geschichtliche Entwicklung des personalen Romans, ein Vergleich mit anderen Erzählperspektiven (auktorial, Ich-Erzählung), die Analyse der Rolle des Erzählers und der Perspektivfigur, sowie illustrative Beispiele aus der Literatur. Zusätzlich werden Techniken wie der innere Monolog und die erlebte Rede im Kontext der personalen Erzählsituation behandelt.
Welche Romane werden analysiert?
Die Arbeit analysiert detailliert zwei Romane: „Das siebte Kreuz“ von Anna Seghers und „Die Blendung“ von Elias Canetti. Für jeden Roman werden Fakten, formale Kennzeichen, die Autorenbiografie, der Inhalt und die historischen Hintergründe beleuchtet. Die Analysen konzentrieren sich auf die Anwendung der im theoretischen Teil erläuterten Konzepte und untersuchen, wie die jeweilige Erzählperspektive die Darstellung der Geschichte und der Figuren beeinflusst.
Welche theoretischen Ansätze werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert verschiedene theoretische Ansätze zur personalen Erzählsituation, darunter die Konzepte von Stanzel zu den Erzählsituationen (auktorial, Ich-Erzählung, personal) und deren Übergangsformen. Die Bedeutung des inneren Monologs, der erlebten Rede und des Bewusstseinsromans im Kontext der personalen Erzählweise wird ebenfalls ausführlich diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter, die den Inhalt der Arbeit prägnant beschreiben, sind: Personale Erzählsituation, Erzählperspektive, Erzähler, Romanfigur, auktoriale Erzählung, Ich-Erzählung, innerer Monolog, erlebte Rede, Bewusstseinsroman, Anna Seghers, Das siebte Kreuz, Elias Canetti, Die Blendung, Illusion, Unmittelbarkeit, Objektivierung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptkapitel: Eine theoretische Einführung, die die personale Erzählsituation definiert und in einen größeren Kontext einordnet; eine Kapitel mit detaillierten Beispielanalysen von „Das siebte Kreuz“ und „Die Blendung“; und abschließend ein Kapitel mit Nachweisen (Zitate, Literaturangaben, Abbildungsverzeichnis).
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit richtet sich an Leser, die sich wissenschaftlich mit der Literaturwissenschaft, insbesondere mit Erzähltheorien und -techniken befassen. Sie eignet sich für Studierende der Germanistik und Literaturwissenschaft sowie für alle Interessierten, die ein tieferes Verständnis der personalen Erzählsituation entwickeln möchten.
- Arbeit zitieren
- Claudia Braito (Autor:in), 2002, Personales Erzählen - Eingrenzen der Welt (Textbeispiele), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/85892