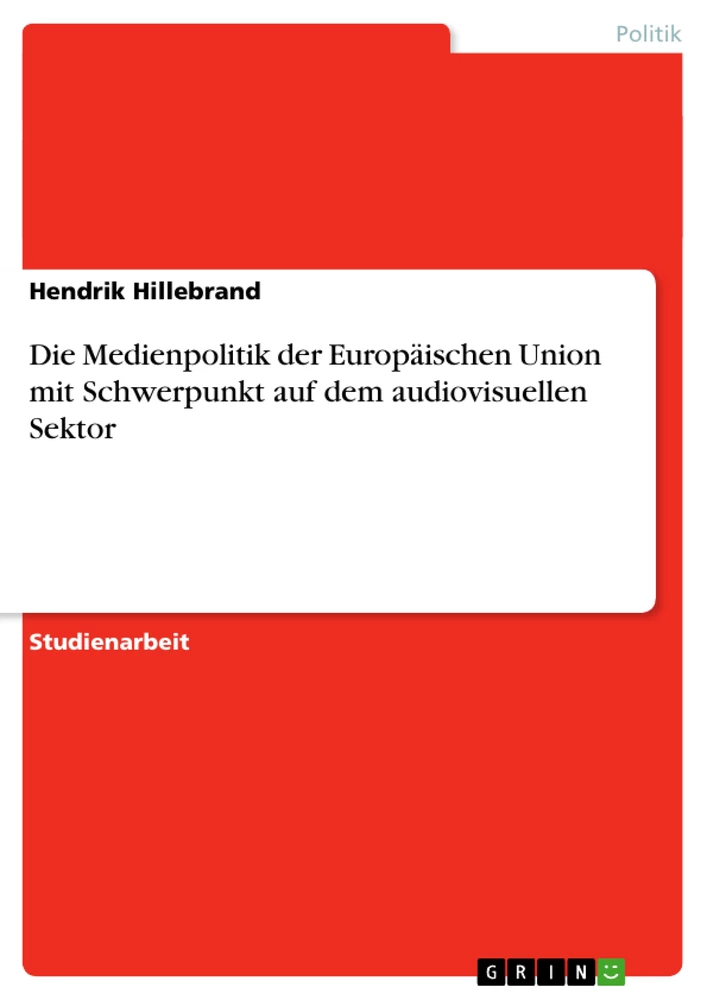Im Rahmen der sich immer weiter öffnenden Grenzen in Europa und den neuen technischen Möglichkeiten, die Anfang der achtziger Jahre aufkamen, wurde es für die Europäische Gemeinschaft notwendig, eine einheitliche und effektive Medienpolitik mit großer Tragweite, auch im Hinblick auf die Angleichung der vielen verschiedenen nationalen Medienvorschriften, zu entwickeln.
Das sensible Thema Medien konnte nur durch die Gemeinschaft, auch gegen den Widerstand einiger Mitgliedsstaaten (auch Deutschland) aufgegriffen werden, weil der Europäische Gerichtshof den Rundfunk 1974 als Dienstleistung klassifiziert hatte. Dadurch fiel er in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinschaft. Der kulturelle Aspekt des Rundfunks, der besonders von den öffentlich-rechtlichen Sendern und einigen Mitgliedsstaaten betont wird, ist hierdurch stark in den Hintergrund getreten.
Wenn man von europäischer Medienpolitik spricht, wird eigentlich immer die Fernsehrichtlinie gemeint. Sie bezieht sich größtenteils auf das Fernsehen, in sehr geringem Maße aber auch schon auf neuere Medienarten wie zum Beispiel Video on Demand. Alle diese Medienarten, die durch Bild und Ton definiert werden, lassen sich unter dem Dach der audiovisuellen Medien zusammenfassen.
Die Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“ sorgt dafür, dass es in der EU ein einheitliches Mindestmaß an Standards im Bereich des Rundfunks gibt. Sie orientiert sich dabei vor allem an wirtschaftlichen Interessen. Auch das Media Programm dient vornehmlich der Förderung von wirtschaftlichen Interessen, auch wenn durch die Förderung europäischer Produktionen eine gewisse Förderung europäischer Kultur vollzogen wird.
Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt auf der Entwicklung einer europäischen Medienpolitik von der Entstehung und Veränderung der Fernsehrichtlinie bis heute, sowie eines kurzen Ausblicks in die mögliche Zukunft europäischer Medienpolitik.
Da in der europäischen Medienpolitik nur audiovisuelle Medien eine große Rolle spielen, beschränke ich mich auf diese.
Der Bereich der Kultur fällt laut EG-Vertrag fast nur in den Kompetenzbereich der Mitgliedsstaaten und die Europäische Gemeinschaft darf hier nur fördernd tätig werden.
Da einige Mitglieder und Organisationen die Medien dem Bereich Kultur zuordnen und nicht als Dienstleistung betrachten, gab und gibt es Widerstand gegen die Medienpolitik der EU. Dadurch ergibt sich eine Kompetenzproblematik zwischen den Mitgliedsstaaten und der Gemeinschaft in dem Punkt: Wie weit darf sich die EU in die „Kultur“ der Mitgliedsstaaten einmischen?
Hier werde ich auf mögliche Kritik an der Medienpolitik der Europäischen Union eingehen und versuchen darzustellen, inwiefern sich die Kritik an der Medienpolitik der EU auf die aktuelle Diskussion zur Aktualisierung der Fernsehrichtlinie niederschlägt und zu welchen Veränderungen es in der zukünftigen Medienpolitik im Vergleich zu heute wahrscheinlich kommen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Akteure der Medienpolitik auf europäischer Ebene
- Die europäische Medienpolitik
- Die Entstehung einer europäischen Medienpolitik
- Der Weg zur Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“ des Rates der EG und deutschen Reaktionen
- Die Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“
- Weitere Bereiche europäischer Medienpolitik
- Kritik und Probleme der europäischen Medienpolitik
- Ausblick auf die künftige Medienpolitik der Europäischen Union
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung der europäischen Medienpolitik, insbesondere mit dem Schwerpunkt auf den audiovisuellen Sektor. Sie verfolgt das Ziel, die Entstehung und Veränderung der Fernsehrichtlinie von ihren Anfängen bis heute zu beleuchten und einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung der europäischen Medienpolitik zu geben.
- Die Entstehung einer europäischen Medienpolitik
- Die Fernsehrichtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“ und ihre Bedeutung
- Kritik und Probleme der europäischen Medienpolitik
- Zukünftige Herausforderungen und Entwicklungen der europäischen Medienpolitik
- Die Rolle der verschiedenen Akteure auf europäischer Ebene
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Arbeit beleuchtet die Notwendigkeit einer einheitlichen Medienpolitik in Europa angesichts der sich öffnenden Grenzen und neuen technologischen Möglichkeiten. Die Klassifizierung des Rundfunks als Dienstleistung durch den Europäischen Gerichtshof im Jahr 1974 führte zu einer Kompetenzverschiebung zugunsten der Europäischen Gemeinschaft, während der kulturelle Aspekt des Rundfunks in den Hintergrund trat. Der Fokus der Arbeit liegt auf der Fernsehrichtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“, die ein einheitliches Mindestmaß an Standards im Bereich des Rundfunks in der EU sicherstellt. Die Arbeit analysiert die Entwicklung der europäischen Medienpolitik und untersucht die Rolle der verschiedenen Akteure.
Akteure der Medienpolitik auf europäischer Ebene
Die Arbeit erläutert die wichtigsten Akteure der europäischen Medienpolitik, darunter die Organe der Europäischen Gemeinschaft, der Europarat und die Europäische Rundfunkunion (EBU). Die Kommission spielt eine wichtige Rolle in der Förderung des Wettbewerbs auf dem europäischen Medienmarkt und ist insbesondere für die Überprüfung von Unternehmensfusionen und Kooperationen zuständig. Der Ministerrat entscheidet über Richtlinien und Förderprogramme, während das Europäische Parlament mitentscheiden kann. Der Europäische Gerichtshof beeinflusst die Medienpolitik durch seine Rechtsprechung.
Die europäische Medienpolitik
Die Entstehung der europäischen Medienpolitik wird im Kontext der Integration Europas und der neuen technologischen Möglichkeiten beleuchtet. Die Arbeit schildert den Weg zur Fernsehrichtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“, die ein einheitliches Mindestmaß an Standards im Rundfunk in der EU sicherstellt. Die Richtlinie orientiert sich an wirtschaftlichen Interessen und spielt eine wichtige Rolle in der Regulierung des europäischen Medienmarktes. Die Arbeit beleuchtet auch weitere Bereiche europäischer Medienpolitik, die sich z.B. auf die Förderung europäischer Produktionen konzentrieren.
Schlüsselwörter
Europäische Medienpolitik, Fernsehrichtlinie, „Fernsehen ohne Grenzen“, audiovisuelle Medien, Rundfunk, Wettbewerb, Kultur, Akteure, Kommission, Ministerrat, Europäisches Parlament, Europäischer Gerichtshof, Europarat, Europäische Rundfunkunion.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Richtlinie "Fernsehen ohne Grenzen"?
Diese EU-Richtlinie sorgt für einheitliche Mindeststandards im Rundfunkbereich innerhalb der EU, um den freien Dienstleistungsverkehr für Fernsehsender zu ermöglichen.
Warum ist Medienpolitik auf EU-Ebene umstritten?
Es gibt einen Konflikt zwischen der Sichtweise der EU, die Rundfunk als wirtschaftliche Dienstleistung betrachtet, und Mitgliedstaaten (wie Deutschland), die den kulturellen Bildungsauftrag des Rundfunks betonen.
Welche Rolle spielt der Europäische Gerichtshof (EuGH)?
Der EuGH klassifizierte Rundfunk 1974 als Dienstleistung. Dadurch erhielt die Europäische Gemeinschaft die Kompetenz, den Sektor wirtschaftlich zu regulieren.
Was ist das MEDIA-Programm?
Das MEDIA-Programm ist ein Förderinstrument der EU, das die europäische Film- und Fernsehbranche finanziell unterstützt, um die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber US-Produktionen zu stärken.
Wer sind die wichtigsten Akteure der europäischen Medienpolitik?
Dazu gehören die EU-Kommission (Wettbewerb), der Ministerrat (Gesetzgebung), das Europäische Parlament und Organisationen wie die Europäische Rundfunkunion (EBU).
- Arbeit zitieren
- Hendrik Hillebrand (Autor:in), 2007, Die Medienpolitik der Europäischen Union mit Schwerpunkt auf dem audiovisuellen Sektor, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86572