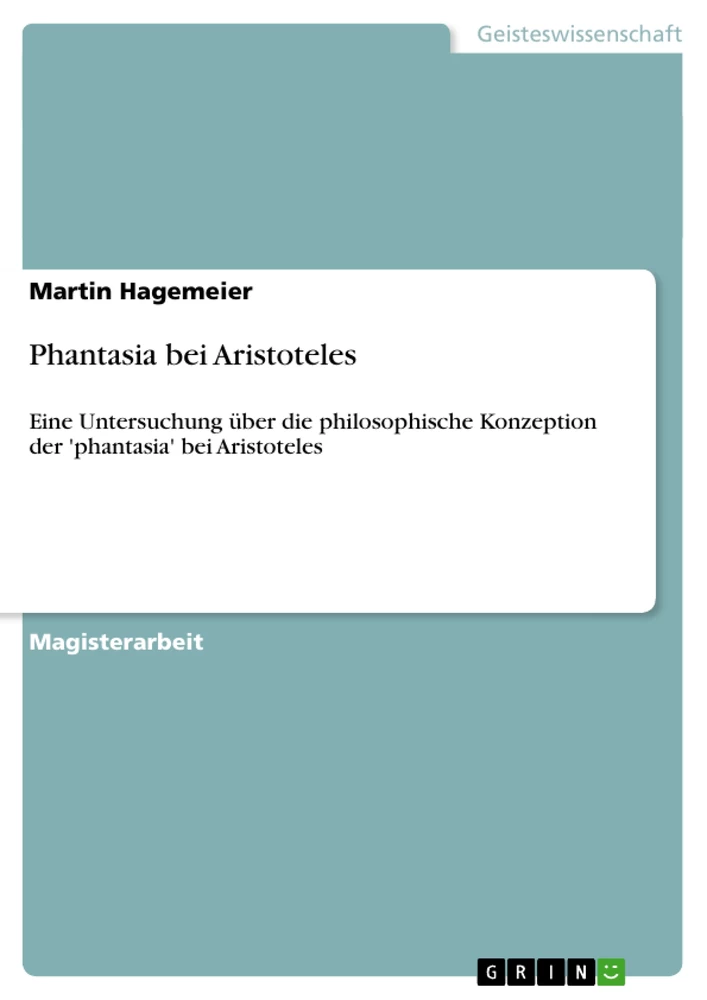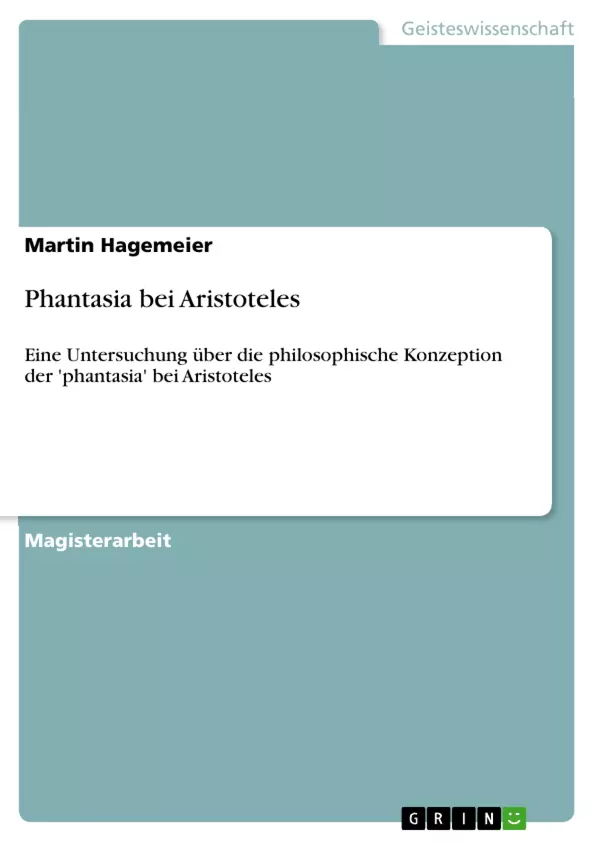Das Erkenntnis leitende Interesse der Magisterarbeit richtet sich in erster Linie auf die Bedeutung der phantasia (Vorstellungskraft / Imagination) bei Aristoteles.
Ich werde dabei die These verfolgen, dass Aristoteles die phantasia in seine Untersuchungen einführt, um eine Erklärung für psychophysische Prozesse zu ermöglichen, welche nicht anhand seiner kausalen Theorie der Wahrnehmung zu erklären sind. In zweiter Linie werde ich auch auf die Auseinandersetzung mit der phantasia in der Sekundärliteratur eingehen. In dieser Diskussion, entstanden differenzierte Ausarbeitungen über die phantasia bei Aristoteles. Die verschiedenen Verwendungsweisen von phantasia legen nahe, dass sich anhand der aristotelischen Wahrnehmungstheorie und der phantasia eine repräsentationalistische Theorie formulieren lässt, oder dass der phantasia eine zentrale Aufgabe bei der Interpretation der Sinneswahrnehmung zugesprochen werden kann.
Um einen ersten Einblick in die Verwendungsweise des Begriffes phantasia zu vermitteln, werde ich im ersten Kapitel zum einen auf die Übersetzung dieses Begriffes eingehen, und zum anderen Aristoteles‘ Verwendung der phantasia in Bezug auf ihr Vorkommen in der Tierwelt hervorheben. Im zweiten Teil wird die aristotelische Definition der phantasia in De Anima III, 3 untersucht werden. In diesem Kapitel wird die phantasia in die Untersuchung der Seele eingeführt, und dort befindet sich die umfangreichste Analyse der phantasia im Corpus Aristotelicum. Das dritte Kapitel geht über auf die verschiedenen Anwendungsweisen der phantasia bei Aristoteles. In ihm werde ich die Ausführungen aus De Memoria et Reminiscentia (kurz De Memoria) über die Bedeutung der phantasia für die Erinnerung aufgreifen. Daran anschließend wird das vierte Kapitel die in De Insomniis enthaltenen Aussagen über die physiologische Entstehungsweise der phantasia erörtern, welche die Ausführungen über die kausale Bestimmung der phantasia in De Anima III, 3 ergänzen. Das fünfte Kapitel wird die Beziehung zwischen der phantasia und dem Denkvermögen behandeln. Dieses Kapitel wird die aristotelische Argumentation in De Anima III, 7-8 untersuchen, in welcher von Aristoteles die These begründet wird, dass das Denken auf Vorstellungsbilder (phantasmata) angewiesen ist. Im Anschluss daran werde ich, im letzten Teil meiner Arbeit, der Frage nachgehen, inwiefern sich das aristotelische Konzept der phantasia zusammenführen lässt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Vorbemerkungen zur phantasia bei Aristoteles
- 1.1. Zur Übersetzung des Begriffes
- 1.2. Phantasia in der Tierwelt
- 2. Die Definition der phantasia in De Anima III, 3
- 2.1. Die Einführung der phantasia
- 2.2. Die nominale Definition der phantasia
- 2.3. Die negative Bestimmung der phantasia
- 2.3.1. Die Nicht-Identität der phantasia mit der Wahrnehmung
- 2.3.2. Die Nicht-Identität der phantasia mit Wissenschaft und Vernunft
- 2.3.3. Die Nicht-Identität der phantasia mit der Meinung
- 2.3.4. Die Widerlegung des platonischen Standpunktes
- 2.4. Die kausale Herleitung der phantasia aus der Wahrnehmung
- 2.5. Der Stellenwert der realen Definition
- 3. Phantasia und Erinnerung
- 3.1. Das Denken ist auf phantasmata angewiesen (1)
- 3.2. Der Bildcharakter der phantasmata
- 4. Phantasia und Träume
- 4.1. Welcher Seelenteil ist für das Träumen verantwortlich?
- 4.2. Exkurs in die Physiologie der Wahrnehmung
- 4.3. Aristoteles Basis der physiologischen Erklärung des Traums
- 4.4. Die physiologische Entstehung der Träume
- 4.5. Der Zentralsinn als Baustein einer Bewusstseinstheorie?
- 5. Phantasia und Denken
- 5.1. Das Denken ist auf phantasmata angewiesen (2)
- 6. Eine Einschätzung der phantasia bei Aristoteles
- 6.1. Lässt sich ein einheitliches Konzept der phantasia entwickeln?
- 6.2. Philosophische Auswirkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht den Begriff der "phantasia" in der aristotelischen Seelenlehre. Das Hauptziel ist es, die Bedeutung der phantasia für Aristoteles' Verständnis psychophysischer Prozesse zu ergründen, insbesondere dort, wo seine kausale Wahrnehmungstheorie nicht ausreicht. Zusätzlich wird die Rezeption und Interpretation der phantasia in der Sekundärliteratur beleuchtet.
- Aristoteles' Definition und Abgrenzung der phantasia von anderen Seelenvermögen
- Die Rolle der phantasia bei Erinnerung, Träumen und Denken
- Die phantasia als Erklärung psychophysischer Prozesse
- Diskussion unterschiedlicher Interpretationen der phantasia in der modernen Forschung
- Der Stellenwert der phantasia in Aristoteles' Gesamtwerk
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Fokus der Arbeit auf die "phantasia" bei Aristoteles, insbesondere im Kontext von *De Anima* und den *Parva Naturalia*. Sie hebt die vielseitigen Anwendungen des Begriffs hervor, von Sinnestäuschungen bis zum Denken, und benennt die These, dass Aristoteles die phantasia als Erklärung für psychophysische Prozesse einführt, die seine Wahrnehmungstheorie nicht abdeckt. Die Arbeit wird auch die Sekundärliteratur zum Thema berücksichtigen, insbesondere die Debatte um eine mögliche repräsentationalistische Theorie der Sinneswahrnehmung basierend auf der phantasia.
1. Vorbemerkungen zur phantasia bei Aristoteles: Dieses Kapitel legt den Grundstein für die weitere Analyse, indem es die Übersetzungsprobleme des Begriffs "phantasia" beleuchtet und Aristoteles' Verwendung des Begriffs im Kontext der Tierwelt untersucht. Dies dient dazu, das Verständnis der "phantasia" im Gesamtkontext der aristotelischen Philosophie zu vertiefen und mögliche Interpretationsspielräume zu erkennen.
2. Die Definition der phantasia in De Anima III, 3: Dieses Kapitel analysiert die zentrale Passage in *De Anima* III, 3, die die umfangreichste Darstellung der phantasia bei Aristoteles beinhaltet. Es konzentriert sich auf die Definition der phantasia, sowohl ihre positive Beschreibung als auch ihre negative Abgrenzung von Wahrnehmung, Vernunft, Meinung und dem platonischen Standpunkt. Die kausale Herleitung der phantasia aus der Wahrnehmung und der Stellenwert der realen Definition werden eingehend diskutiert.
3. Phantasia und Erinnerung: Das Kapitel untersucht die Rolle der phantasia im Zusammenhang mit Erinnerung, basierend auf *De Memoria et Reminiscentia*. Es analysiert, wie Aristoteles die phantasia als Grundlage des Denkens und Erinnerns versteht und welchen Stellenwert der "Bildcharakter" der phantasmata in diesem Prozess einnimmt. Die Argumentation wird detailliert nachvollzogen und in den Kontext der aristotelischen Erkenntnistheorie eingeordnet.
4. Phantasia und Träume: Dieses Kapitel befasst sich mit der Behandlung der phantasia im Kontext von Träumen in *De Insomniis*. Die physiologische Entstehung der Träume wird im Detail analysiert, insbesondere die Rolle des Zentralsinns. Der Zusammenhang zwischen der physiologischen Erklärung des Traumes und der kausalen Bestimmung der Phantasia in *De Anima* III, 3 wird beleuchtet, um ein ganzheitliches Bild von Aristoteles' Verständnis zu ermöglichen.
5. Phantasia und Denken: Dieses Kapitel widmet sich der Analyse der Beziehung zwischen phantasia und Denkvermögen in *De Anima* III, 7-8. Es untersucht, wie Aristoteles die phantasia in seinen Überlegungen zum Denken einbindet und wie diese Beziehung seine Gesamtphilosophie beeinflusst. Die Argumentation wird detailliert dargestellt und kritisch gewürdigt.
Schlüsselwörter
Phantasia, Aristoteles, De Anima, Wahrnehmung, Erinnerung, Träume, Denken, psychophysische Prozesse, Repräsentationalismus, Seelenlehre, Seelenvermögen, *De Memoria et Reminiscentia*, *De Insomniis*, kausal, Bildcharakter, phantasmata.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: "Phantasia bei Aristoteles"
Was ist der Gegenstand der Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht den Begriff der „Phantasia“ in der aristotelischen Seelenlehre. Der Fokus liegt auf der Bedeutung der Phantasia für Aristoteles' Verständnis psychophysischer Prozesse, insbesondere dort, wo seine kausale Wahrnehmungstheorie nicht ausreicht. Die Arbeit beleuchtet auch die Rezeption und Interpretation der Phantasia in der Sekundärliteratur.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Aristoteles' Definition und Abgrenzung der Phantasia von anderen Seelenvermögen; die Rolle der Phantasia bei Erinnerung, Träumen und Denken; die Phantasia als Erklärung psychophysischer Prozesse; eine Diskussion unterschiedlicher Interpretationen der Phantasia in der modernen Forschung; und schließlich den Stellenwert der Phantasia in Aristoteles' Gesamtwerk.
Welche aristotelischen Schriften stehen im Mittelpunkt der Analyse?
Die Analyse konzentriert sich vor allem auf Aristoteles' *De Anima* (insbesondere Buch III, Kapitel 3), *De Memoria et Reminiscentia* und *De Insomniis*. Diese Schriften bieten die wichtigsten Quellen für das Verständnis von Aristoteles' Konzeption der Phantasia.
Wie wird die Phantasia bei Aristoteles definiert und abgegrenzt?
Die Arbeit analysiert die Definition der Phantasia in *De Anima* III, 3, sowohl ihre positive Beschreibung als auch ihre negative Abgrenzung von Wahrnehmung, Vernunft, Meinung und dem platonischen Standpunkt. Die kausale Herleitung der Phantasia aus der Wahrnehmung und der Stellenwert der realen Definition werden eingehend diskutiert.
Welche Rolle spielt die Phantasia in den Bereichen Erinnerung, Träume und Denken?
Die Arbeit untersucht die Rolle der Phantasia bei der Erinnerung (in *De Memoria et Reminiscentia*), im Zusammenhang mit Träumen (*De Insomniis*) und im Denkprozess (*De Anima* III, 7-8). Es wird analysiert, wie Aristoteles die Phantasia als Grundlage des Denkens und Erinnerns versteht und welchen Stellenwert der „Bildcharakter“ der Phantasmata in diesen Prozessen einnimmt.
Wie erklärt Aristoteles psychophysische Prozesse mit Hilfe der Phantasia?
Die Arbeit argumentiert, dass Aristoteles die Phantasia als Erklärung für psychophysische Prozesse einführt, die seine Wahrnehmungstheorie nicht abdeckt. Dies wird insbesondere im Kontext von Träumen und dem Verhältnis von Wahrnehmung und Denken untersucht.
Wie wird die Sekundärliteratur zum Thema berücksichtigt?
Die Arbeit berücksichtigt die Sekundärliteratur zum Thema Phantasia bei Aristoteles, insbesondere die Debatte um eine mögliche repräsentationalistische Theorie der Sinneswahrnehmung basierend auf der Phantasia. Unterschiedliche Interpretationen der Phantasia in der modernen Forschung werden diskutiert.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Phantasia, Aristoteles, *De Anima*, Wahrnehmung, Erinnerung, Träume, Denken, psychophysische Prozesse, Repräsentationalismus, Seelenlehre, Seelenvermögen, *De Memoria et Reminiscentia*, *De Insomniis*, kausal, Bildcharakter, Phantasmata.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und was ist ihr jeweiliger Inhalt?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung, gefolgt von Kapiteln zu Vorbemerkungen zur Phantasia bei Aristoteles, der Definition der Phantasia in *De Anima* III, 3, Phantasia und Erinnerung, Phantasia und Träume, Phantasia und Denken, und schliesslich einer Einschätzung der Phantasia bei Aristoteles. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Phantasia im Kontext der aristotelischen Philosophie und Analysiert dies anhand relevanter Textstellen.
- Quote paper
- M. A. Martin Hagemeier (Author), 2004, Phantasia bei Aristoteles, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87824