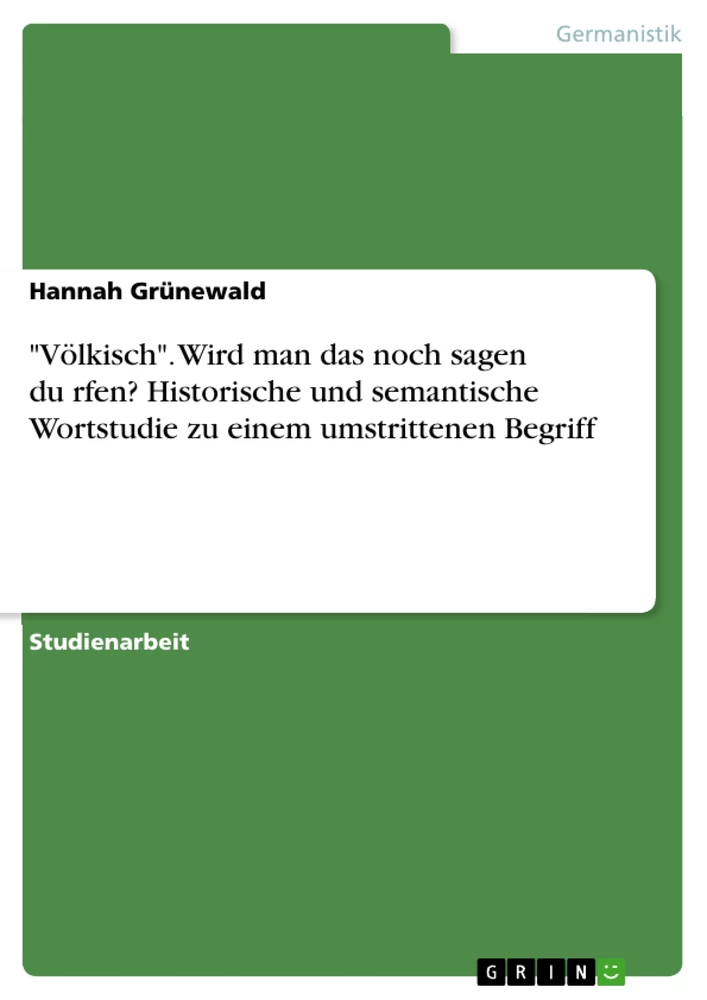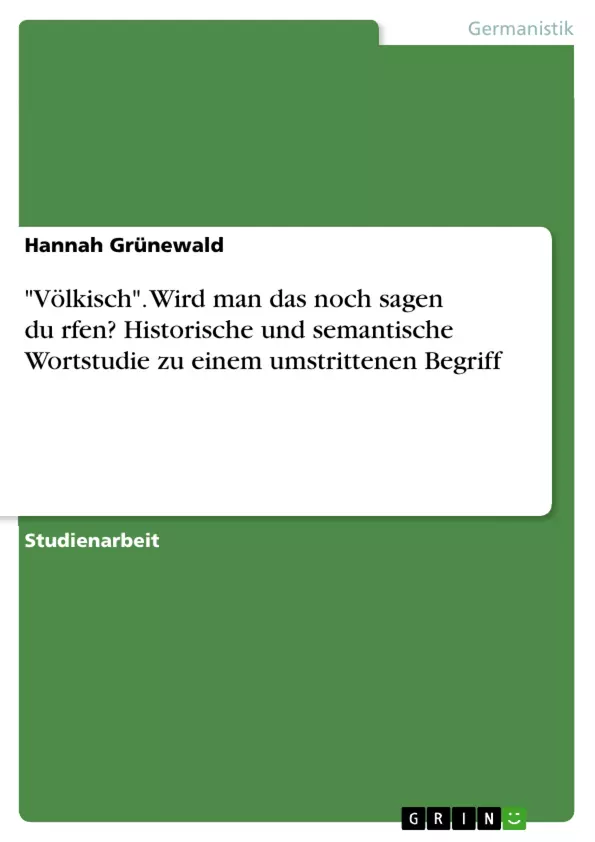In einem Interview der damaligen AfD-Vorsitzenden Frauke Petry mit der Zeitung Welt am Sonntag ließ sie verlauten, dass das Wort „völkisch“ aus der negativen Konnotationsecke zu nehmen sei, da es direkt mit dem Substantiv Volk korreliere und nicht per definitionem als „rassistisch“ zu betrachten sei. Petry erläuterte weiter: „Ich benutze diesen Begriff zwar selbst nicht, aber mir missfällt, dass er ständig nur in einem negativen Kontext benutzt wird“. Beklagenswert für sie ist, „dass es bei der Ächtung des Begriffes ‚völkisch’ nicht bleibt, sondern der negative Beigeschmack auf das Wort ‚Volk’ ausgedehnt wird“. Presse, Rundfunk und Fernsehen reagierten auf diese Forderung mit Empörung. Doch warum erhitzen sich die Gemüter bei einem Adjektiv? Ohne martialisch klingen zu wollen, geht es bei diesen Auseinandersetzungen um einen Kampf der Wörter. Die AfD erhofft sich eine Zurückeroberung von bestimmten Wörtern und deren Konnotationen. Es geht um die Macht der Worte und ihre politisch- gesellschaftliche Einflussnahme, die immer auch im Spannungsfeld von Geschichte und Gegenwart zu betrachten ist.
Um die Aussage Petrys differenziert und wissenschaftlich zu untersuchen, werde ich mich in der vorliegenden Arbeit um eine dezidierte und pointierte Wortstudie des Begriffs „völkisch“ bemühen. Dabei wird mit einem dreischrittigen diachronen Analyseverfahren, von der Wortherkunft und der althochdeutschen und mittelhochdeutschen Überlieferungssituation auf die Wortnutzung im Nationalsozialismus und schließlich die Wort- Verwendung in der Nachkriegszeit, der DDR und der Gegenwart ermittelt. Maßgeblich für die Analyse ist eine grundlegende Auseinandersetzung der Wechselbeziehung von Substantiven und deren Adjektiven, die ich der Arbeit voranstellen möchte. Desweiteren wird, neben der sprachwissenschaftlichen und sprachgeschichtlichen Auseinandersetzung, auch auf die semantische Bedeutung von Volk und „völkisch“ hingewiesen, ist diese doch dicht verwoben mit der akuten Fragestellung. Im Fokus steht die sprachwissenschaftliche Untersuchung des Wortes „völkisch“, die verdeutlichen soll, dass sich Frauke Petry eines historisch prekären Begriffs bedient und sich mit dessen Rehabilitierungsversuch in eine eindeutig rechts-populistische-nationalistische Position verortet, die geschützt vom Grundgesetz zwar veräußert, politisch und gesellschaftlich jedoch diskutiert und kritisiert werden muss.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Bemerkung
- Morphologische Betrachtung
- Wortstudie: „völkisch“
- Wortherkunft
- Nationalsozialismus
- Volk
- „völkisch“
- Nachkriegszeit, DDR und heute
- Kritische Einschätzung: AfD und der Kampf um Wörter
- Fazit und Appell
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verwendung des Wortes „völkisch“, insbesondere im Kontext der Aussage von Frauke Petry, der damaligen AfD-Vorsitzenden. Ziel ist es, durch eine diachrone Analyse die semantische Entwicklung des Wortes und seine heutige Problematik zu beleuchten. Die wissenschaftliche Untersuchung soll zeigen, dass der Begriff „völkisch“ aufgrund seiner historischen Belastung problematisch ist und dessen Verwendung in einem politischen Kontext kritisch zu betrachten ist.
- Semantische Entwicklung des Wortes „völkisch“
- Der Einfluss des Nationalsozialismus auf die Bedeutung von „völkisch“
- Die aktuelle Relevanz und die politische Instrumentalisierung des Begriffs
- Die Beziehung zwischen dem Substantiv „Volk“ und dem Adjektiv „völkisch“
- Der Kampf um die Deutungshoheit von Wörtern in der politischen Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitende Bemerkung: Die Arbeit untersucht die Aussage von Frauke Petry, die eine positive Konnotation des Wortes „völkisch“ fordert. Dies wird als „Kampf um Wörter“ im politischen Kontext eingeordnet. Die Analyse fokussiert sich auf eine diachrone Betrachtung des Wortes „völkisch“, beginnend mit seiner Wortherkunft über den Nationalsozialismus bis zur Gegenwart, um Petrys Aussage zu bewerten und die Problematik des Begriffs zu verdeutlichen. Der Fokus liegt auf der sprachwissenschaftlichen Perspektive, ergänzt durch Hinweise auf die semantische Bedeutung in Verbindung mit dem Begriff „Volk“.
Morphologische Betrachtung: Dieses Kapitel analysiert die morphologische Struktur des Wortes „völkisch“, indem es das Suffix „-isch“ und dessen Bedeutung und Entwicklung beleuchtet. Es wird die Wortbildung von „völkisch“ aus dem Substantiv „Volk“ untersucht, inklusive der morphologischen Veränderungen wie Umlautung. Das Kapitel diskutiert die Polysemie des Suffixes „-isch“ und die Möglichkeit der Manipulation durch die bewusste Verwendung von mehrdeutigen Wörtern. Die Analyse legt den Grundstein für das Verständnis der semantischen Entwicklung von „völkisch“ in den folgenden Kapiteln.
Wortstudie: „völkisch“: Dieses Kapitel bietet eine diachrone Analyse des Wortes „völkisch“, beginnend mit seiner Wortherkunft und seiner Bedeutung im Nationalsozialismus bis hin zu seiner Verwendung in der Nachkriegszeit, der DDR und der Gegenwart. Es untersucht den Kontext und die Entwicklung der Bedeutung in verschiedenen historischen Phasen und verdeutlicht so die problematische Konnotation des Wortes aufgrund seiner Verwendung im Nationalsozialismus. Die Analyse beleuchtet die engen Verbindungen zwischen dem Wort "Volk" und "völkisch" im nationalsozialistischen Kontext und betont die Gefahren einer unkritischen Verwendung des Wortes heute.
Schlüsselwörter
„völkisch“, Volk, Nationalsozialismus, Semantik, Wortgeschichte, politische Sprache, Wortkonnotation, AfD, Manipulation, Sprachwissenschaft, Diachronie, Morphologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ): Analyse des Begriffs „völkisch“
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert den Begriff „völkisch“, insbesondere im Kontext einer Aussage von Frauke Petry (ehemalige AfD-Vorsitzende), die eine positive Konnotation des Wortes forderte. Die Arbeit untersucht die semantische Entwicklung des Wortes diachron, von seiner Wortherkunft über den Nationalsozialismus bis in die Gegenwart, um die Problematik seiner Verwendung aufzuzeigen.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Analyse verwendet verschiedene Methoden: eine diachrone Betrachtung der semantischen Entwicklung von „völkisch“, eine morphologische Untersuchung der Wortstruktur, eine Kontextualisierung des Begriffs in verschiedenen historischen Epochen (Nationalsozialismus, Nachkriegszeit, DDR, Gegenwart) und eine kritische Auseinandersetzung mit der politischen Instrumentalisierung des Wortes.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Eine einleitende Bemerkung, eine morphologische Betrachtung des Wortes, eine detaillierte Wortstudie zu „völkisch“ (einschließlich Wortherkunft, NS-Zeit, Nachkriegszeit und Gegenwart), eine kritische Einschätzung der Verwendung des Begriffs durch die AfD und abschließend ein Fazit und Appell.
Wie wird der Nationalsozialismus in der Analyse berücksichtigt?
Der Nationalsozialismus spielt eine zentrale Rolle, da die Verwendung von „völkisch“ in dieser Zeit eng mit rassistischen und nationalistischen Ideologien verbunden war und diese historische Belastung die heutige Verwendung des Begriffs stark prägt. Die Arbeit untersucht die enge Verbindung zwischen „Volk“ und „völkisch“ im NS-Kontext und die daraus resultierenden Gefahren einer unkritischen Verwendung heute.
Welche Rolle spielt die AfD in der Analyse?
Die Aussage von Frauke Petry dient als Ausgangspunkt der Analyse. Die Arbeit untersucht, wie die AfD den Begriff „völkisch“ im politischen Diskurs einsetzt und welche Strategien der „Kampf um Wörter“ in der politischen Kommunikation beinhaltet.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit der Arbeit wird im letzten Kapitel präsentiert und beinhaltet einen Appell zur kritischen Auseinandersetzung mit der Verwendung des Begriffs „völkisch“ aufgrund seiner problematischen historischen Konnotation. Die Arbeit zeigt, dass eine unkritische Verwendung des Wortes „völkisch“ in einem politischen Kontext problematisch und gefährlich ist.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: „völkisch“, Volk, Nationalsozialismus, Semantik, Wortgeschichte, politische Sprache, Wortkonnotation, AfD, Manipulation, Sprachwissenschaft, Diachronie, Morphologie.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit richtet sich an ein akademisches Publikum und Personen, die sich wissenschaftlich mit dem politischen Sprachgebrauch, der Semantik und der Geschichte des Begriffs „völkisch“ auseinandersetzen möchten. Sie ist für die akademische Forschung und die Analyse politischer Sprache konzipiert.
- Quote paper
- Hannah Grünewald (Author), 2018, "Völkisch". Wird man das noch sagen dürfen? Historische und semantische Wortstudie zu einem umstrittenen Begriff, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/886260