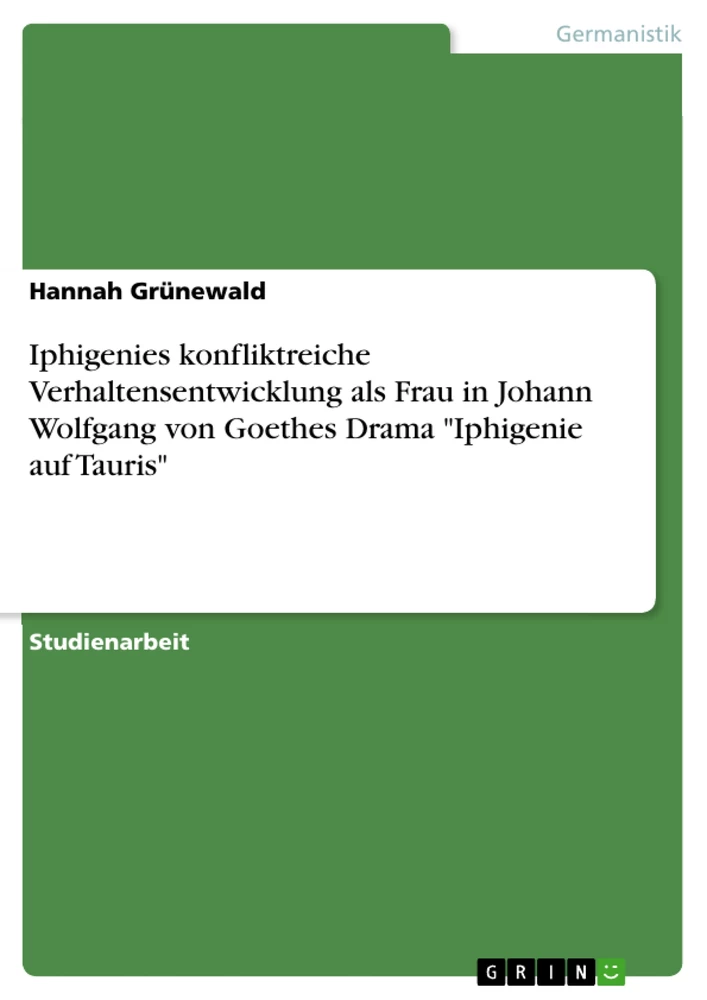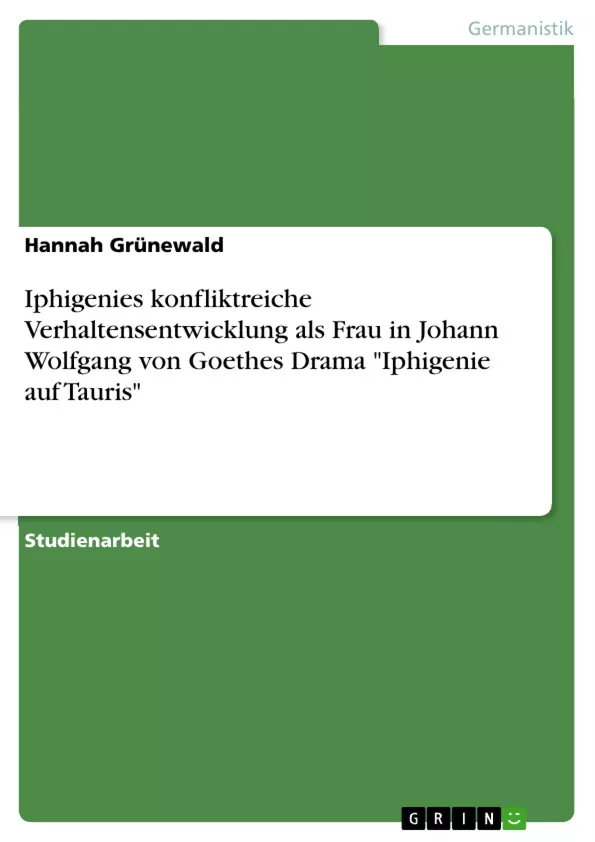Iphigenie auf Tauris, ein sowohl formal als auch inhaltlich an Aristoteles und die Antike angelehntes Drama von Johann Wolfgang von Goethe, das 1779 vom Autor in seinem ersten Jahrzehnt in Weimar verfasst und 1786 in Versform aktualisiert wurde. Ein Klassiker in Bücherregalen und auf Theaterbühnen. Aber ist es auch ein großes humanistisch-pädagogisches Lehrstück?
Geradezu einig war man sich jahrelang um die "klassisch-humanistische" Deutung der Iphigenie, deren "Lesart lange unbezweifelt" blieb. Die Komponente der inneren Konflikte der Protagonistin blieben oft im Dunkeln, dabei scheint es fast unmöglich, bei der Analyse der Iphigenie nicht über unschlüssige Muster und Motive zu stolpern. Iphigenie als Heilerin und heilspendende, humanistische Heroine zu deklarieren, simplifiziert ihren vielschichtigen Charakter in allzu euphorischer Manier. In der vorliegenden Arbeit möchte ich anhand der Untersuchung der Kommunikation und des Verhaltens Iphigenies widersprüchliches, konfliktreiches Inneres zum Gegenstand der Interpretation machen. Dabei werde ich mich kritisch mit der Frage auseinandersetzen, wie sich Iphigenie als Mensch, vor allem aber als Frau den Konflikten ihres Daseins und den Konzepten des idealisierten Frauenbildes stellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Bemerkung
- Frauenrolle- historische Kontextuierung
- Konstitution der Iphigenie
- Figurenkonstellationen
- Iphigenie und Arkas
- Iphigenie und die angekündigte Heirat
- Iphigenie und Thoas
- Unterschiedliche Rezeption des Frauengeschlechts
- Iphigenie und Orest
- Der schwache Mann?
- Orest Erlösung
- Iphigenie und Arkas
- Analyse der Haltung Iphigenies
- Dilemma und ihr Umgang mit der Flucht
- Pylades und Iphigenie
- Egozentrikerin im Humanistenpelz
- Zum Götterglauben Iphigenies
- Geständnis und Bekenntnis
- ,,Ich habe nichts als Worte“
- Deutung des Endes
- Anmerkungen
- Iphigenie als weibliche Repräsentantin
- Parallelen zu Goethes Leben
- Iphigenie die Heilung? Iphigenie die Hoffnung! Ein Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Iphigenies konfliktreicher Verhaltensentwicklung als Frau in Johann Wolfgang von Goethes Drama Iphigenie auf Tauris. Sie untersucht, wie sich Iphigenie als Mensch, vor allem aber als Frau den Konflikten ihres Daseins und den Konzepten des idealisierten Frauenbildes stellt.
- Die historische Kontextuierung der Frauenrolle in der Antike und zu Goethes Lebzeiten
- Die Analyse von Iphigenies Konstitution und ihrer Ausgangssituation
- Die Untersuchung der Figurenkonstellationen und ihrer Bedeutung für Iphigenies Entwicklung
- Die kritische Auseinandersetzung mit Iphigenies Verhalten und ihren inneren Konflikten
- Die Interpretation von Iphigenies Haltung und ihrer Rolle als Frau in der Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer einleitenden Bemerkung zu Iphigenie auf Tauris als Drama und der Problematik der traditionellen „klassisch-humanistischen“ Deutung von Iphigenies Charakter. Anschließend wird der historische Kontext der Frauenrolle in der Antike und zu Goethes Lebzeiten beleuchtet, um Iphigenies Handeln und Denken besser zu verstehen. Im dritten Kapitel wird Iphigenies Konstitution und ihre Ausgangssituation im Prolog des Dramas analysiert. Das vierte Kapitel widmet sich den Figurenkonstellationen, wobei Iphigenies Beziehung zu Arkas, Thoas und Orest im Detail untersucht wird. Schließlich wird im fünften Kapitel Iphigenies Haltung und ihr Umgang mit den Konflikten ihres Daseins analysiert.
Schlüsselwörter
Iphigenie auf Tauris, Johann Wolfgang von Goethe, Frauenrolle, historische Kontextuierung, Konstitution, Figurenkonstellationen, Verhalten, Konflikte, Frauenbild, Ideal, Kommunikation, Analyse, Interpretation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema von Goethes "Iphigenie auf Tauris"?
Das Drama behandelt die innere Entwicklung Iphigenies, ihren Konflikt zwischen Pflicht, Wahrheit und dem Wunsch nach Freiheit sowie die Überwindung des Fluchs ihrer Familie durch Humanität.
Wie wird die Frauenrolle im Drama kritisch hinterfragt?
Die Arbeit untersucht, wie Iphigenie sich gegen das idealisierte Frauenbild ihrer Zeit stellt und als Frau eigenständig in einer von Männern dominierten Welt agiert.
Was bedeutet die "klassisch-humanistische" Deutung?
Es ist die traditionelle Lesart, die Iphigenie als reine Heilerin und Verkörperung des Guten sieht, wobei oft ihre menschlichen Widersprüche vernachlässigt werden.
Welche Bedeutung hat Iphigenies Beziehung zu Orest?
Durch ihre geschwisterliche Liebe und ihre Aufrichtigkeit gelingt es Iphigenie, Orest von seinem Wahnsinn und dem Fluch der Tantaliden zu erlösen.
Warum ist das Geständnis am Ende des Dramas so wichtig?
Iphigenie entscheidet sich gegen die List und für die Wahrheit gegenüber König Thoas, was den Sieg der Menschlichkeit über die Gewalt symbolisiert.
- Quote paper
- Hannah Grünewald (Author), 2016, Iphigenies konfliktreiche Verhaltensentwicklung als Frau in Johann Wolfgang von Goethes Drama "Iphigenie auf Tauris", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/886734