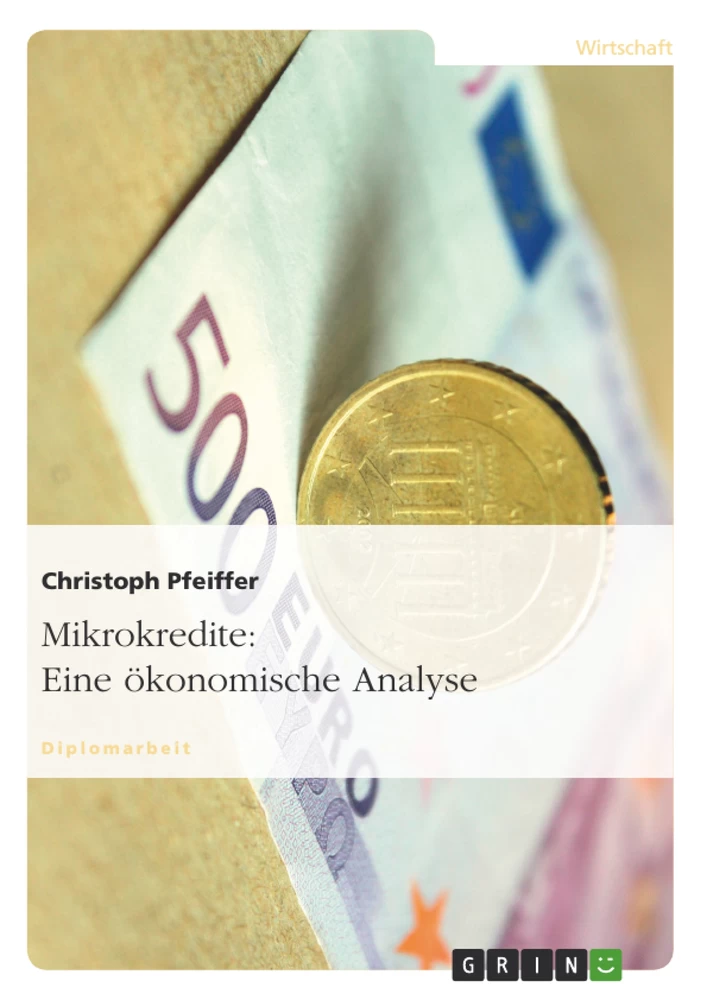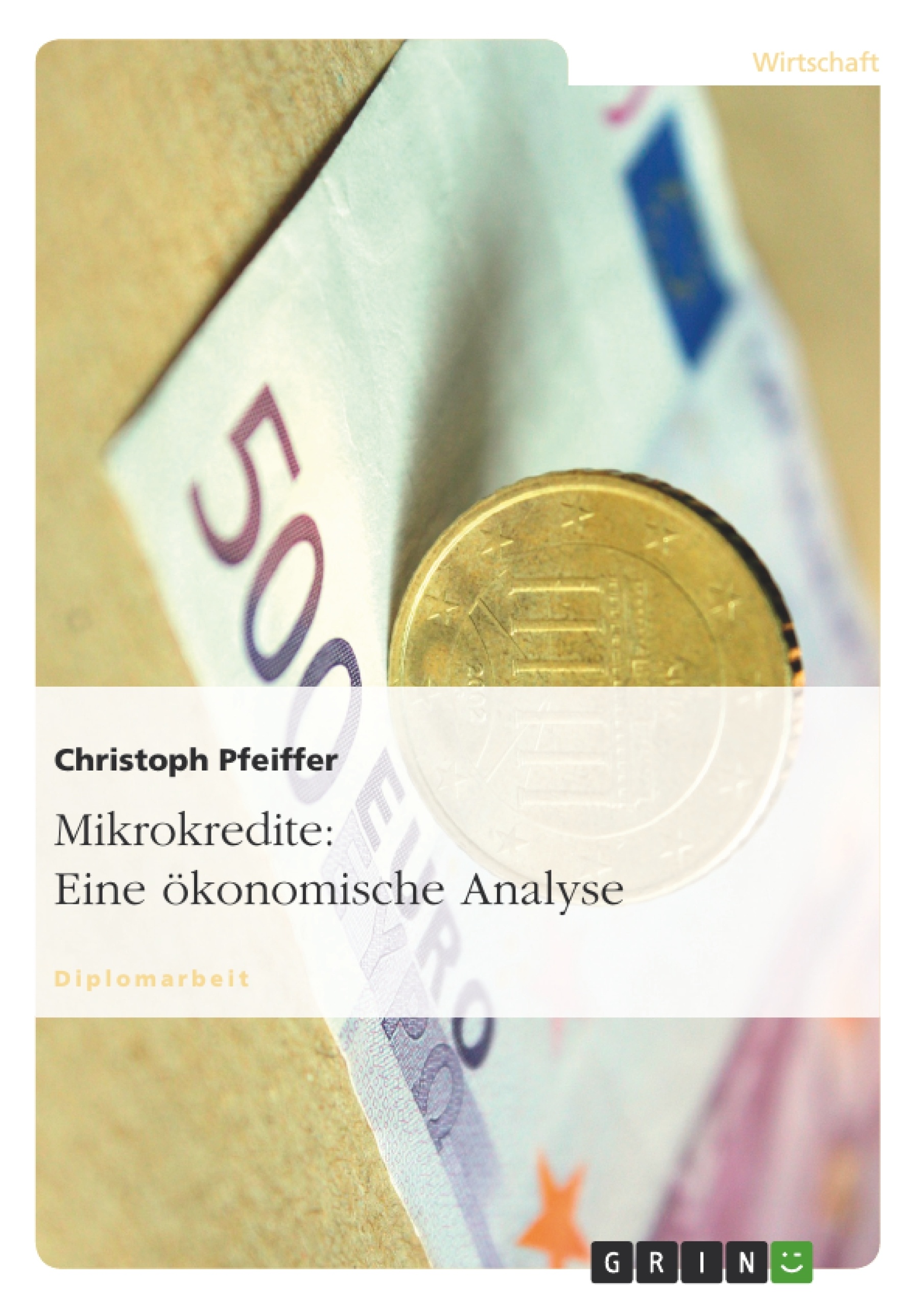„Warum fließt Kapital nicht von allein von reichen zu armen Ländern?“ fragt Lucas in einem vielbeachteten Aufsatz. Die neoklassische Wachstumstheorie besagt, dass ein Land mit geringer Kapitalausstattung auf Grund höherer Grenzproduktivität eine höhere Kapitalverzinsung aufweisen und so mehr Kapital anziehen müsste. Dies hätte eigentlich zu einem massiven Kapitaltransfer von reichen in arme Ländern führen müssen, was in der Realität jedoch nicht einmal ansatzweise beobachtet werden konnte. Selbst in der heutigen Zeit von starkem Aufholwachstum vieler ehemaliger Entwicklungsländer hat sich dieses Phänomen noch verschärft. Anscheinend fließt Kapital sogar besonders aus schnell wachsenden Entwicklungsländern und eher in langsam wachsende:
„The paradox of international capital flows is worse than Lucas had imagined!“
Überträgt man den Gedanken auf die Kreditnehmerebene, lautet die Frage: „Warum
fließt Kapital nicht von reichen zu armen Menschen?“ Aufgrund ihrer geringeren Kapitalausstattung müssten Menschen mit wenig Kapital über eine höheres Kapitalgrenzprodukt verfügen und damit mehr Kapital anziehen.
Das Paradigma asymmetrischer Information liefert einen wichtigen Erklärungsansatz für
die Unvollkommenheiten des Kreditmarkts. Nach einer kurzen Erläuterung des Principal-
Agent-Modells, werden die wichtigsten Probleme der Kreditvergabe in Abschnitt 3 anhand verschiedener Modelle dargestellt. Während diese Probleme in Industrieländern weitestgehend gelöst sind, stellen sie Kreditnachfrager und -anbieter in Entwicklungsländern vor erhebliche Schwierigkeiten. Insbesondere trifft dies auf die besitzlosen, unteren Einkommensschichten zu. Segmentierungen zwischen formellem und informellem Sektor prägen bis heute weite Teile der Kreditmärkte in Entwicklungsländern. Ärmere Individuen haben hier oftmals keinen Zugang zum formellen Kreditmarkt und sind deshalb auf informelle Kreditgeber angewiesen, die vergleichsweise hohe Zinsen erheben und sich bei der Kundenauswahl außerdem sehr selektiv verhalten.
Die Zustände in den Kreditmärkten der Entwicklungsländer bewegten die Politik dazu,
subventionierte Kreditprogramme zu initiieren, deren Ziel vornehmlich darin bestand,
Kredite mit günstigen Zinsen anzubieten.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- I Ineffizienzen des Kreditmarkts
- 2 Das Principal-Agent-Modell
- 3 Principal-Agent Probleme im Kreditmarkt
- 3.1 Adverse Selektion
- 3.1.1 Unterinvestition
- 3.1.2 Überinvestition
- 3.1.3 Kreditrationierungen
- 3.2 Moral Hazard
- 3.2.1 Ex-ante Moral Hazard
- 3.2.2 Ex-post Moral Hazard
- 3.2.3 Kreditrationierungen
- 4 Standardlösungen und Grenzen ihrer Anwendung in Entwicklungsländern
- 4.1 Informationssysteme
- 4.2 Kreditbesicherungen
- 4.2.1 Pfand
- 4.2.2 Bürgschaft
- 4.3 Folgen für die Kreditmärkte in Entwicklungsländern
- II Mikrokredite
- 5 Entwicklung der Mikrokredite
- 5.1 Die Anfänge
- 5.2 Mikrokredite erster Generation
- 5.2.1 Ausgangspunkt
- 5.2.2 Programme und Resultate
- 5.3 Die Mikrokreditrevolution
- 6 Gruppenkredite
- 6.1 Lösung des adversen Selektionsproblems
- 6.1.1 Eigenschaften der Individuen sind untereinander bekannt
- 6.1.2 Eigenschaften der Individuen sind private Information
- 6.2 Lösung des Moral Hazard Problems
- 6.2.1 Projektwahl
- 6.2.2 Anstrengung
- 6.2.3 Durchsetzung
- 7 Jenseits von Gruppenkrediten
- 7.1 Dynamische Initiativen
- 7.2 Hochfrequentige Rückzahlungspläne
- 7.3 Cross-Reporting
- 7.4 Weitere Aspekte
- 7.4.1 Kreditvergabe überwiegend an Frauen
- 7.4.2 Flexible Handhabung von Kreditbesicherungen
- 7.4.3 Der Microloan Officer
- III Eine kritische Bilanz
- 8 Gruppenkredite
- 8.1 Individuelle Kreditvergabe versus Gruppenkredite
- 8.2 Einfluss von sozialen Bindungen innerhalb der Gruppe
- 9 Zur Wirkamkeit von Mikrokreditprogrammen
- 10 Subventionen: Zielkonflikte und Trade-offs
- 10.1 Poverty Lending versus Financial Systems
- 10.2 Finanzielle Unabhängigkeit?
- 10.3 Trade-off von Profitabilität und Armutsbekämpfung
- 10.4 Kosten-Nutzen-Analysen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die ökonomischen Aspekte von Mikrokrediten, die als ein Instrument zur Bekämpfung von Armut in Entwicklungsländern diskutiert werden. Ziel ist es, die Effektivität und die Grenzen von Mikrokreditprogrammen in einem ökonomischen Rahmen zu untersuchen.
- Ineffizienzen des Kreditmarkts
- Principal-Agent-Problematik im Kontext von Kreditvergabe
- Entwicklung und Funktionsweise von Mikrokreditprogrammen
- Kritische Analyse der Effektivität von Mikrokrediten
- Diskussion von Subventionen und Trade-offs bei Mikrokreditprogrammen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema ein und beleuchtet die Ineffizienzen des Kreditmarkts, insbesondere in Entwicklungsländern, die durch die Principal-Agent-Problematik entstehen. Kapitel 2 erläutert das allgemeine Principal-Agent-Modell. Kapitel 3 untersucht die Auswirkungen von adverser Selektion und Moral Hazard auf den Kreditmarkt, wobei insbesondere die Probleme der Unter- und Überinvestition sowie Kreditrationierungen thematisiert werden. Kapitel 4 widmet sich Standardlösungen zur Überwindung dieser Ineffizienzen und analysiert ihre Anwendbarkeit in Entwicklungsländern. Kapitel 5 bietet einen Überblick über die Entwicklung der Mikrokredite, von den Anfängen bis zur "Mikrokreditrevolution". In Kapitel 6 werden Gruppenkredite als ein Mittel zur Lösung der Principal-Agent-Problematik im Kontext von Mikrokrediten vorgestellt. Kapitel 7 diskutiert verschiedene Ansätze zur Weiterentwicklung von Mikrokreditprogrammen, die über Gruppenkredite hinausgehen.
Schlüsselwörter
Mikrokredite, Entwicklungsländer, Kreditmarkt, Principal-Agent-Problem, Adverse Selektion, Moral Hazard, Gruppenkredite, Subventionen, Poverty Lending, Finanzielle Unabhängigkeit, Kosten-Nutzen-Analyse
Häufig gestellte Fragen
Warum haben arme Menschen oft keinen Zugang zu normalen Krediten?
Das Hauptproblem ist die asymmetrische Information. Banken können das Risiko bei besitzlosen Kreditnehmern schwer einschätzen und verlangen oft Sicherheiten (Pfand), die arme Menschen nicht leisten können. Dies führt zu Kreditrationierungen.
Was ist ein Gruppenkredit bei Mikrokrediten?
Bei Gruppenkrediten haften mehrere Kreditnehmer gemeinsam füreinander. Wenn ein Mitglied nicht zahlt, erhalten die anderen keine weiteren Kredite mehr. Dies nutzt den sozialen Druck innerhalb der Gemeinschaft, um Rückzahlungen zu sichern.
Wie lösen Mikrokredite das Problem des "Moral Hazard"?
Moral Hazard (riskantes Verhalten nach Kreditvergabe) wird durch soziale Überwachung in der Gruppe und durch dynamische Anreize (steigende Kreditbeträge bei pünktlicher Rückzahlung) minimiert.
Warum werden Mikrokredite bevorzugt an Frauen vergeben?
Studien zeigen, dass Frauen oft eine höhere Rückzahlungsdisziplin haben und Kredite eher für das Wohl der Familie (Ernährung, Bildung der Kinder) einsetzen, was die Armutsbekämpfung effektiver macht.
Gibt es Kritik an Mikrokreditprogrammen?
Ja, Kritiker weisen auf die oft sehr hohen Zinsen und den enormen sozialen Druck in den Gruppen hin. Zudem gibt es einen Zielkonflikt zwischen der finanziellen Unabhängigkeit der Institute und der tatsächlichen Erreichung der ärmsten Bevölkerungsschichten.
Was ist das "Lucas-Paradoxon"?
Es beschreibt das Phänomen, dass Kapital entgegen der ökonomischen Theorie nicht automatisch von reichen in arme Länder fließt, obwohl dort aufgrund der geringen Kapitalausstattung eigentlich höhere Renditen zu erwarten wären.
- Quote paper
- Christoph Pfeiffer (Author), 2007, Mikrokredite: Eine ökonomische Analyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88740