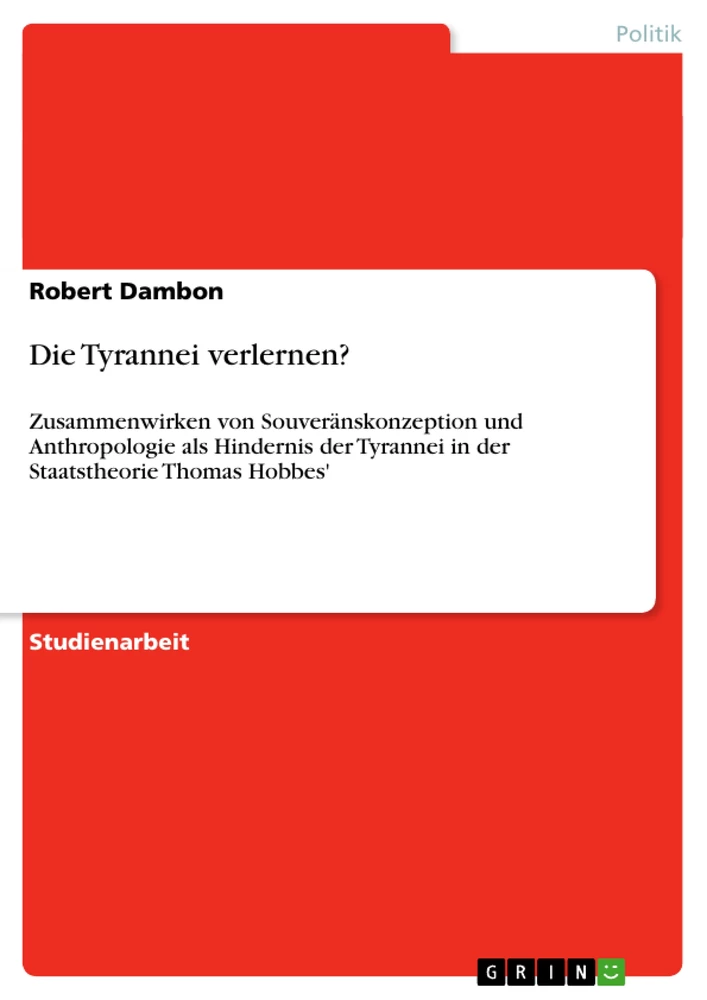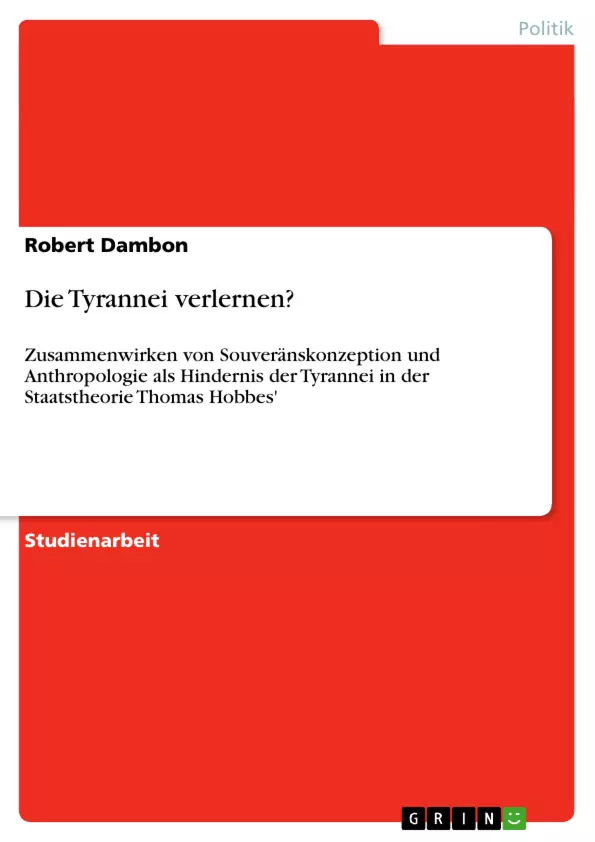„Als ob die Menschen, als sie den Naturzustand verließen und sich zu einer Gesellschaft vereinigten, übereingekommen wären, daß alle, mit Ausnahme eines einzigen, unter dem Zwang von Gesetzen stehen, dieser eine aber alle Freiheiten des Naturzustandes behalten sollte, die sogar noch durch Gewalt vermehrt und durch Straflosigkeit zügellos gemacht wurde! Das heißt die Menschen für solche Narren zu halten, daß sie sich zwar bemühen, den Schaden zu verhüten, der ihnen durch Marder und Füchse entstehen kann, aber glücklich sind, ja, es für Sicherheit halten, von Löwen verschlungen zu werden.“
Wie hier auch der berühmte englische Philosoph John Locke, so wird häufig die an sich uneingeschränkte Machtfülle des „Besitzer[s] der höchsten Gewalt“ in Thomas Hobbes' Leviathan kritisiert. Zumal, eingedenk seines äußerst egoistischen Menschenbildes, scheint die Furcht, der hobbessche Staat sei eine despotische Tyrannei sui generis, in der der „Oberherr“ seine Macht in hemmungsloser Willkür gegen seine Untertanen richten kann, nicht unbegründet.
Es soll daher in dieser Arbeit untersucht werden, welche Bedingungen für Thomas Hobbes einen tyrannischen Machtmissbrauch des „Oberherrn“, d.h. eine gewalttätige und selbstsüchtige Herrschaft zum Schaden der Allgemeinheit, in einem solchen Staat verhindern. Es scheinen hier zwei Hypothesen grundsätzlich von Interesse zu sein. Zum einen hätte Hobbes wohl selbst – obgleich er den Begriff der Tyrannei als Charakteristikum eines Herrschaftsstils explizit ablehnt – entgegnet, dass „selbst die größten Unannehmlichkeiten bei jeder Staatsverfassung dann kaum merklich werden, wenn man sie mit dem Elend des Krieges vergleicht“ . Zum anderen – und nur dies soll im Folgenden bearbeitet werden – könnte das Zusammenwirken der Konzeption des „Souveräns“ als „übriggebliebene[r] Naturzustandsbewohner[]“ und der hobbesschen Anthropologie selbst, der ebenso der „Oberherr“ unterliegt, als eigentlicher Schutz vor tyrannischem Machtmissbrauch betrachtet werden.
Zur Klärung dieses Untersuchungsgegenstandes werden im Folgenden daher zuerst die anthropologischen Prämissen untersucht, d.h., welche Wesenszüge bedingen das menschliche Handeln. Hierbei sind insbesondere das „natürliche Gesetz“ , welches Hobbes als eine von der Vernunft gebotene allgemeine Regel begreift, die Vernunft selbst und die menschlichen Leidenschaften gemeint.
Im Anschluss daran soll die Beschaffenheit der „höchsten Gewalt“ herausgearbeitet werden.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DIE ANTHROPOLOGISCHEN PRÄMISSEN HOBBES'
- DIE KONZEPTION DES „OBERHERRN“
- DIE ERRICHTUNG DER „HÖCHSTEN GEWALT“
- DIE RECHTE UND PFLICHTEN DES OBERHERRN
- DAS ZUSAMMENWIRKEN VON SOUVERÄNSKONZEPTION UND ANTHROPOLOGIE ALS HEMMNIS DER TYRANNIS
- ZUSAMMENFASSUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Bedingungen, die in Thomas Hobbes' Staatstheorie einen tyrannischen Machtmissbrauch des „Oberherrn“ verhindern. Sie analysiert, wie das Zusammenwirken der Konzeption des „Souveräns“ und der hobbesschen Anthropologie als Schutz vor tyrannischem Machtmissbrauch dienen kann.
- Die anthropologischen Prämissen Hobbes', insbesondere das „natürliche Gesetz“, die Vernunft und die menschlichen Leidenschaften
- Die Gründung der „höchsten Gewalt“ und die daraus resultierenden Rechte und Pflichten des Oberherrn
- Das Zusammenspiel von anthropologischen und souveränitätsbezogenen Prämissen
- Das Wesen der Tyrannei und die Möglichkeiten ihrer Vermeidung in Hobbes' Staatsphilosophie
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Problemstellung der Arbeit vor und skizziert die Forschungsfrage: Wie kann in Hobbes' Staatsphilosophie ein tyrannischer Machtmissbrauch verhindert werden? Sie beleuchtet die Kritik an der uneingeschränkten Macht des „Oberherrn“ und die Bedeutung des Zusammenspiels von Souveränskonzeption und Anthropologie für die Verhinderung von Tyrannei.
- Kapitel 2 widmet sich den anthropologischen Prämissen Hobbes'. Es werden die Wesenszüge des menschlichen Handelns im Naturzustand untersucht, insbesondere das „natürliche Gesetz“, die Vernunft und die menschlichen Leidenschaften. Die Kapitel befasst sich mit der Bedeutung der Erfahrung, Vernunft und Leidenschaften für das menschliche Verhalten im Naturzustand.
- Kapitel 3 beleuchtet die Konzeption des „Oberherrn“ in Hobbes' Staatsphilosophie. Es werden die Gründung der „höchsten Gewalt“ und die daraus resultierenden Rechte und Pflichten des Oberherrn analysiert. Das Kapitel behandelt die Entstehung der „höchsten Gewalt“ sowie die damit verbundenen Rechte und Pflichten des „Souveräns“.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit der Staatsphilosophie von Thomas Hobbes, insbesondere mit seiner Konzeption des „Oberherrn“, der Anthropologie des Naturzustands und dem Schutz vor Tyrannei. Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Naturzustand, Souverän, „höchste Gewalt“, „Oberherr“, Tyrannei, Vernunft, Leidenschaften, natürliche Gesetze.
- Citar trabajo
- Robert Dambon (Autor), 2007, Die Tyrannei verlernen?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88953