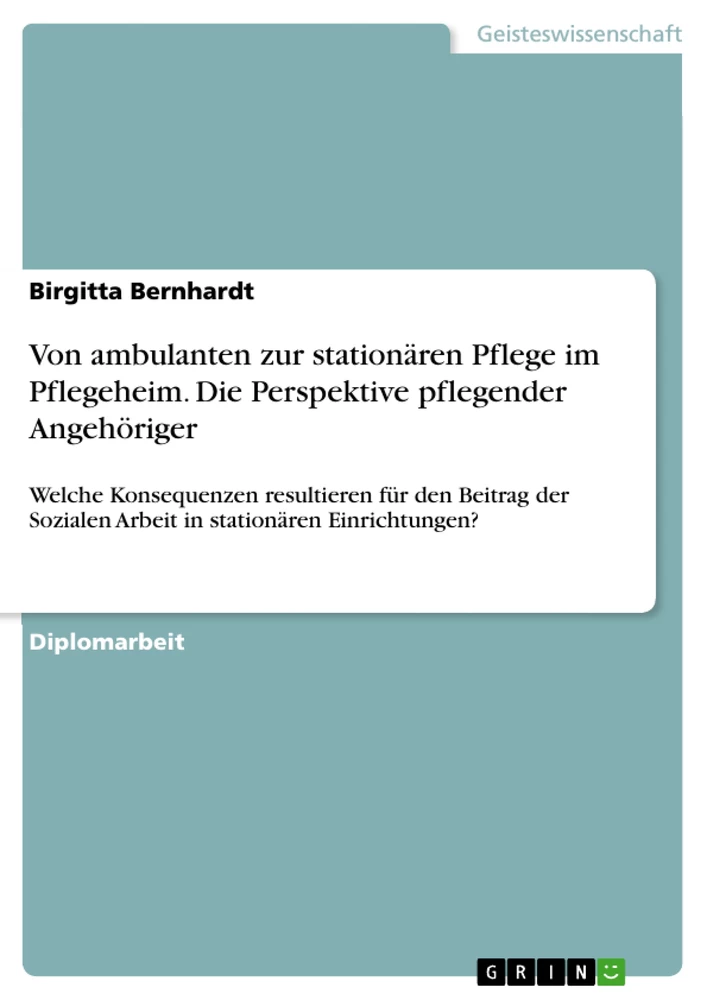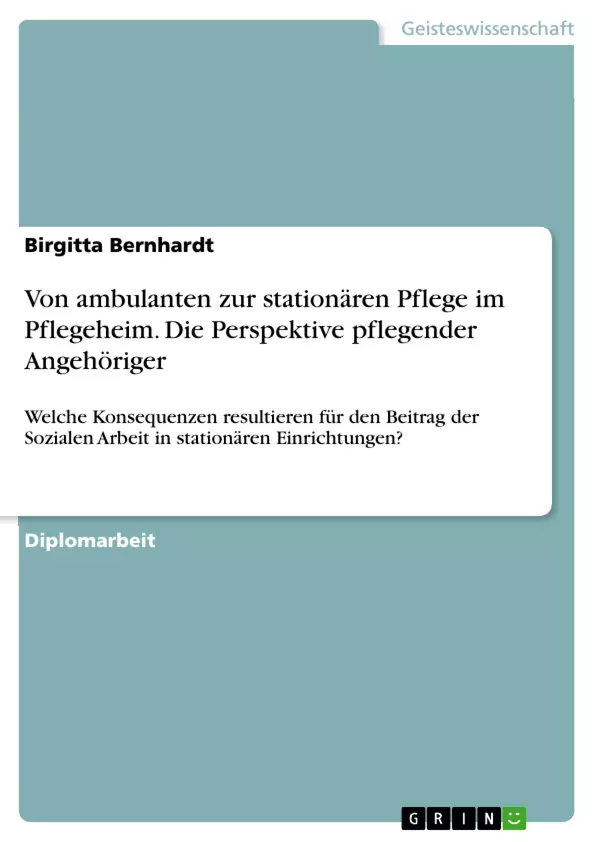„Ambulant vor stationär“ - so lautet eines der Grundprinzipien der 1995 als fünfte Säule des Sozialversicherungssystems eingeführten Pflegeversicherung. Unter diesem Leitsatz werden verschiedene Instrumente zur Förderung ambulanter Versorgungskonzepte subsumiert. Der mit der aktuellen Altersentwicklung verbundene Anstieg von Multimorbidität und demenziellen Erkrankungsbildern wird inzwischen von zahlreichen Teilsystemen der Gesellschaft als eine der größten Herausforderungen für die kommenden Jahrzehnte realisiert. Dabei hat sich im Diskurs um die Versorgung der wachsenden Anzahl alter und hochaltriger pflegebedürftiger Menschen eine deutliche Stärkung ambulanter Strukturen durchgesetzt.
Ein Motiv für die Präferenz ambulanter Konzepte ist die Suche nach Lösungen für den steigenden Kostendruck, der aus der rasanten Zunahme der Lebenslage „Pflegebedürftigkeit“ resultiert. Dabei wird seitens der Entscheidungsträger der Institution „Familie“ als Ressource für häusliche Versorgung und Betreuungsleistungen die größte Bedeutung zugeschrieben. Familienangehörige sind innerhalb der Pflegelandschaft nach wie vor die wichtigsten Leistungserbringer. Trotz sich wandelnder Familienstrukturen und veränderten weiblichen Erwerbsbiografien steigt infolge des demografischen Trends die absolute Anzahl der häuslichen Pflegearrangements seit Jahren kontinuierlich an.
Oftmals investieren Angehörige über Jahre hinweg ein enormes Maß an Zeit, Kraft und Energie für die Versorgung des Pflegebedürftigen. Eigene Bedürfnisse und Interessen werden nur noch reduziert bzw. gar nicht mehr gelebt und die Sorge um den Pflegebedürftigen kann sich zum alltagsbestimmenden Thema entwickeln.
Bisweilen kann die Diskrepanz zwischen Pflegeaufwand und eigenen Ressourcen für pflegende Angehörige so groß werden, dass trotz Ausschöpfung ambulanter Hilfsangebote ein Umzug des Pflegebedürftigen in eine vollstationäre Einrichtung als Lösungsoption angebracht erscheint.
Die forschungsleitende Frage in der vorliegenden Diplomarbeit ist die Frage nach der Erlebensperspektive der pflegenden Angehörigen bei der Umstellung eines ambulanten auf ein stationäres Pflegesetting sowie nach den Konsequenzen, die sich daraus für den Auftrag der Sozialen Arbeit in stationären Einrichtungen ergeben.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- TEIL I ,,DIE FAMILIE IST DER GRÖẞTE PFLEGEDIENST DER NATION“ – WER SIND DIE LEISTUNGSERBRINGER HÄUSLICHER ALTEN- UND KRANKENPFLEGE UND WEN PFLEGEN SIE?
- ,,Pflegende Angehörige“
- Begriffsklärung
- Profil der Pflegenden
- ,,Pflegebedürftige“
- Begriffsklärung
- Profil der Pflegebedüftigen
- TEIL II ANLAGE UND METHODIK DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG
- Fragestellung
- Forschungsdesign: Einzelfallanalyse
- Feldzugang
- Datenerhebung: Leitfadengestütztes, problemzentriertes Interview
- Leitfaden
- Datenauswertung: Qualitative Inhaltsanalyse auf der Basis der kommentierten Transkription
- Darstellung der Interviewergebnisse
- TEIL III DER UMZUG DES PFLEGEBEDÜRFTIGEN INS PFLEGEHEIM IM SPANNUNGSFELD ZWISCHEN VERLUSTERFAHRUNG UND CHANCE: ERFAHRUNGEN VON PFLEGENDEN ANGEHÖRIGEN DARSTELLUNG DER UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE
- Die Lebenswirklichkeit pflegender Angehöriger in häuslichen Pflegearrangements
- Pflegealltag, Belastungserleben
- Erfahrungen aus der Alltagssituation pflegender Angehöriger
- Belastungserleben im Zusammenhang mit der häuslichen Pflegesituation
- Gesundheitliche Situation
- Finanzielle Situation
- Soziale Situation
- Psychische Situation
- Positive Aspekte der Pflege
- Entlastende Faktoren innerhalb der häuslichen Pflegesituation
- Nutzung von professionellen Unterstützungs- und Hilfsangeboten
- Informelle Entlastungfaktoren und Ressourcen
- Motive für die Betreuungsübernahme und Pflege
- Sozial-normative Verpflichtung
- Emotionale Bindung
- Mangelnde Alternativen
- Materielle Motive
- Familiärer Druck
- Sinnstiftung und Glaubensüberzeugung
- Beziehungsqualität innerhalb der häuslichen Pflegesituation
- Beziehungsqualität zwischen Pflegenden und Pflegebedürftigen
- Beziehungsqualität innerhalb des Familiensystems
- Zusammenfassung
- Entscheidung für das Pflegeheim als adäquate Versorgungsform
- Beweggründe für die Beendigung der häuslichen Versorgung
- Akteure des Entscheidungsprozesses
- Pflegebedürftige
- Soziales Umfeld
- Hausärzte
- Nichtmedizinische professionelle Beratungsinstanzen
- Emotionen im Zusammenhang mit der Entscheidungsfindung
- Gefühle bei den Angehörigen
- Verdrängung
- Trauer
- Schuldgefühle
- Kontrollverlust und Hilflosigkeit
- Versagensgefühle
- Druck
- Unsicherheit/Zweifel
- Hoffnung auf Entlastung
- Gefühle bei den Pflegebedürftigen
- Gründe für die Auswahl der konkreten Einrichtung
- Alternative Lösungsoptionen
- Zusammenfassung
- Umstellungsphase von der häuslichen Pflege auf die stationäre Versorgung
- Aufnahmesituation
- Ansprechpartner beim Einzug
- Subjektives Erleben des Einzugstags
- Atmosphäre und Emotionen beim Umzug
- Entlastende Faktoren am Einzugstag
- Umstellungsphase und Neuorientierung des Pflegenden Angehörigen
- Emotionen in der ersten Zeit nach Beendigung der häuslichen Pflegesituation
- Integration des Pflegebedürftigen ins Heim
- Entlastende Faktoren und Unterstützung während der Umstellungsphase
- Zusammenfassung
- Die stationäre Einrichtung als Teil der Lebenswirklichkeit pflegender Angehöriger
- Konsequenzen des Umzugs ins Pflegeheim für das Alltagserleben des Pflegenden Angehörigen
- Kontakt zum Pflegebedürftigen – Besuchsgewohnheiten
- Emotionen im Zusammenhang mit aktueller Pflegesituation
- Entlastung in der aktuellen Lebenssituation
- Beziehungsqualität pflegender Angehöriger/Pflegebedürftiger im Kontext der stationären Versorgung
- Kontakt und Beziehungsqualität pflegender Angehöriger - Mitarbeiter im Heim/Integration des Pflegenden Angehörigen in den Wohnbereichsalltag
- Zufriedenheit mit Pflegequalität und Atmosphäre in der Einrichtung
- Kommunikation und Beziehungsqualität mit Mitarbeitern
- Integration in den Wohnbereichsalltag und Übernahme von Aufgaben
- Partizipationsmöglichkeiten für Angehörige
- Bereitstellung von Angeboten für Angehörige und deren Nutzung
- Mitbestimmungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten für Angehörige
- Kontakt zum Sozialdienst und Inanspruchnahme entsprechender Angebote
- Ideen, Visionen, Anregungen
- Zusammenfassung
- TEIL IV ANGEHÖRIGENARBEIT ALS AUFTRAG DER SOZIALEN ARBEIT IN PFLEGEHEIMEN
- Verortung der Sozialen Arbeit innerhalb der Angehörigenarbeit
- Ziele und Handlungsangebote des Sozialdienstes in der Angehörigenarbeit als Konsequenz aus der Untersuchung
- SCHLUSSFOLGERUNGEN UND AUSBLICK
- Die Herausforderungen und Belastungen pflegender Angehöriger im Kontext der häuslichen Pflege
- Die Faktoren, die zur Entscheidung für die stationäre Pflege führen
- Die Erfahrungen und Emotionen der Angehörigen während des Umzugs und der Integration des Pflegebedürftigen ins Heim
- Die Rolle und Bedeutung der Sozialen Arbeit in Pflegeheimen im Hinblick auf die Unterstützung pflegender Angehöriger
- Die Entwicklung von Handlungsangeboten und Strategien zur Stärkung der Angehörigenarbeit in stationären Einrichtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Statuspassage „Eintritt ins Pflegeheim“ aus der Perspektive pflegender Angehöriger. Im Mittelpunkt steht die Frage, welche Konsequenzen sich für den Auftrag der Sozialen Arbeit in stationären Einrichtungen aus diesem kritischen Lebensereignis ergeben. Die Arbeit zielt darauf ab, die Erfahrungen pflegender Angehöriger während des Übergangs von der häuslichen zur stationären Pflege zu analysieren und daraus Handlungsempfehlungen für die Soziale Arbeit in Pflegeheimen abzuleiten.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, in der der aktuelle Stand der Diskussion um die Bedeutung der Familie als „größtem Pflegedienst der Nation“ und die Herausforderungen der häuslichen Pflege beleuchtet werden. Der erste Teil der Arbeit widmet sich der Definition und dem Profil von pflegenden Angehörigen sowie von Pflegebedürftigen. Im zweiten Teil wird die Methodik der empirischen Untersuchung vorgestellt, die auf einer Einzelfallanalyse und leitfadengestützten Interviews basiert.
Der dritte Teil stellt die Ergebnisse der empirischen Untersuchung dar. Er beleuchtet die Lebenswirklichkeit pflegender Angehöriger in häuslichen Pflegearrangements, die Belastungen und Entlastungsfaktoren, die Motive für die Betreuungsübernahme und die Beziehungsqualität innerhalb der häuslichen Pflegesituation. Der dritte Teil analysiert außerdem die Entscheidungsfindung für das Pflegeheim als adäquate Versorgungsform, die Beweggründe für die Beendigung der häuslichen Versorgung, die Akteure des Entscheidungsprozesses und die Emotionen im Zusammenhang mit der Entscheidungsfindung.
Der dritte Teil beschreibt außerdem die Umstellungsphase von der häuslichen Pflege auf die stationäre Versorgung, die Aufnahmesituation, das subjektive Erleben des Einzugstags und die Neuorientierung des Pflegenden Angehörigen. Schließlich wird die stationäre Einrichtung als Teil der Lebenswirklichkeit pflegender Angehöriger betrachtet, einschließlich der Konsequenzen des Umzugs für das Alltagserleben, die Beziehungsqualität zwischen Angehörigen und Pflegebedürftigen sowie den Kontakt und die Beziehungsqualität zu den Mitarbeitern im Heim.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen der häuslichen Pflege, pflegenden Angehörigen, Pflegebedürftigen, dem Eintritt ins Pflegeheim, der Statuspassage, den Belastungen und Entlastungsfaktoren pflegender Angehöriger, der Entscheidungsfindung, den Emotionen, der Integration ins Heim, der Beziehungsqualität, der Sozialen Arbeit in Pflegeheimen und der Angehörigenarbeit.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Leitsatz „Ambulant vor stationär“?
Es ist ein Grundprinzip der Pflegeversicherung, das die häusliche Versorgung fördert, um Heimeinzüge so lange wie möglich zu vermeiden.
Warum entscheiden sich Angehörige letztlich für ein Pflegeheim?
Oft führt die Diskrepanz zwischen hohem Pflegeaufwand und den schwindenden eigenen Ressourcen der Angehörigen zu dieser Entscheidung.
Welche Emotionen begleiten den Umzug ins Heim?
Pflegende Angehörige erleben häufig Schuldgefühle, Trauer, Versagensängste, aber auch die Hoffnung auf notwendige Entlastung.
Wie ändert sich die Beziehung nach dem Heimeintritt?
Die Arbeit untersucht, wie sich die Beziehungsqualität zwischen Angehörigen und Pflegebedürftigen im Kontext der stationären Versorgung wandelt.
Welche Aufgabe hat die Soziale Arbeit im Pflegeheim für Angehörige?
Der Sozialdienst unterstützt Angehörige bei der Integration, bietet Beratung in der Umstellungsphase und fördert Partizipationsmöglichkeiten.
- Citar trabajo
- Birgitta Bernhardt (Autor), 2007, Von ambulanten zur stationären Pflege im Pflegeheim. Die Perspektive pflegender Angehöriger, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88964