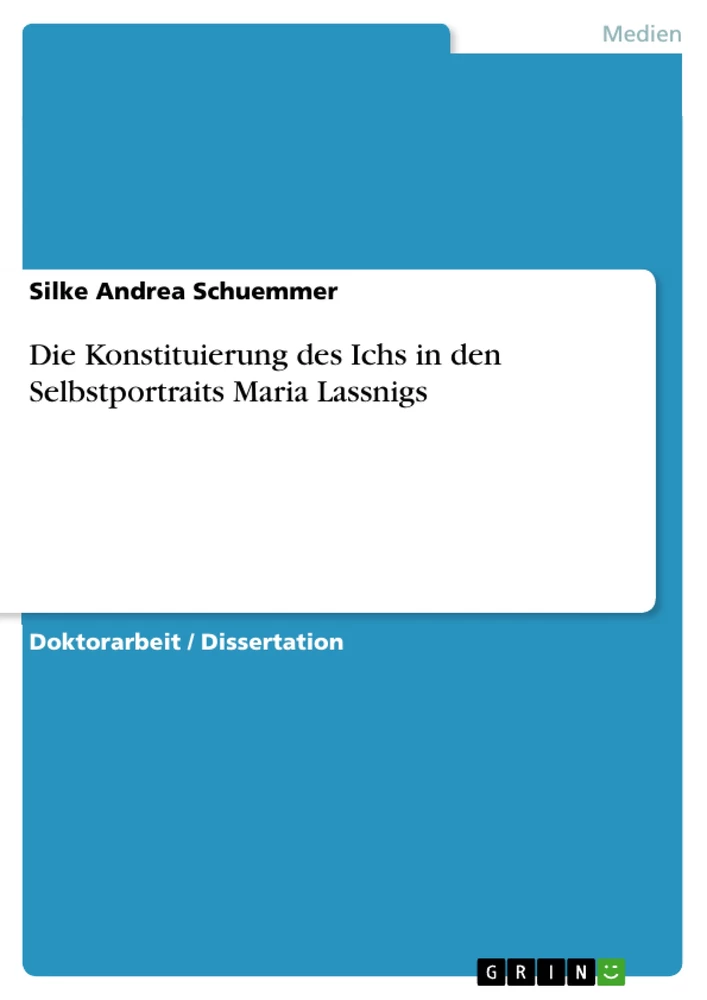Die vor allem im Selbstportrait über Jahrzehnte stattfindende künstlerische Beschäftigung mit dem eigenen Inneren ist von InterpretInnen immer wieder als ‚Innerer Monolog’ bezeichnet worden.
Dieser literaturwissenschaftliche Begriff umschreibt eine literarische Technik, mittels derer Gefühle und Gedanken in scheinbar unmittelbarer Übertragung mitgeteilt werden. Dahinter steht, so hat sich gezeigt, die Vorstellung, daß das Selbstportrait ein Forum für den Künstler/ die Künstlerin darstellt, mit sich selbst ins Gespräch zu treten und in einem introspektiven Akt der Selbsterkenntnis malerisch das eigene Innere kennenzulernen. Das wiederum impliziert aber die Annahme, daß ein Selbstportrait ein authentisches Zeugnis ist.
Anhand zahlreicher Selbstportraits der österreichischen Malerin Maria Lassnig (*1919), wird ihre Darstellung innerer Prozesse analysiert und ihr Konzept der ‚body-awareness’ am Werk nachvollzogen. Zu diesem Zweck wird eine Katalogisierung der Bildnisse vorgenommen und diese interpretiert, da dies bislang in der Forschung vernachlässigt wurde. Zur ikonographischen Einordnung werden die Thesen Gustav René Hockes zum Manierismus als epochenübergreifendem Phänomen auf das Werk Lassnigs bezogen. Ein Überblick über das Selbstportrait als Gattung versucht eine Einordnung Maria Lassnigs.
Lassnigs großes Thema, die Darstellung von Körpergefühlen, greift einen zentralen Diskurs des 20. Jahrhunderts auf. In Lassnigs Werk verbindet sich dieser Diskurs mit der Erkenntnis, daß sich Identität vornehmlich über den Körper, seine biologischen und sozialen Faktoren, seine Geschichte und seine Befindlichkeiten konstituiert. Um die theoretischen Hintergründe transparent zu machen, wird der Körper als Ausdruck bzw. Ursache der eigenen Identität untersucht. Einem chronologischen Abschnitt über die Verbindung von Leib und Seele folgt eine Zusammenfassung der Hauptaspekte des Körperdiskurses: Die Verschmelzung von Mensch und Technik, die feministischen Ansätze des Körperdiskurses und die Angst vor der Zerstückelung des Körpers. Das viel behauptete Verschwinden des Körpers in der modernen Kunst wird widerlegt.
Inhaltsverzeichnis
- ,Innerer Monolog' und,Seele' – Eine Einleitung
- 1. Teil: MARIA LASSNIG
- Maulkorb, Zyklopin und Schinken – Fünf Bildbeschreibungen
- Tachistisches Selbstportrait (1961)
- Pfingstselbstportrait (1969)
- Selbstportrait mit Maulkorb (1973)
- Country Selbstportrait (1993)
- Selbstportrait als Einäugige (1998)
- ,,Meine literarische Ader“ – Über die Titel
- Die realste Realität – Zur Darstellung von Körpergefühlen
- Durch den Körper gehindert - Die Anfänge
- Body-awareness und Körpersensation - Begriffsdefinitionen
- Capriccios oder quälende Selbstanalyse - Deformationen
- Vom Abstecken einer Wolke - Außenansicht versus Innenperspektive
- Zutiefst dem Unbewußten zugeordnet – Körperempfindungen statt Emotionen
- Das meta-künstlerische Paradigma - Katalogisierung
- Der Nullpunkt des Sehraumes – Körperbilder ohne Spiegel
- Psychogramme innerer Vorstellung – Die informellen Arbeiten
- Zitrone sein - Die Verschmelzung mit Gegenständen
- Unter der Erde – Die Verschmelzung mit der Natur
- Beim Einbruch des Unerklärlichen – die Verschmelzung mit Abstraktem
- Sinnlich empfundene Körper - Extensionen
- Gurkenglas und Stab – Die Verwendung von Gegenständen
- Einmal von außen und einmal von innen – Die Verdopplungen
- Mysteriöse Wesen - Die Verbindung von Mensch und Tier
- Meistens erkennen mich die Leute aber trotzdem - Veränderte Anatomie
- Mythologie wider Willen – Über mythologische Assoziationen
- Anekdoten und Narration – Über die szenischen Bilder
- Eine grelle Stimme seelischer Konflikte – Über die Gestik
- Bis in die Nervenbahnen - Die Abstraktion
- Der Körper in fahler Farbe – Bildübergreifende Beobachtungen
- Ein weicher Ballon im Mundraum – Über die offenen Münder
- Fleischdeckungsfarben und Nervenstrangfarben
- Die Gestalt als Räumlichkeit – Über den unbestimmten Hintergrund
- Es genügt nicht, nur Auge zu sein - Das innere Sehen
- Ausdruckszwang von historischer Kontinuität: Manierismus
- Ein zeitüberschreitendes Phänomen - Die These Gustav René Hockes
- Epigonal, psychopathisch und steril - Der historische Manierismus
- Eine subjektive Phantasiekunst – Versuch einer Definition
- Spiegel, Uhren, Einhörner und Labyrinthe - Beliebte Motive
- Der Sinnenschock - Stilistische Eigenschaften
- Katachresen und biomorphe Landschaften - Arcimboldo
- Neo-Manierismus, Surrealismus, Meditation – Der Bezug zur Moderne
- Die Verlegung des Blickpunktes nach innen – Maria Lassnig und Manierismus
- Ähnliche Parameter – Über Francis Bacon
- Der Weg zur dominanten Gattung – Über das Selbstportrait
- Handschriften und Abbild – Einleitung
- Das Klischee der Selbstdarstellung - Spiegelexkurs
- Sündenerlaẞ, Signatur und Ventil - Das Mittelalter
- Von der assistenza zur Vision des Wesens - Das 15. und 16. Jahrhundert
- Kopfwendung und Pose - Das 17. Jahrhundert
- Urtiefen der Seele - Über Rembrandt
- Iphigeniens Geschwister - Das 18. Jahrhundert
- Urbanisierung und Innerlichkeit – Das 20. Jahrhundert
- Die Vollendung neuen Menschtums – Das 19. Jahrhundert
- Gehäutete Frauen - Selbstportraits von Künstlerinnen
- Die unrepräsentative Malerin - Malen als Thema im Werk Maria Lassnigs
- Narziẞmus oder,Image' – Erklärungen zum Selbstbildniss
- Inszenierung und Mythenbildung - Schlußüberlegungen
- Die Expedition ins Innere – Über Subjektivität und Wissenschaftlichkeit
- Komisch, daß die Leute das trotzdem geschluckt haben – Die Rezeption
- Maulkorb, Zyklopin und Schinken – Fünf Bildbeschreibungen
- 2. TEIL: THEORETISCHE HINTERGRÜNDE
- Verschwunden, wiedergekehrt, verschwunden - Der Körper-Diskurs
- Die Körperwelle und ein Meer von Meinungen – Allgemeine Einleitung und methodische Probleme
- Ich heute und Ich einst – Kurzer historischer Abriß über das Verhältnis von Körper und Geist
- Baby be my Cyborg - Die Verschmelzung von Mensch und Technik
- Ein Bild unter Bildern – Der feministische Körperdiskurs und die Zerstückelung des Körpers
- Entmaterialisierung und Besessenheit – Das Verschwinden des Körpers in der modernen Kunst
- Nicht nur weiblich - Emotionstheorie
- Der einzige Hauptsinn – Über die Definition von Emotionen
- Ésprits oder Reptiliengehirn - Die Entstehung von Emotionen
- Ozeanische Selbstentgrenzung – Über außergewöhnliche Bewußtseinszustände (ABZ)
- Leibinsel und Ringelwurm - Körperphilosophie
- Ein Gewoge von Leibinseln - Zur Theorie Hermann Schmitz'
- Der Ringelwurm quer der Körperachse - Zur Muskelpanzer-Theorie Wilhelm Reichs
- Erkenne dich selbst - Die Introspektion als Imaginationssteigerung
- Feuergluten, welche die Seele erfassen - Einleitung
- 15 Unzen Brot - Über Jacopo da Pontormo
- Magnetischer Schlaf und état de rêve – Über Surrealismus
- Weder hungrig noch übersatt – Meditation
- Verschwunden, wiedergekehrt, verschwunden - Der Körper-Diskurs
- 3. TEIL: EXKURS
- Die Sprache des Gefühls – Über die Darstellung des Inneren in der Kunst
- Von der allegorischen Figur zur Individualpsychologie – Historischer Abriß
- Der innere Klang - Wassily Kandinsky
- Zur Beförderung der Menschenkenntnis – Physiognomik-Exkurs
- Die Kopfgalerie - Maria Lassnigs Inspiration
- Die Sprache des Gefühls – Über die Darstellung des Inneren in der Kunst
- 4: TEIL: DER, INNERE MONOLOG' IN DER LITERATUR
- Unwetter und Vogelgezwitscher - Zur Darstellung von Innerlichkeit in der Literatur
- In naiver Verstrickung – Die Verinnerlichung der Literatur
- Gilgamesch und Madame Bovary - Die historische Entwicklung
- ,Innerer Monolog',,stream of consciousness' und, erlebte Rede' Zu den Begriffen
- Vom Dämmerhaften bis zur höchsten Reflexion -,stream of consciousness'
- Unhörbare Bewußtseinsinhalte – Die, erlebte Rede'
- Von der Experimentalform zur Konvention – Der, Innere Monolog'
- Weder ErzählerIn noch ZuhörerIn – Über den Verzicht auf Kommentare
- Die ununterbrochene Gedankenkette – Zeit im Inneren Monolog”
- Krise und Existenz - Situationen und Personal
- Kampf oder Anpassung - Das innere Verhältnis zur Gesellschaft
- Die fehlende syntaktische Ordnung – Sprachliche Mittel
- Zyklisch und spiralig – Die Struktur
- Unwetter und Vogelgezwitscher - Zur Darstellung von Innerlichkeit in der Literatur
- 5. Teil: SCHLUSSÜBERLEGUNGEN
- Ordnende Übereinstimmug und gewisser Gleichlauf – Über Analogie und Metapher
- Fehler oder originale Denkform – Die Wissenschaftlichkeit der Verwendung von Analogien
- ,Innerer Monologʻ oder innerer Monolog - Sprechen über Maria Lassnigs Kunst
- ,Innerer Monolog', Introspektion und kreativer Prozeß – Die Kategorien
- Introspektiv kreativer Monolog – Die Schlußthese
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Dissertation untersucht die Konstituierung des Ichs in den Selbstportraits von Maria Lassnig. Sie analysiert die bildnerische Umsetzung von Gefühlen und Empfindungen in Lassnigs Werken und stellt die Frage nach der Übertragbarkeit des literarischen Begriffs des „Inneren Monologs" auf Selbstbildnisse.
- Darstellung der Körpergefühle in den Selbstportraits von Maria Lassnig
- Analyse der Verwendung von „Inneren Monologen" in Lassnigs Kunst
- Bedeutung von Deformationen und Abstraktionen in Lassnigs Selbstbildnissen
- Das Verhältnis von Außenansicht und Innenperspektive in Lassnigs Werk
- Die Rolle des Manierismus in Lassnigs Kunst
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit gliedert sich in fünf Teile. Der erste Teil widmet sich dem Werk Maria Lassnigs und analysiert ihre Selbstportraits anhand von fünf ausgewählten Beispielen. Der zweite Teil befasst sich mit theoretischen Hintergründen, insbesondere mit dem Körperdiskurs und der Emotionstheorie. Der dritte Teil ist ein Exkurs über die Darstellung des Inneren in der Kunst, der von der allegorischen Figur bis zur Individualpsychologie reicht. Der vierte Teil untersucht den „Inneren Monolog" in der Literatur und stellt die historischen Entwicklungen und wichtigsten Begriffsdefinitionen vor. Der fünfte Teil schließlich zieht Schlussfolgerungen aus den vorangegangenen Untersuchungen und analysiert die Beziehung zwischen „Innerem Monolog", Introspektion und kreativem Prozess im Werk von Maria Lassnig.
Die Kapitel behandeln Themen wie die Darstellung von Körpergefühlen, die Verwendung von „Inneren Monologen" in Lassnigs Kunst, die Bedeutung von Deformationen und Abstraktionen in ihren Selbstbildnissen, das Verhältnis von Außenansicht und Innenperspektive in ihrem Werk, die Rolle des Manierismus in ihrer Kunst, sowie verschiedene theoretische Ansätze zum Körper, zur Emotion und zur Kunst.
Die Arbeit untersucht auch die historischen Entwicklungen des Selbstbildnisses, den „Inneren Monolog" in der Literatur sowie die Beziehungen zwischen diesen verschiedenen Bereichen.
Schlüsselwörter
Die Dissertation befasst sich mit Maria Lassnig, Selbstportraits, Körpergefühle, „Innerer Monolog", Manierismus, Körperdiskurs, Emotionstheorie, Kunstgeschichte, Literaturgeschichte, Introspektion, kreativer Prozess, wissenschaftliche Methode.
- Quote paper
- Dr. Silke Andrea Schuemmer (Author), 2002, Die Konstituierung des Ichs in den Selbstportraits Maria Lassnigs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89538