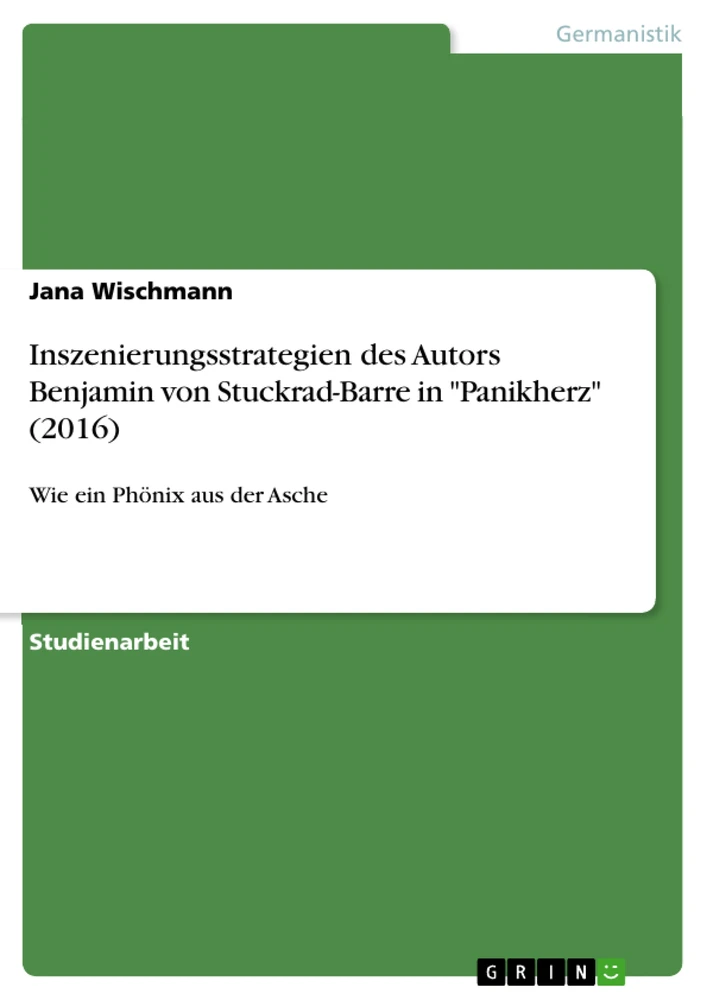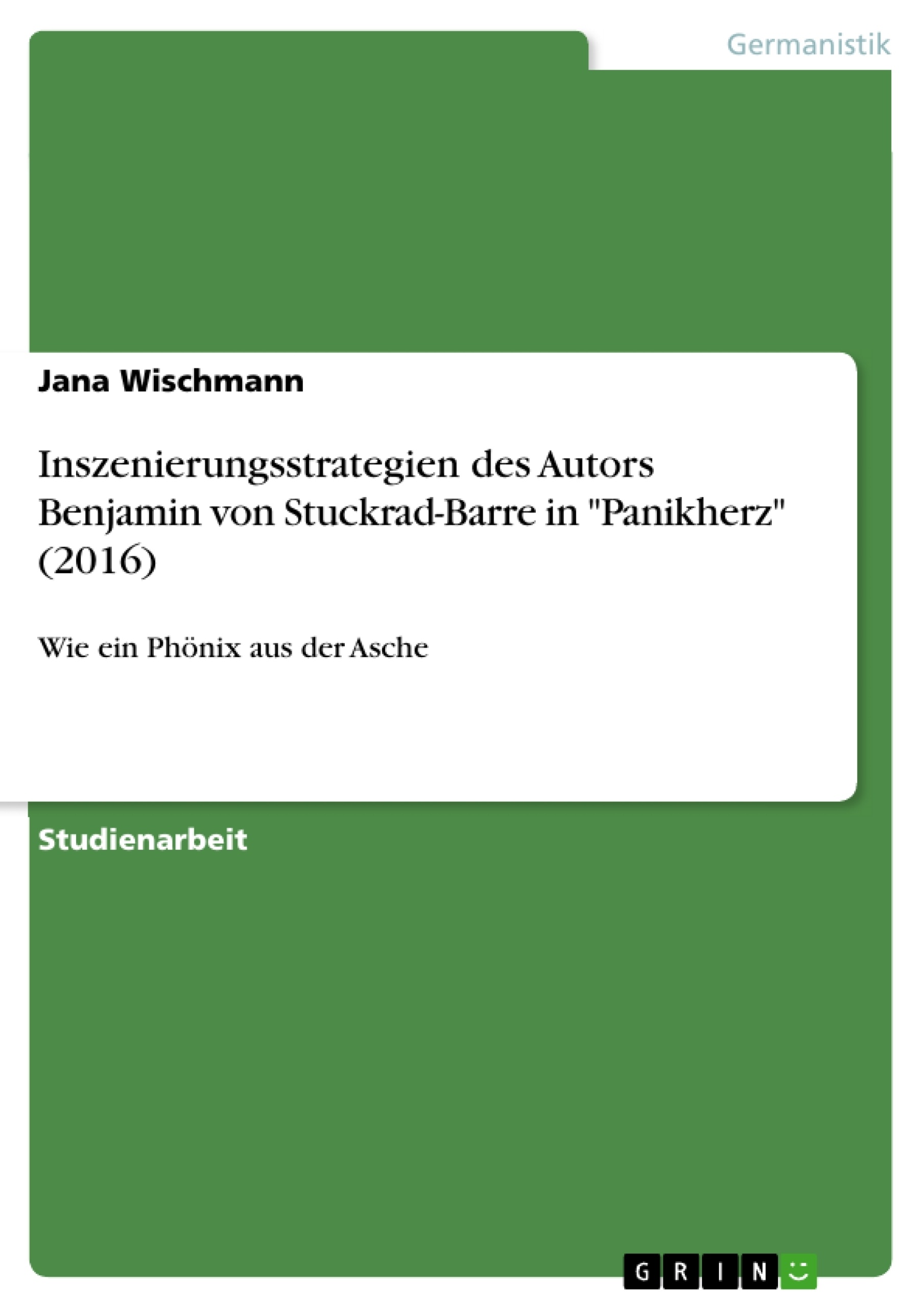Ob und wie sich Benjamin von Stuckrad-Barre in seinem autobiografischen Roman "Panikherz" zu inszenieren weiß, versucht die vorliegende Arbeit herauszustellen. Wahrgenommen wurde "Panikherz" zumindest als bekenntnishafter Roman, der nicht nur vom raschen Aufstieg seines Autors berichtet, sondern auch von dessen großem Wunsch nach Anerkennung, seiner Geltungssucht, Magersucht, Drogensucht. Alles miteinander verzahnt, alles im Medien- und Großstadtrummel dafür verantwortlich, dass es mit Stuckrad-Barre beinahe genauso schnell wieder bergab ging wie bergauf.
Will man die Frage nach der Authentizität und dem Wahrheitsgehalt eines autobiografischen Werks stellen, drängt sich sogleich und unmittelbar der Begriff der Inszenierungsstrategie, auf und letztlich geht es dann nicht mehr darum, ob wirklich wahr ist, was in Stuckrad-Barres Autobiografie geschrieben wurde, sondern wie der Autor sich und seine erzählte Umwelt im Buch inszeniert, den Glauben an eine "Realität" bei seinem Publikum entstehen lässt und aufrechterhält. Eine zweite Ebene der Frage nach Stuckrad-Barres Inszenierungen dürfte im wortwörtlichen Sinne eröffnet werden, denn Autorschaft – ja bloßem Menschsein – liegt immer eine Inszenierung zugrunde, ohne die ein In-Erscheinung- Treten gänzlich unmöglich wäre.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die Autobiographie und ihr Gefolge
- III. Inszenierungsstrategien in Panikherz
- 1) REALITÄTSBEZÜGE
- 2) AUTORINSZENIERUNG
- 3) SELBSTREFERENTIALITÄT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Benjamin von Stuckrad-Barres Autobiographie „Panikherz“ und befasst sich mit der Frage nach Authentizität und Inszenierung in der Textgattung Autobiographie. Dabei wird untersucht, wie der Autor seine Person und die erzählte Umwelt inszeniert, um beim Leser den Glauben an eine „Realität“ zu erzeugen.
- Authentizität und Wahrheitsgehalt autobiographischer Texte
- Inszenierungsstrategien in der Autobiographie
- Die Rolle der Medien und der Öffentlichkeit in der Selbstdarstellung
- Die Grenzen zwischen Autobiographie und Roman
- Die Rezeption von „Panikherz“ und die Frage nach der Wirkungsweise des Textes
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Die Einleitung stellt Benjamin von Stuckrad-Barres Autobiographie „Panikherz“ vor und beleuchtet die Ambivalenz der Rezensionen zum Buch. Sie skizziert die zentrale Thematik des Werks: Stuckrad-Barres rascher Aufstieg und anschließender Absturz aufgrund von Drogenabhängigkeit und Geltungssucht im Kontext des Medienrummels.
II. Die Autobiographie und ihr Gefolge
Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff der Inszenierungsstrategie im Kontext der Autobiographie. Es stellt die Frage, wie sich Stuckrad-Barre in seinem Buch inszeniert und ob er den Glauben an eine „Realität“ beim Leser erzeugt. Die Frage nach der Authentizität und dem Wahrheitsgehalt von „Panikherz“ wird in den Kontext der Autobiographieforschung und der Theorie der Inszenierung eingeordnet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen und Begriffen der Autobiographieforschung wie Authentizität, Wahrheit, Realitätsanspruch, Inszenierung und Bekenntnissen. Sie untersucht die Inszenierungsstrategien des Autors Benjamin von Stuckrad-Barre in seiner Autobiographie „Panikherz“ und beleuchtet die Frage nach der Textgattung: Ist „Panikherz“ Autobiographie oder Roman?
- Arbeit zitieren
- Jana Wischmann (Autor:in), 2020, Inszenierungsstrategien des Autors Benjamin von Stuckrad-Barre in "Panikherz" (2016), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/899405