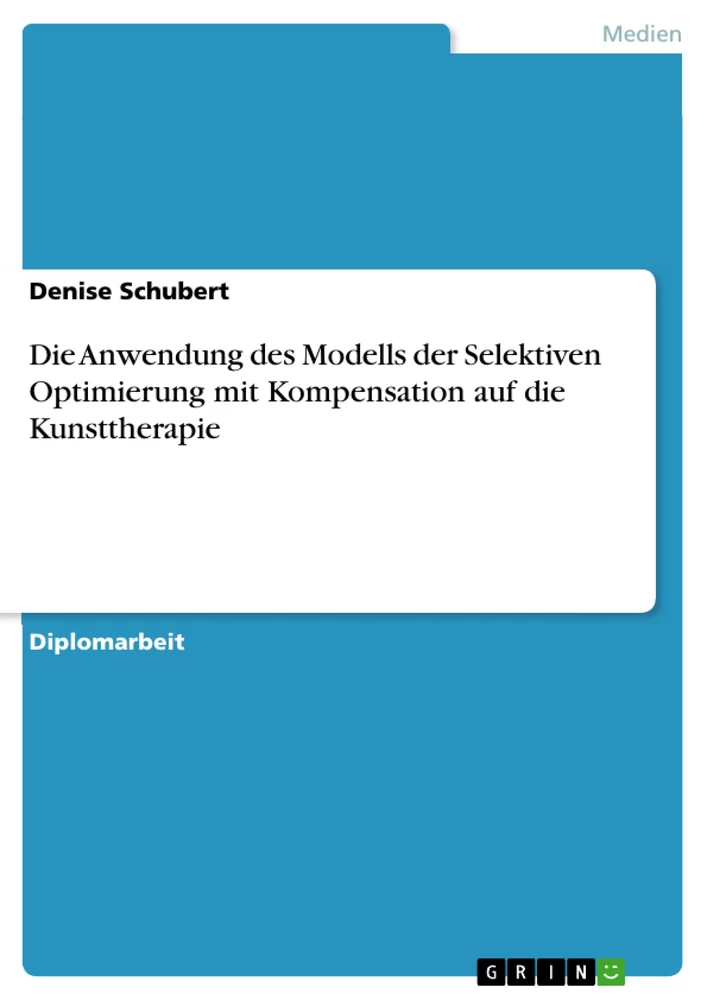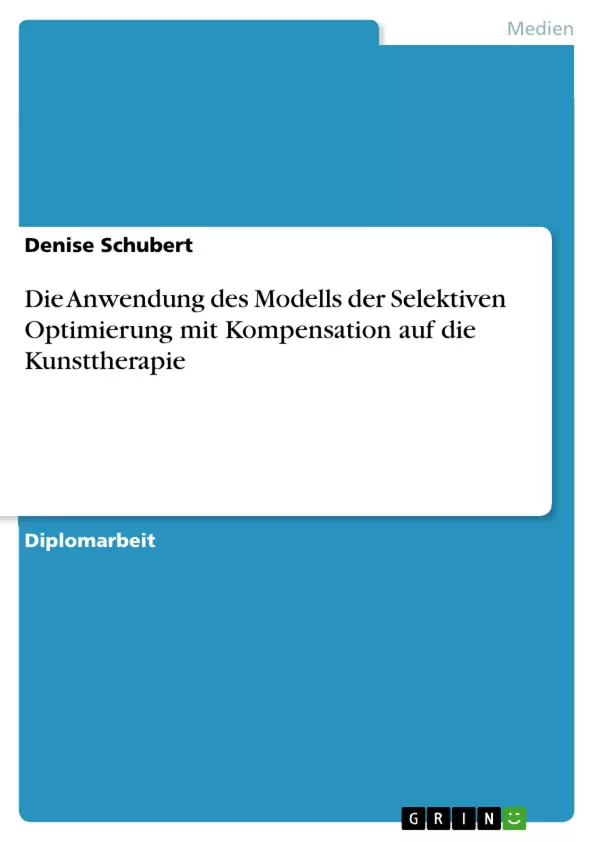Der erste Teil der Arbeit widmet sich dem Modell der Selektiven Optimierung mit Kompensation. Hierzu wird einleitend die Position und der Ursprung des Modells in der deutschen Entwicklungspsychologie geschildert, wobei besonderer Wert auf die Bedeutung der gesamten Lebensspanne für die menschliche Ontogenese gelegt wird. Nach einem kurzen Exkurs in die Intelligenzforschung und eine Beschreibung der Grundlagen des Modells in der Alternsforschung, werden die Prozesse des Modells und deren Veränderungen im Lebenslauf dargestellt.
Der folgende zweite Teil der Diplomarbeit schildert die Anwendung des Modells der Selektiven Optimierung mit Kompensation auf die Kunsttherapie. Hierbei werden zuerst die Bedingungen der Übertragbarkeit beschrieben, die zugrunde liegenden Ressourcen und das Erfolgskriterium Wohlbefinden dargestellt und nachfolgend das SOC-Modell exemplarisch auf den kunsttherapeutischen Prozess nach Altmaier übertragen.
Aus dieser Übertragung wird ein Modellvorschlag zum Auftreten der SOC-Strategien im kunsttherapeutischen Prozess abgeleitet, welches anhand der Konzepte anderer Kunsttherapeuten hinterfragt und gegebenenfalls verändert werden soll. Nachfolgend wird untersucht, inwieweit Schlussfolgerungen aus den gewonnenen Erkenntnissen gezogen werden können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Modell der Selektiven Optimierung mit Kompensation (SOC)
- Die Position des Modells der Selektiven Optimierung mit Kompensation innerhalb der deutschen Entwicklungspsychologie
- Entwicklungspsychologie bezogen auf die Lebensspanne
- Lebensspannenpsychologie und Intelligenzforschung
- Die Alternsforschung als Teilgebiet der Lebensspannenpsychologie
- Das Modell der Selektiven Optimierung mit Kompensation
- Die Prozesse des Modells der Selektiven Optimierung mit Kompensation und deren Orchestrierung
- Die Veränderungen der Nutzung von SOC-Strategien im Verlauf der Lebensspanne
- Die Anwendung des Modells der Selektiven Optimierung mit Kompensation auf die Kunsttherapie
- Bedingungen der Übertragbarkeit
- Ressourcen als Arbeitsgrundlage
- Der Ressourcenbegriff innerhalb des SOC-Modells
- Der Ressourcenbegriff in der Kunsttherapie
- Wohlbefinden als Spiegel erfolgreicher Entwicklung
- Emotionales, kognitives und psychologisches Wohlbefinden als Kriterien erfolgreicher Entwicklung im Rahmen des SOC-Modells
- Beziehungen zwischen Ressourcen, SOC und Wohlbefinden
- Wohlbefinden als Erfolgskriterium der Kunsttherapie
- Exemplarische Übertragung auf die Kunsttherapie
- Anwendung des SOC-Modells auf den kunsttherapeutischen Prozess nach Marianne Altmaier
- Ableitung eines Modellvorschlages zum Auftreten von SOC-Funktionen im kunsttherapeutischen Prozess
- Untersuchung des Modellvorschlages anhand anderer kunsttherapeutischer Konzepte
- Untersuchung der Hypothese anhand SOC-basierter verhaltenstherapeutischer Interventionen
- Reformulierung der Hypothese
- Schlussfolgerungen für eine SOC-Strategien-bewusste Kunsttherapie
- Kritik
- Kritik der Ausführungen zum Modell der Selektiven Optimierung mit Kompensation
- Kritik der Ausführungen zur Übertragung des SOC-Modells auf den kunsttherapeutischen Prozess
- Kritik der Arbeitsweise
- Schlusswort
- Glossar
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Anwendung des Modells der Selektiven Optimierung mit Kompensation (SOC) auf die Kunsttherapie. Die Arbeit zielt darauf ab, die Übertragbarkeit des SOC-Modells, das ursprünglich im Bereich der Alternsforschung entstand, auf den kunsttherapeutischen Prozess zu untersuchen. Dabei werden die SOC-Strategien und ihre Auswirkungen auf den kunsttherapeutischen Prozess analysiert.
- Übertragbarkeit des SOC-Modells auf die Kunsttherapie
- Ressourcen und Wohlbefinden im Kontext des SOC-Modells und der Kunsttherapie
- Die Rolle der SOC-Strategien in der Kunsttherapie und deren Auswirkungen auf den kunsttherapeutischen Prozess
- Entwicklung eines Modellvorschlages zum Auftreten von SOC-Funktionen im kunsttherapeutischen Prozess
- Kritik und Reformulierung der Hypothese
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Fragestellung der Diplomarbeit vor und beschreibt den Ursprung des Interesses der Verfasserin an der Anwendung des SOC-Modells auf die Kunsttherapie. Außerdem werden die Gliederung und der Aufbau der Arbeit erläutert.
- Das Modell der Selektiven Optimierung mit Kompensation (SOC): Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Einführung in das SOC-Modell. Es behandelt die Entstehung des Modells innerhalb der deutschen Entwicklungspsychologie, beschreibt die zentralen Prozesse des SOC-Modells (Selektion, Optimierung und Kompensation) und zeigt die Veränderungen in der Anwendung dieser Prozesse im Verlauf der Lebensspanne auf.
- Die Anwendung des Modells der Selektiven Optimierung mit Kompensation auf die Kunsttherapie: Dieses Kapitel untersucht die Übertragbarkeit des SOC-Modells auf die Kunsttherapie. Es beleuchtet die Bedingungen für eine erfolgreiche Übertragung, analysiert den Ressourcenbegriff im Kontext des SOC-Modells und der Kunsttherapie, sowie das Erfolgskriterium Wohlbefinden. Weiterhin werden die einzelnen Phasen des kunsttherapeutischen Prozesses nach Marianne Altmaier im Hinblick auf die SOC-Strategien analysiert.
- Kritik: In diesem Kapitel werden die Ausführungen der Arbeit kritisch beleuchtet und die Grenzen der Übertragung des SOC-Modells auf die Kunsttherapie diskutiert. Außerdem wird die Methodik der Arbeit reflektiert.
- Schlusswort: Das Schlusswort fasst die zentralen Ergebnisse der Arbeit zusammen und diskutiert zukünftige Forschungsbedarfe.
Schlüsselwörter
Die Diplomarbeit befasst sich mit zentralen Begriffen der Entwicklungspsychologie, der Alternsforschung, der Kunsttherapie und des Modells der Selektiven Optimierung mit Kompensation. Die Arbeit beleuchtet Themen wie lebenslange Entwicklung, Ressourcenmanagement, Wohlbefinden, individuelle Entwicklungsprozesse und die Rolle des Therapeuten im kunsttherapeutischen Prozess.
- Arbeit zitieren
- Dipl. Kunsttherapeutin Denise Schubert (Autor:in), 2006, Die Anwendung des Modells der Selektiven Optimierung mit Kompensation auf die Kunsttherapie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90006