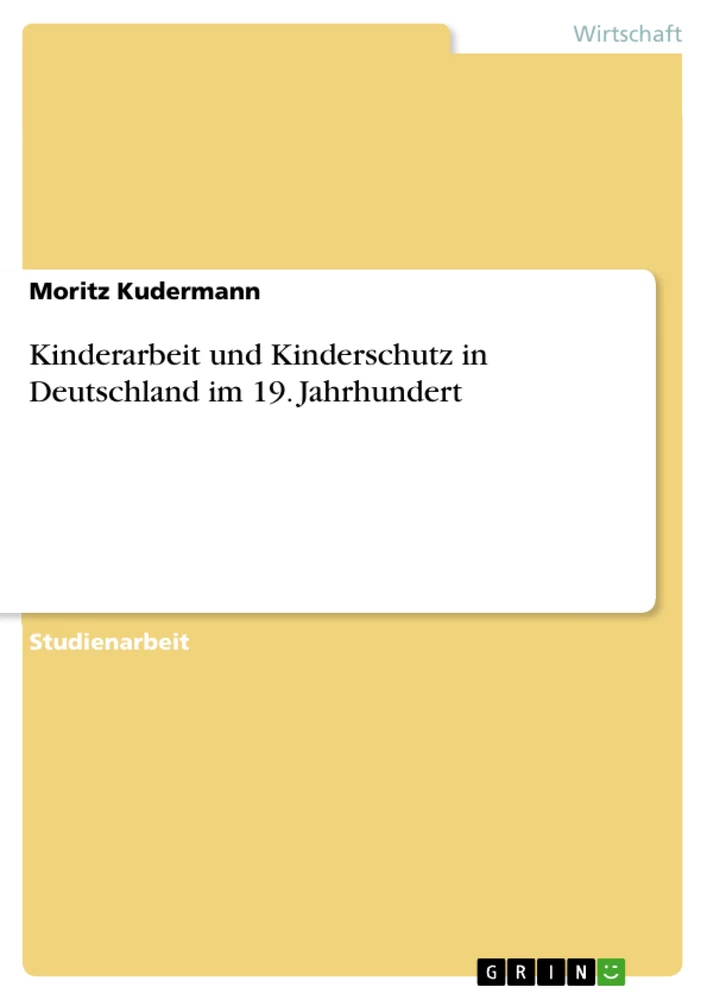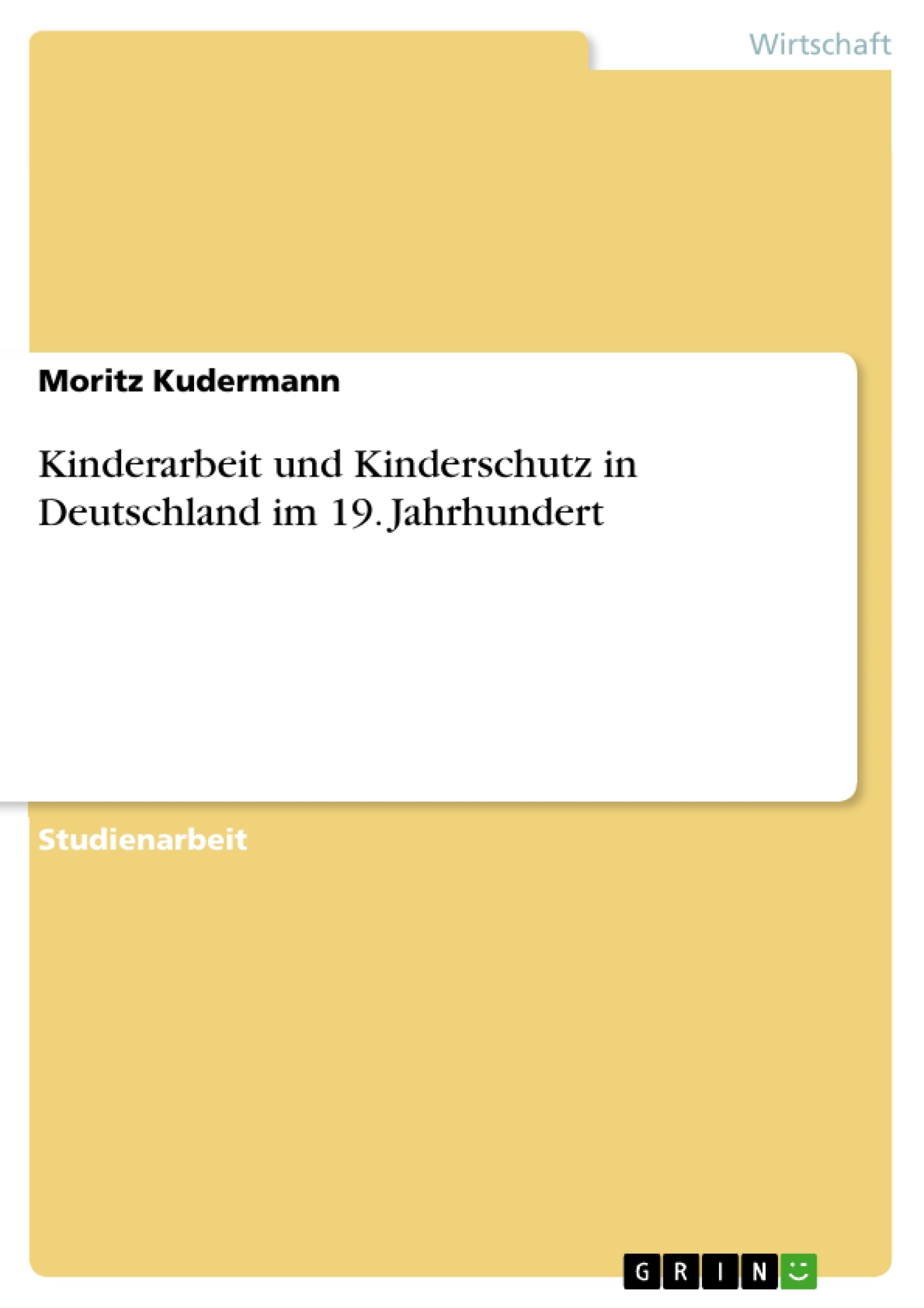In der Arbeit setzt sich der Autor mit der Thematik der Kinderarbeit und des Kinderschutzes im 19. Jahrhunderts in Deutschland auseinander.
Europäer verbinden Kinderarbeit mit schrecklichen Bildern aus Textilfabriken in Bangladesch oder Indien, auf denen Kinder für große Modekonzerne viele Stunden täglich schwitzend und in unzumutbaren Zuständen für einen Hungerlohn arbeiten. Es wird darüber geurteilt, da solche Bedingungen für Kinder in Europa und vor allem in Deutschland unvorstellbar sind. Dabei wird eine Zeit vergessen, in der die Kindheit nicht unbeschwert und mit Fürsorge der Eltern erfüllt war. Eine Zeit, in der ein Kind nur so gut war, wie es arbeiten konnte. Unseren modernen gesetzlichen Kinderschutz, um diese "schönste Zeit im Leben", wie Jean-Jacques Rousseau die Kindheit bereits 1762 in seinem Werk "Émile ou de l’éducation" genannt hat, zu schützen, gibt es noch nicht allzu lange. Genauer gesagt gab es vor 200 Jahren noch keinen Kinderschutz, ganz im Gegenteil: Kinderarbeit war bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts ohne jegliche Reglements an der Tagesordnung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition und Begriffsklärung
- Arten von Kinderarbeit
- Landwirtschaftliche Kinderarbeit
- Industrielle Kinderarbeit
- Veränderung der Kinderarbeit im Laufe des 19. Jahrhunderts
- Fazit und heutige Situation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Kinderarbeit und den Kinderschutz in Deutschland während des 19. Jahrhunderts, mit einem Fokus auf Preußen, Bayern und Württemberg. Die Zielsetzung besteht darin, die Bedingungen der Kinderarbeit zu beleuchten und die Entwicklung des Kinderschutzes in diesem Zeitraum zu analysieren. Die Arbeit berücksichtigt die unterschiedlichen Definitionen von "Kind" und "Kinderarbeit" im 19. Jahrhundert.
- Definition von Kind und Kinderarbeit im 19. Jahrhundert
- Arten der Kinderarbeit (Landwirtschaft, Industrie)
- Entwicklung des Kinderschutzes im 19. Jahrhundert
- Soziale und gesellschaftliche Auswirkungen der Kinderarbeit
- Vergleich der Situation in verschiedenen deutschen Regionen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt einen Kontrast zwischen der modernen Wahrnehmung von Kinderarbeit und der Realität im 19. Jahrhundert in Deutschland her. Sie betont den Mangel an Kinderschutz und die weitverbreitete Kinderarbeit bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts. Der Fokus der Arbeit liegt auf Preußen, mit teilweiser Berücksichtigung Bayerns und Württembergs aufgrund der komplexen politischen Landschaft vor 1871.
2. Definition und Begriffsklärung: Dieses Kapitel klärt die zentralen Begriffe "Kind", "Kinderarbeit" und "Kinderschutz". Es beleuchtet die unterschiedlichen Definitionen des Begriffs "Kind" im 19. Jahrhundert, basierend auf dem Allgemeinen Landrecht für die Preußischen Staaten (ALR) von 1794 und frühen Kinderschutzgesetzen. Kinderarbeit wird definiert und im Kontext des damaligen gesellschaftlichen Verständnisses eingeordnet. Die Definition des Kinderschutzes wird ebenfalls in Bezug auf die damaligen gesetzlichen Regelungen erläutert.
3. Arten von Kinderarbeit: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Arten von Kinderarbeit im 19. Jahrhundert, wobei die gängige Praxis, Kinder in die "echte Arbeit" einzuführen, hervorgehoben wird. Es wird die gesellschaftliche Akzeptanz der Kinderarbeit und die damit verbundene Sozialisation beleuchtet. Die Kapitel erläutert, wie Kinderarbeit als Mittel zur Integration in die Gesellschaft angesehen wurde, um Betteln zu vermeiden und Tugenden wie Fleiß und Gehorsam zu fördern. Die Rolle der Landwirtschaft und der Industrie bei der Kinderarbeit wird ebenfalls erörtert.
Schlüsselwörter
Kinderarbeit, Kinderschutz, 19. Jahrhundert, Deutschland, Preußen, Bayern, Württemberg, Landwirtschaftliche Kinderarbeit, Industrielle Kinderarbeit, Gesetzeslage, Sozialgeschichte, Jugendarbeitsschutzgesetz, Allgemeine Landrecht, Sozialisation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Kinderarbeit und Kinderschutz im 19. Jahrhundert in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Kinderarbeit und den Kinderschutz in Deutschland während des 19. Jahrhunderts, mit einem Fokus auf Preußen, Bayern und Württemberg. Sie beleuchtet die Bedingungen der Kinderarbeit und analysiert die Entwicklung des Kinderschutzes in diesem Zeitraum. Die Arbeit berücksichtigt die unterschiedlichen Definitionen von "Kind" und "Kinderarbeit" im 19. Jahrhundert.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition von Kind und Kinderarbeit im 19. Jahrhundert; Arten der Kinderarbeit (Landwirtschaft, Industrie); Entwicklung des Kinderschutzes im 19. Jahrhundert; Soziale und gesellschaftliche Auswirkungen der Kinderarbeit; Vergleich der Situation in verschiedenen deutschen Regionen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit enthält folgende Kapitel: Einleitung, Definition und Begriffsklärung, Arten von Kinderarbeit, Veränderung der Kinderarbeit im Laufe des 19. Jahrhunderts, Fazit und heutige Situation.
Wie wird Kinderarbeit in der Arbeit definiert?
Das Kapitel "Definition und Begriffsklärung" klärt den Begriff "Kinderarbeit" im Kontext des damaligen gesellschaftlichen Verständnisses und in Bezug auf das Allgemeine Landrecht für die Preußischen Staaten (ALR) von 1794 und frühe Kinderschutzgesetze. Es wird die unterschiedliche Definition von "Kind" im 19. Jahrhundert beleuchtet.
Welche Arten von Kinderarbeit werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Arten von Kinderarbeit, mit Schwerpunkt auf der landwirtschaftlichen und industriellen Kinderarbeit. Sie beleuchtet die gesellschaftliche Akzeptanz der Kinderarbeit und deren Rolle bei der Sozialisation der Kinder.
Wie wird die Entwicklung des Kinderschutzes dargestellt?
Die Arbeit analysiert die Entwicklung des Kinderschutzes im 19. Jahrhundert, unter Berücksichtigung der damaligen gesetzlichen Regelungen und des gesellschaftlichen Wandels. Ein Vergleich der Situation in verschiedenen deutschen Regionen (Preußen, Bayern, Württemberg) wird vorgenommen.
Welche Regionen Deutschlands stehen im Mittelpunkt der Untersuchung?
Der Fokus liegt auf Preußen, mit teilweiser Berücksichtigung Bayerns und Württembergs aufgrund der komplexen politischen Landschaft vor 1871.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kinderarbeit, Kinderschutz, 19. Jahrhundert, Deutschland, Preußen, Bayern, Württemberg, Landwirtschaftliche Kinderarbeit, Industrielle Kinderarbeit, Gesetzeslage, Sozialgeschichte, Jugendarbeitsschutzgesetz, Allgemeine Landrecht, Sozialisation.
Welche Quellen werden wahrscheinlich verwendet?
Die Arbeit bezieht sich vermutlich auf das Allgemeine Landrecht für die Preußischen Staaten (ALR) von 1794 und frühe Kinderschutzgesetze, sowie auf historische Dokumente und Literatur zur Sozialgeschichte des 19. Jahrhunderts in Deutschland.
- Quote paper
- Moritz Kudermann (Author), 2020, Kinderarbeit und Kinderschutz in Deutschland im 19. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/902026