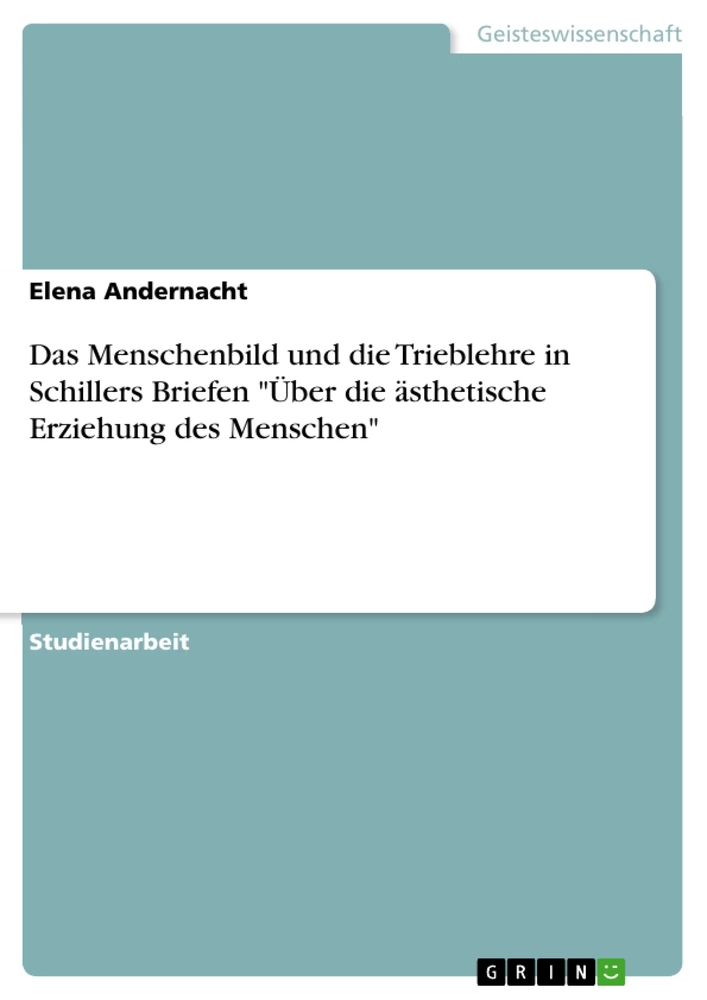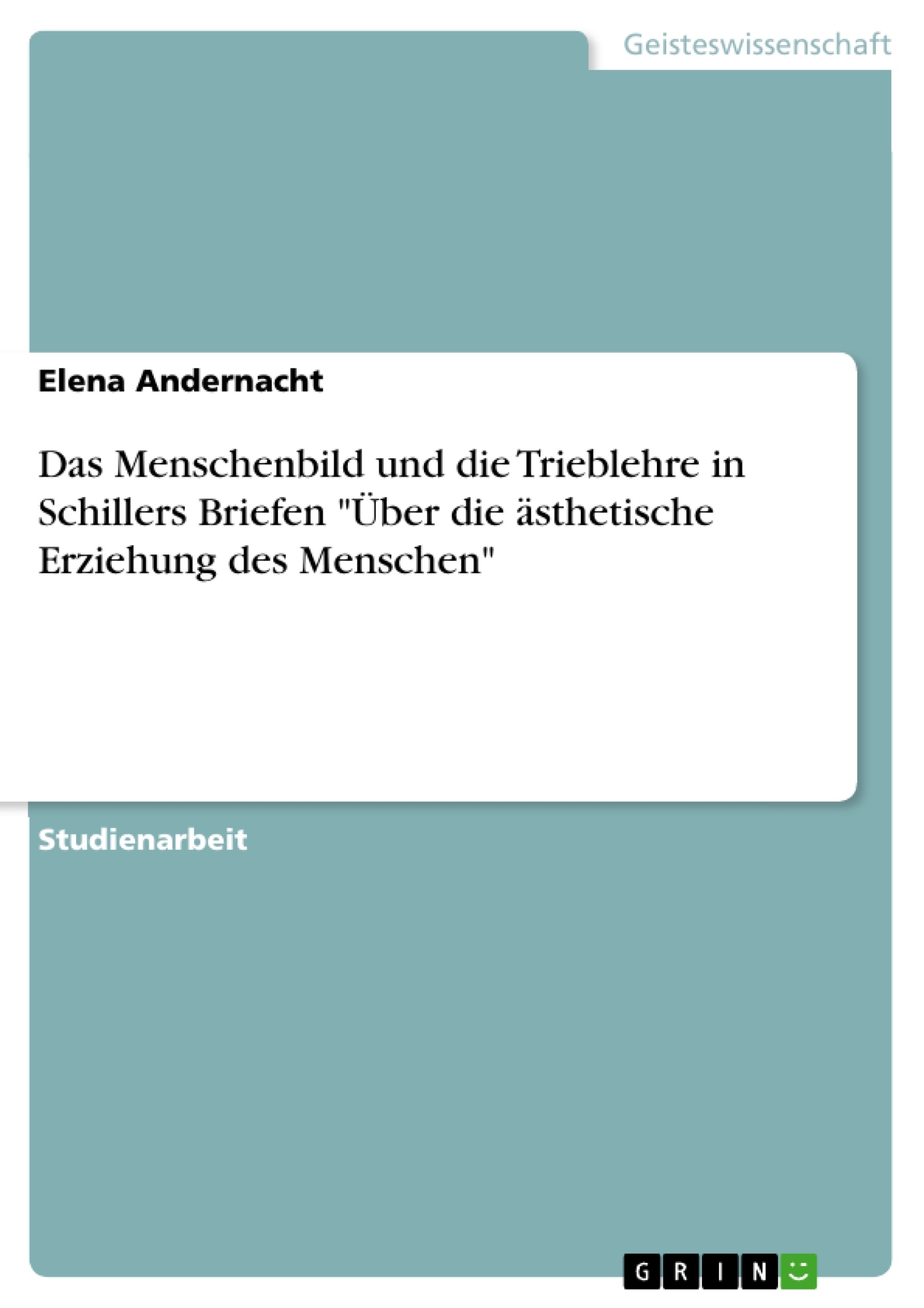In dieser Hausarbeit werde ich das von Schiller skizzierte Menschenbild in seiner Schrift "Über die ästhetische Erziehung des Menschen" im Hinblick auf die Menschengruppen des Barbaren, Wilden und gebildeten Menschen und die damit verbundene Trieblehre analysieren bzw. charakterisieren. Anschließend werde ich auf das Ideal der Totalität eingehen, welches für Schiller eine wichtige Rolle spielte. In meinem Fazit werde ich dann begründen, ob Schillers Einteilung in Menschengruppen und die Zuordnung von Trieben aus meiner Sicht sinnvoll ist und auch auf die heutige Zeit noch übertragen werden kann.
In den im Jahre 1795 erschienenen Briefen Über die ästhetische Erziehung des Menschen von Friedrich Schiller setzt sich Schiller in insgesamt 27 Briefen mit dem Begriff der Freiheit durch Ästhetik und deren Weiterentwicklung zur Totalität auseinander. In den Briefen formuliert Schiller unter anderem seine Spieltheorie, denn der Begriff des Spiels ist für sein Menschenbild und seine Trieblehre sehr wichtig. Den Ausgangspunkt der Briefe bilden Schillers Unzufriedenheit mit den Entwicklungen der Französischen Revolution und seine Abscheu gegenüber deren Folgen.
Mit den Briefen knüpft er in einigen Punkten an Kants Kritik der Urteilskraft und an dessen Verständnis von Ästhetik an. Kernthese der 27 Briefe Über die ästhetische Erziehung des Menschen über die Schönheit ist, dass der Mensch durch die Schönheit zur Freiheit gelangt. „Die Beschäftigung mit der Schönheit soll den Menschen individuelle und kollektive, also politische Freiheit geben“. Die ästhetische Erziehung befasst sich mit dem Menschen als Ganzes und strebt danach, die verschiedenen Teile des Menschen zu harmonisieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Menschenbild Schillers
- 2.1. Der Barbar
- 2.2. Der Wilde
- 2.3. Der gebildete Mensch
- 3. Die Trieblehre Schillers
- 3.1. Der Formtrieb
- 3.2. Der Sachtrieb bzw. Stofftrieb
- 3.3. Der Spieltrieb
- 4. Totalität
- 5. Fazit und Schlussteil
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht Schillers Menschenbild in seinen "Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen" im Hinblick auf die Menschengruppen des Barbaren, Wilden und gebildeten Menschen, und analysiert die damit verbundene Trieblehre. Sie beleuchtet außerdem das Ideal der Totalität, welches für Schiller eine wichtige Rolle spielte.
- Schillers Einteilung der Menschen in die Kategorien Barbar, Wilder und gebildeter Mensch
- Die Rolle der Vernunft und der Sinne im menschlichen Dasein
- Schillers Trieblehre und die drei Haupttriebe: Formtrieb, Sachtrieb und Spieltrieb
- Das Ideal der Totalität als Ziel der ästhetischen Erziehung
- Die Relevanz von Schillers Gedanken für die heutige Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und erläutert Schillers "Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen" als Ausgangspunkt der Untersuchung. Sie stellt den Autor, seine Lebensumstände und die Entstehungsgeschichte der Briefe vor.
- Kapitel 2: Das Menschenbild Schillers: Dieses Kapitel analysiert Schillers Einteilung des Menschen in drei Gruppen: den Barbaren, den Wilden und den gebildeten Menschen. Es beleuchtet die spezifischen Eigenschaften jeder Gruppe und deren Beziehung zu Vernunft, Gefühl und Triebleben.
- Kapitel 3: Die Trieblehre Schillers: Dieses Kapitel widmet sich Schillers Theorie der menschlichen Triebe. Es erläutert die drei Haupttriebe: den Formtrieb, den Sachtrieb und den Spieltrieb, und untersucht deren Funktion im menschlichen Verhalten und in der Entwicklung des Menschen.
- Kapitel 4: Totalität: In diesem Kapitel wird das Ideal der Totalität als das Ziel der ästhetischen Erziehung nach Schiller beleuchtet. Es wird untersucht, wie die harmonische Verbindung von Vernunft, Gefühl und Trieben zu einer vollständigen Entwicklung des Menschen führt.
Schlüsselwörter
Schillers "Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen", Menschenbild, Barbar, Wilder, gebildeter Mensch, Trieblehre, Formtrieb, Sachtrieb, Spieltrieb, Totalität, Ästhetik, Vernunft, Gefühl, Freiheit.
Häufig gestellte Fragen
Welche Menschentypen unterscheidet Schiller in seinen Briefen?
Schiller teilt die Menschen in drei Gruppen ein: den Barbaren, den Wilden und den gebildeten Menschen.
Was sind die drei Haupttriebe in Schillers Trieblehre?
Schiller definiert den Formtrieb (Vernunft), den Sachtrieb bzw. Stofftrieb (Sinnlichkeit) und den Spieltrieb, der beide harmonisiert.
Was ist das Ziel der ästhetischen Erziehung?
Das Ziel ist die Erlangung von individueller und politischer Freiheit durch die Schönheit, was zur „Totalität“ des Menschen führt.
Welchen Einfluss hatte die Französische Revolution auf das Werk?
Schillers Unzufriedenheit mit den gewaltsamen Entwicklungen der Französischen Revolution war der Ausgangspunkt für seine Überlegungen zur Freiheit durch Ästhetik.
Was versteht Schiller unter dem Begriff „Totalität“?
Totalität bezeichnet die harmonische Verbindung von Vernunft und Gefühl, wodurch der Mensch seine volle Bestimmung erreicht.
- Citation du texte
- Elena Andernacht (Auteur), 2019, Das Menschenbild und die Trieblehre in Schillers Briefen "Über die ästhetische Erziehung des Menschen", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/902966