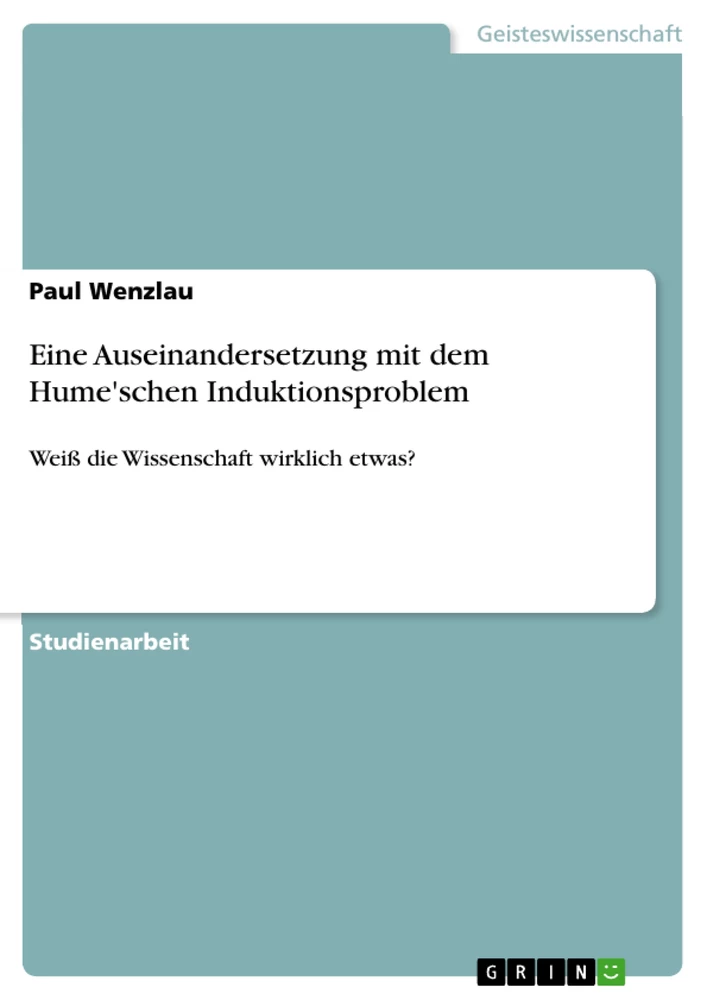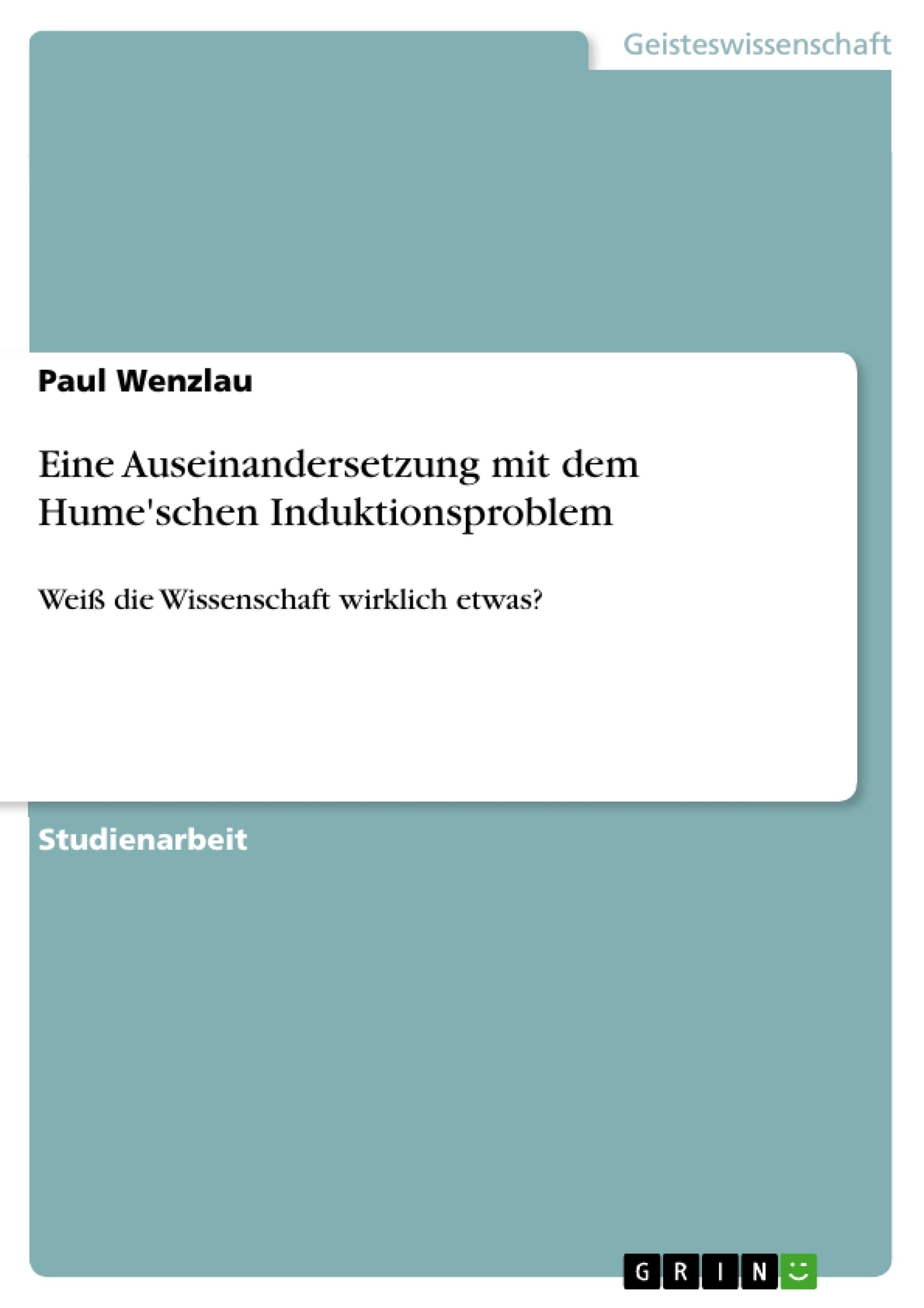In dieser Arbeit steht eines der zentralen philosophischen Probleme, vor welches uns noch heute der bekannte Philosoph David Hume (1711 – 1776) stellt und die Frage, ob Wissenschaft nach Humes überhaupt über Wissen verfügen kann. Humes Untersuchung über den menschlichen Verstand aus dem Jahre 1748 war die überarbeitete Version seines Hauptwerks, die menschliche Natur, dass er rund ein Jahrzehnt zuvor anonym veröffentlichte und welches in England keine große Resonanz genossen hatte.
In seiner schottischen Heimat blieb seine Neufassung zunächst vergleichbar unbeachtet. Erst in dem aufklärerischen Frankreich stieß es auf größere Beachtung, später in Deutschland tat es letztlich nicht unwesentlich zur Initiierung der kopernikanischen Wende bei. Mit seinem Ansatz des skeptischen Empirismus regte er Kant zum Verfassen seiner Transzendentaltheorie an, in der er unter anderem auf Humes Idee des Empirismus antwortet und welche letztlich zu einem Paradigmenwechsel in der Philosophie des 18. Jahrhunderts führte. Humes Werk überdauert seitdem den philosophischen Diskurs und drängt heute noch die Wissenschaft in prekäre Erklärungsnot.
Mit der Induktionsproblematik hat David Hume eines der bedeutendsten Probleme der Erkenntnistheorie formuliert: Die Suche nach der Rechtfertigung induktiver Schlüsse zum Bilden von Tatsachen aus sinnlich Wahrgenommenem. Ziel dieser Arbeit ist es, ein grundlegendes Verständnis für die Argumentation Humes für das Induktionsproblem zu erlangen und dieses im Anschluss auf meine Arbeitsthese anzuwenden, die wie folgt lautet: Inwiefern ist nach einer Auseinandersetzung mit dem von Hume erläuterten Induktionsproblem das Vertrauen in wissenschaftliche Prognosen noch rational haltbar?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Perzeption des Geistes - Eindrücke und Ideen
- Humes Gabel
- Eine Auseinandersetzung mit dem Hume'schen Induktionsproblem
- Weiß die Wissenschaft wirklich etwas?
- Das Induktionsproblem
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Induktionsproblem, einem zentralen philosophischen Problem, das der Philosoph David Hume (1711-1776) aufwarf. Die Arbeit untersucht, ob Wissenschaft angesichts des Induktionsproblems überhaupt zu Wissen gelangen kann. Im Zentrum der Arbeit steht die Frage, ob das Vertrauen in wissenschaftliche Prognosen nach einer Auseinandersetzung mit dem Induktionsproblem noch rational ist.
- Humes Perzeptionstheorie und das Kopieprinzip
- Die Unterscheidung von Vernunftsgegenständen nach Humes Gabel
- Das Induktionsproblem und seine Auswirkungen auf wissenschaftliches Wissen
- Die Rolle der Erfahrung in der Erkenntnisgewinnung
- Die Grenzen des menschlichen Verstandes in der Erkenntnis von Kausalität
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Induktionsproblem von David Hume vor und erläutert die Fragestellung der Arbeit. Sie führt in Humes Werk über den menschlichen Verstand ein und beschreibt dessen Einfluss auf die Philosophie des 18. Jahrhunderts.
- Die Perzeption des Geistes – Eindrücke und Ideen: Dieses Kapitel beschreibt Humes Theorie der Perzeption des Geistes und die Unterscheidung zwischen Eindrücken und Ideen. Es erläutert das Kopieprinzip, welches besagt, dass alle Ideen auf vorherigen Eindrücken basieren. Außerdem wird die von Hume vertretene Kritik an der angeborenen Idee von Gott aus Descartes' Philosophie behandelt.
- Humes Gabel: Dieses Kapitel analysiert Humes Unterscheidung von Vernunftsgegenständen in Beziehungen zwischen Ideen und Tatsachen. Es werden Beispiele aus der Mathematik und aus der empirischen Beobachtung vorgestellt, um die beiden Arten von Wissen zu verdeutlichen.
- Eine Auseinandersetzung mit dem Hume'schen Induktionsproblem: Dieses Kapitel behandelt das Induktionsproblem in Humes Werk. Es werden Humes Argumente für die Grenzen des menschlichen Verstandes in der Erkenntnis von Kausalität und die damit verbundenen Schwierigkeiten wissenschaftlicher Prognosen erläutert.
Schlüsselwörter
Das Induktionsproblem, David Hume, Erkenntnistheorie, Empirismus, Skeptizismus, Kausalität, Erfahrung, wissenschaftliches Wissen, Prognosen, Beziehungen zwischen Ideen, Tatsachen, Humes Gabel.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hume'sche Induktionsproblem?
Das Induktionsproblem beschreibt die Schwierigkeit, allgemeingültige Naturgesetze oder Tatsachen allein aus beobachteten Einzelfällen (sinnliche Wahrnehmung) rational zu rechtfertigen.
Was versteht Hume unter „Humes Gabel“?
Hume unterscheidet alle Gegenstände der Vernunft in zwei Kategorien: Beziehungen zwischen Ideen (wie in der Mathematik) und Tatsachen (die auf Erfahrung beruhen).
Was besagt das Kopieprinzip bei David Hume?
Das Kopieprinzip besagt, dass alle unsere Ideen lediglich schwache Abbilder (Kopien) von lebhafteren Eindrücken (Perzeptionen) sind, die wir durch unsere Sinne gewonnen haben.
Ist Vertrauen in wissenschaftliche Prognosen laut Hume rational haltbar?
Die Arbeit untersucht genau diese Frage und zeigt auf, dass Hume die Grenzen des menschlichen Verstandes bei der Erkenntnis von Kausalität betont, was wissenschaftliche Prognosen erkenntnistheoretisch prekär macht.
Welchen Einfluss hatte Hume auf Immanuel Kant?
Humes skeptischer Empirismus regte Kant dazu an, seine Transzendentaltheorie zu verfassen, was letztlich zur „kopernikanischen Wende“ in der Philosophie des 18. Jahrhunderts führte.
- Quote paper
- Paul Wenzlau (Author), 2020, Eine Auseinandersetzung mit dem Hume'schen Induktionsproblem, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/903388