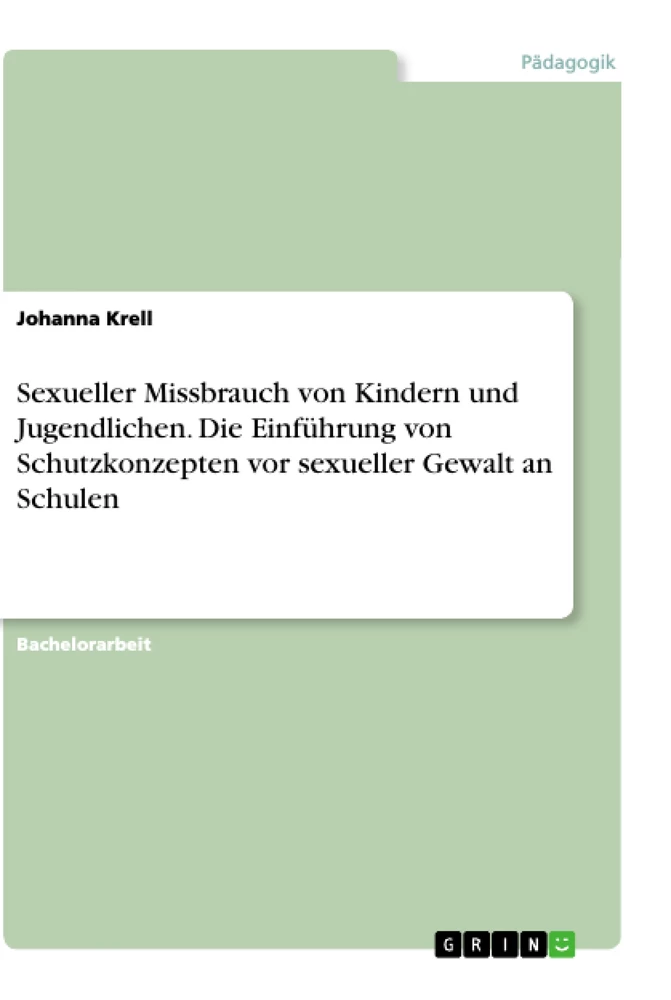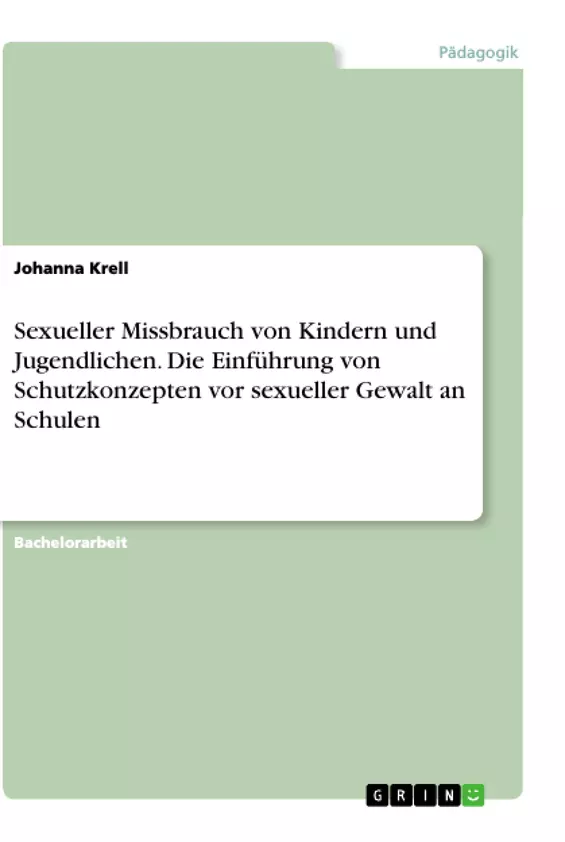Die Arbeit behandelt die Themen sexuelle Gewalt und Schutzkonzepte. Es wird den Fragen nachgegangen, warum Schutzkonzepte an Schulen eine hohe Relevanz haben und wie sie jeweils entstehen. Des Weiteren beantwortet der Autor die Fragen "Welche Bestandteile benötigt ein umfangreiches Schutzkonzept?", "Welche Aufgabenbereiche übernimmt eine Fachberatungsstelle für sexuellen Missbrauch bei der Erstellung eines Schutzkonzeptes an Schulen?" und "Wie wirken Schutzkonzepte spezifisch?".
Um dies zu ermöglichen, wird sich zunächst dem Begriff "sexueller Missbrauch" angenähert und ein statistischer Einblick in die Häufigkeit von sexuellem Missbrauch gegeben. Erarbeitet werden soll, welche Risiko- und Schutzfaktoren es gibt, wie Täter vorgehen und welche Folgen sexueller Missbrauch für die Betroffenen haben kann. Im Anschluss daran wird dargelegt, welche Bestandteile ein Schutzkonzept allgemein ausmachen und wie diese jeweils aufgebaut sind. Weiter wird sich mit den entsprechenden rechtlichen Vorgaben auseinandergesetzt und mit der Frage, warum Schutzkonzepte an Schulen elementar sind. Dies wird mit einem Fallbeispiel einer Einrichtung aus der Umgebung von Ludwigsburg unterlegt.
Exemplarisch soll erklärt werden, wie diese Institution den Aufarbeitungsprozess angegangen ist und wie dort die erstellten Schutzkonzepte spezifisch wirken. Anschließend wird eine Fachberatungsstelle vorgestellt. Die schriftlich geführte Befragung wird zuletzt unter Berücksichtigung der zuvor dargelegten theoretischen Informationen ausgewertet und zusammengefasst. Abschließend werden Kooperationspartner vorgestellt, an die sich Schulen bezüglich des Erstellens von Schutzkonzepten, aber auch bezüglich allgemeiner Fragen zu sexueller Gewalt, wenden können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sexueller Missbrauch/ Sexualisierte Gewalt
- Begriffsklärung und Definitionen
- Statistischer Überblick
- Täter, Motive und Täterstrategien
- Risiko und Schutzfaktoren
- Folgen sexuellen Missbrauchs
- Was sind Schutzkonzepte?
- Ein Überblick
- Möglichkeiten für Inhalte eines Schutzkonzeptes
- Gefährdungsanalyse
- Prävention
- Intervention
- Aufarbeitung
- Traumabehandlung: Umgang mit betroffenen Kindern
- Warum sind Schutzkonzepte an Schulen notwendig?
- Rechtliche Vorgaben
- UN-Kinderrechtskonvention
- Grundgesetz und Sozialgesetzbuch-rechtliche Bestimmungen
- Pädagogische Verstrickung
- Wie wirken Schutzkonzepte spezifisch- Beispiel der Brüdergemeinde Korntal
- Missbrauchsfälle in der Heimeinrichtung der Brüdergemeinde Korntal
- Aufarbeitung
- Wie wirken die Schutzkonzepte spezifisch in der Einrichtung?
- Interview zum Thema Schutzkonzepte vor sexueller Gewalt an Schulen mit der Fachberatungsstelle Pfiffigunde e.V.
- Vorstellung der Fachberatungsstelle
- Schriftliche Kurzinterviews
- Befragung geführt mit einer Mitarbeiterin des
- Zusammenfassung und Kernpunkte des Interviews
- Kooperationsmöglichkeiten
- Fachberatungsstellen
- Fachberatungsstellen im Umkreis Ludwigsburg
- Schulsozialarbeit
- Insoweit erfahrene Fachkraft
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema sexueller Gewalt an Schulen und analysiert die Notwendigkeit von Schutzkonzepten. Sie untersucht die rechtlichen Vorgaben, die pädagogischen Verstrickungen und die Relevanz von Prävention und Intervention im Kontext sexueller Gewalt. Außerdem beleuchtet die Arbeit konkrete Beispiele für Schutzkonzepte und deren Wirksamkeit in Schulen.
- Sexuelle Gewalt an Schulen: Begriffsklärung, Häufigkeit, Täter, Motive und Folgen
- Schutzkonzepte: Inhalte, Struktur und Wirksamkeit
- Rechtliche Rahmenbedingungen und pädagogische Aspekte von Schutzkonzepten
- Kooperation mit Fachberatungsstellen und anderen Akteuren im Bereich des Kinderschutzes
- Spezifische Beispiele für Schutzkonzepte in Schulen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Kapitel führt in das Thema sexuelle Gewalt ein, beleuchtet die historische Entwicklung und die aktuelle Relevanz des Themas und argumentiert für die Notwendigkeit von Schutzkonzepten an Schulen.
- Was sind Schutzkonzepte?: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Schutzkonzept“ und erläutert die wichtigsten Elemente, die in einem solchen Konzept enthalten sein sollten. Dazu gehören Gefährdungsanalyse, Prävention, Intervention, Aufarbeitung und Traumabehandlung.
- Warum sind Schutzkonzepte an Schulen notwendig?: Das Kapitel argumentiert für die Relevanz von Schutzkonzepten in Schulen auf Grundlage rechtlicher Vorgaben wie der UN-Kinderrechtskonvention und des Grundgesetzes sowie unter Berücksichtigung der besonderen pädagogischen Herausforderungen.
- Wie wirken Schutzkonzepte spezifisch- Beispiel der Brüdergemeinde Korntal: Dieses Kapitel untersucht ein konkretes Beispiel für die Umsetzung von Schutzkonzepten in einer Schuleinrichtung. Es analysiert die historischen Missbrauchsfälle und die Rolle von Schutzkonzepten bei der Aufarbeitung und Prävention.
- Interview zum Thema Schutzkonzepte vor sexueller Gewalt an Schulen mit der Fachberatungsstelle Pfiffigunde e.V.: Das Kapitel berichtet über ein Interview mit einer Fachberatungsstelle für sexuellen Missbrauch. Es beleuchtet die Rolle der Fachberatungsstelle bei der Erstellung und Implementierung von Schutzkonzepten.
- Kooperationsmöglichkeiten: Dieses Kapitel stellt verschiedene Akteure vor, die an der Entwicklung und Umsetzung von Schutzkonzepten an Schulen beteiligt sind, und erläutert die Bedeutung von interdisziplinärer Zusammenarbeit im Bereich des Kinderschutzes.
Schlüsselwörter
Sexuelle Gewalt, Schutzkonzept, Schule, Kinderrechte, Prävention, Intervention, Aufarbeitung, Traumabehandlung, Fachberatungsstelle, Kooperation, Kinderschutz.
- Citar trabajo
- Johanna Krell (Autor), 2020, Sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Die Einführung von Schutzkonzepten vor sexueller Gewalt an Schulen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/903806