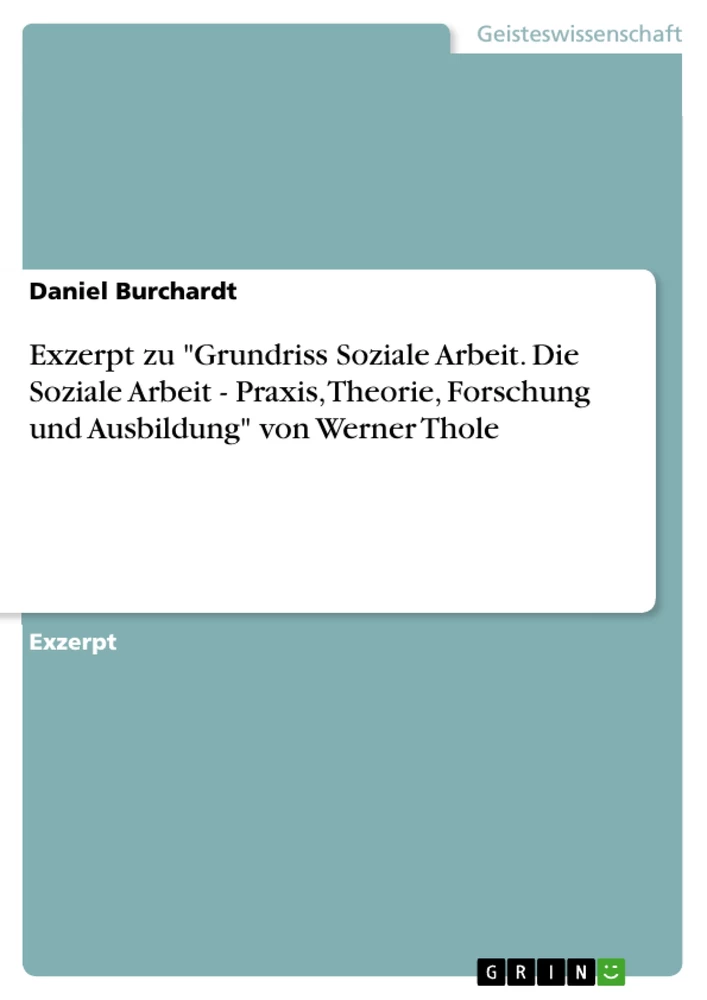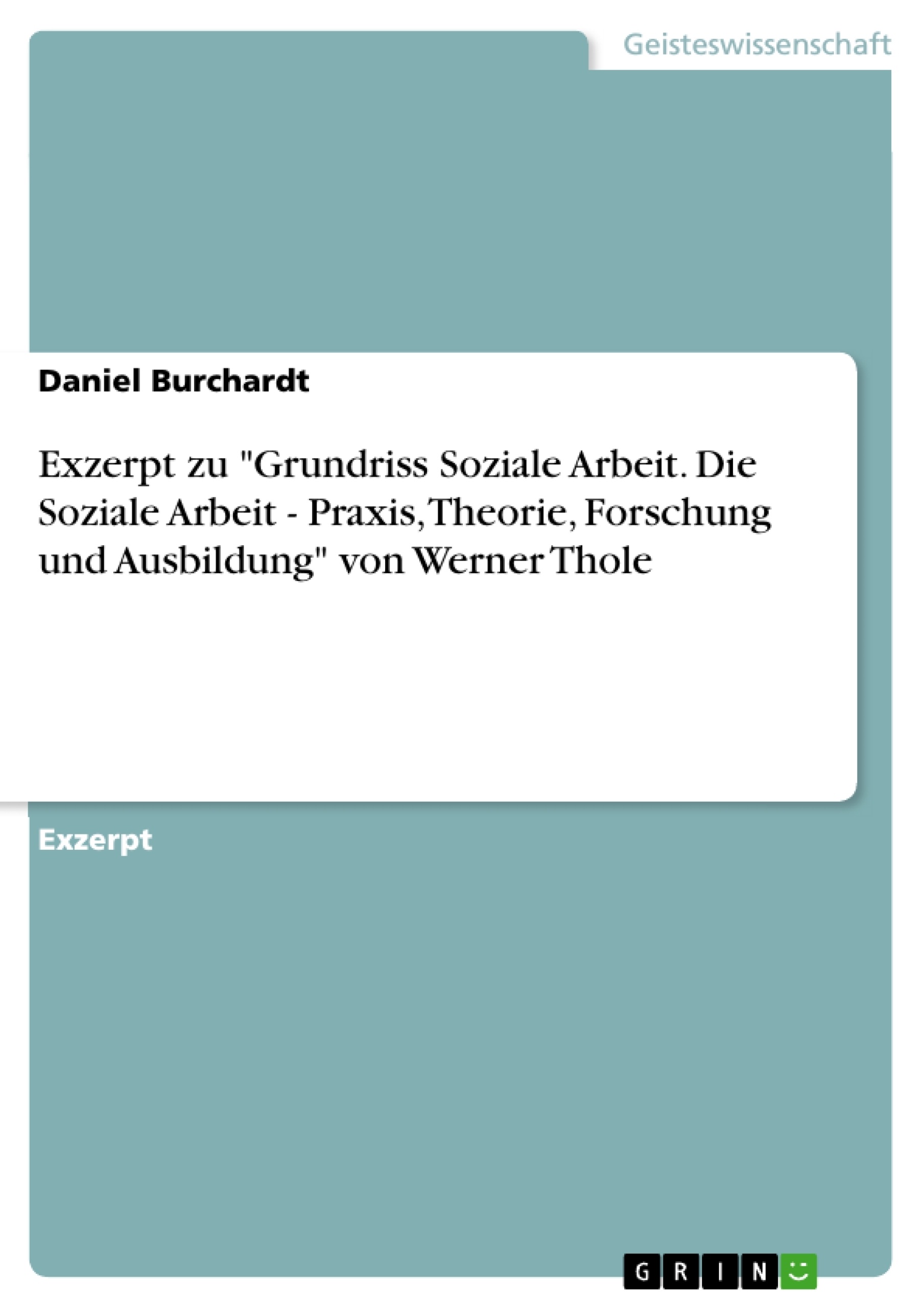Die vorliegende Arbeit stellt ein Exzerpt zum Wirken von Werner Thole dar und basiert auf dem Werk
"Grundriss Soziale Arbeit. Die Soziale Arbeit - Praxis, Theorie, Forschung und Ausbildung. Versuch einer Standortbestimmung."
Das Exzerpt fasst im Wesentlichen die Aussagen zu Themen von: Geschichtlicher Entwicklung, Gegenstand und Begriff Sozialer Arbeit, Unterscheidung von Disziplin und Profession Sozialer Arbeit, Handlungsfelder Sozialer Arbeit undTheorie und Praxis Sozialer Arbeit zusammen und bietet abschließend ein kritisches Fazit zu diesem Werk. Des Weiteren wurden die zum Teil für die Leserschaft schwer zu verstehenden Aussagen vereinfacht, um den Lesefluss zu erleichtern und Informationen greifbarer zu gestalten.
Inhaltsverzeichnis
- Geschichtliche Entwicklung
- Gegenstand und Begriff
- Unterscheidung von Profession und Disziplin
- Handlungsfelder
- Theorie und Praxis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text „Grundriss Soziale Arbeit“ von Werner Thole befasst sich mit der Standortbestimmung der Sozialen Arbeit. Er beleuchtet die historische Entwicklung, den Gegenstand und Begriff sowie die Abgrenzung von Profession und Disziplin. Darüber hinaus werden die verschiedenen Handlungsfelder und die Verbindung von Theorie und Praxis in der Sozialen Arbeit diskutiert.
- Geschichtliche Entwicklung der Sozialen Arbeit
- Abgrenzung von Sozialarbeit und Sozialpädagogik
- Profession und Disziplin in der Sozialen Arbeit
- Definition und Abgrenzung verschiedener Handlungsfelder
- Beziehung zwischen Theorie und Praxis in der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Geschichtliche Entwicklung
Der Text beleuchtet die Anfänge der Sozialen Arbeit im 19. Jahrhundert, die durch soziale und wirtschaftliche Notlagen geprägt waren. Er schildert die Entstehung erster sozialer Initiativen und die Herausbildung der Sozialpädagogik. Die Entwicklung der Sozialen Arbeit in der Weimarer Republik mit der Etablierung von Institutionen und die fortschreitende Politisierung und gesellschaftliche Fundierung der Theorieentwicklung ab 1970 werden dargestellt.
Gegenstand und Begriff
Der Text untersucht die Vielschichtigkeit und Komplexität des Begriffs „Soziale Arbeit“ und analysiert die verschiedenen Perspektiven auf das System der Praxis, Qualifikation und Forschung. Er beleuchtet die Aufgaben der Sozialen Arbeit, wie die Befähigung von Klienten zur Bewältigung von Herausforderungen und die Entwicklung von Lösungsstrategien.
Unterscheidung von Profession und Disziplin
Der Text differenziert zwischen den Begriffen „Profession“ und „Disziplin“ in der Sozialen Arbeit. Er erklärt, dass die Profession sich auf die berufliche Praxis bezieht, während die Disziplin das Feld der wissenschaftlichen Theoriebildung und Forschung umfasst. Der Text verdeutlicht, dass beide Begriffe in einem Wechselwirkungsverhältnis stehen und einander ergänzen.
Handlungsfelder
Der Text beschreibt die verschiedenen Handlungsfelder der Sozialen Arbeit, die sich aus der Historie und der Entwicklung des Fachgebiets ergeben. Er unterscheidet zwischen Arbeitsfeldtypen wie Kinder- und Jugendhilfe, erwachsenenbezogene Soziale Hilfe, Altenhilfe und sozialpädagogische Angebote in der Gesundheitshilfe. Zusätzlich werden Praxisfelder nach der Intensität von Maßnahmen eingeteilt, die sich auf die Lebenswelt beziehen und ergänzende, unterstützende oder ersetzende Leistungen umfassen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind: Soziale Arbeit, Sozialpädagogik, Profession, Disziplin, Handlungsfelder, Theorie, Praxis, Geschichte, Institutionen, Klienten, Hilfe, Unterstützung, Bildung, Lebenswelt, Intervention, Prävention.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern von Werner Tholes „Grundriss Soziale Arbeit“?
Das Werk bietet eine Standortbestimmung der Sozialen Arbeit und beleuchtet deren Praxis, Theorie, Forschung und Ausbildung sowie die historische Entwicklung.
Wie unterscheidet Thole zwischen Profession und Disziplin?
Die Profession bezieht sich auf die berufliche Praxis und das Handeln, während die Disziplin die wissenschaftliche Theoriebildung und Forschung innerhalb der Sozialen Arbeit umfasst.
Welche Handlungsfelder der Sozialen Arbeit werden genannt?
Thole unterscheidet unter anderem zwischen Kinder- und Jugendhilfe, Altenhilfe, erwachsenenbezogener Sozialhilfe und Angeboten in der Gesundheitshilfe.
Was ist der Gegenstand der Sozialen Arbeit laut diesem Werk?
Der Gegenstand ist die Befähigung von Klienten zur Bewältigung von Herausforderungen in ihrer Lebenswelt durch ein komplexes System aus Praxis, Qualifikation und Forschung.
Wie hat sich die Soziale Arbeit historisch entwickelt?
Sie entstand im 19. Jahrhundert aus wirtschaftlicher Not, entwickelte sich über die Sozialpädagogik und Institutionen der Weimarer Republik bis hin zur theoretischen Fundierung ab den 1970er Jahren.
- Quote paper
- Daniel Burchardt (Author), 2019, Exzerpt zu "Grundriss Soziale Arbeit. Die Soziale Arbeit - Praxis, Theorie, Forschung und Ausbildung" von Werner Thole, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/904044