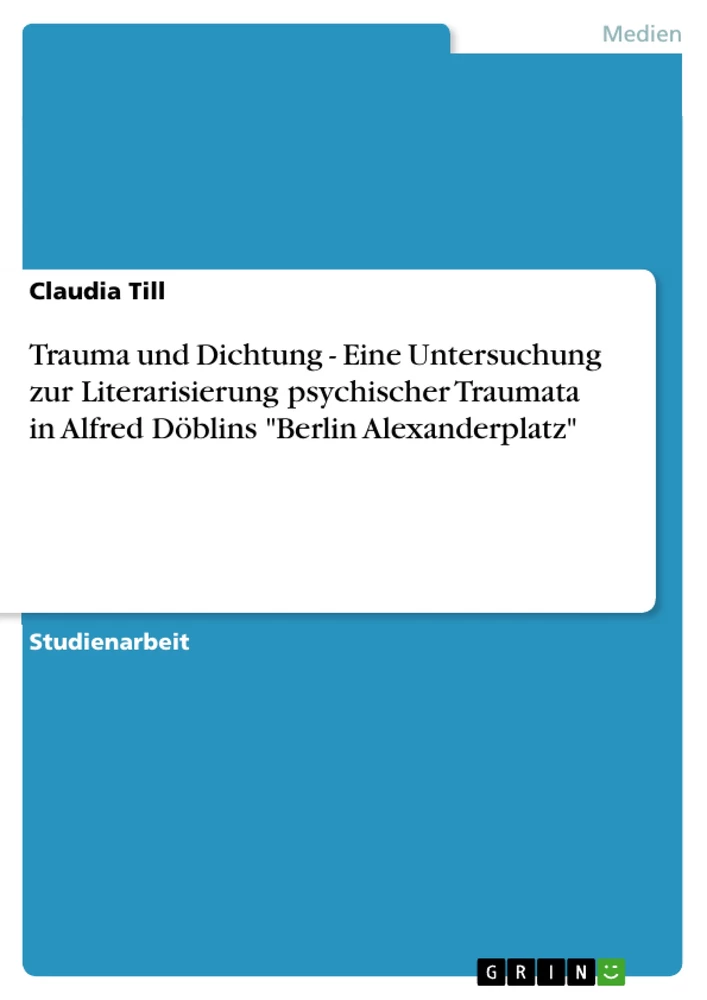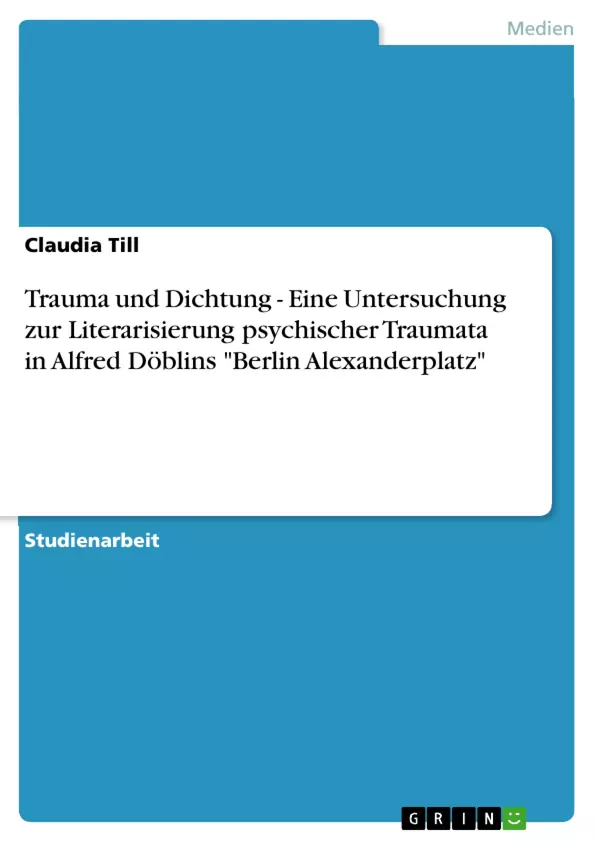„Dichter heran müssen wir an das Leben!“, forderte der Arzt und Autor Alfred Döblin (1878-1957) von seinen Schriftstellerkollegen. Getreu diesem Motto ließ Döblin Beobachtungen und Erkenntnisse seiner langjährigen Tätigkeit als Nervenarzt in sein literarisches Schaffen einfließen. Ähnlich seinen psychiatrischen Studien wollte Döblin auch bei seinen fiktiven Figuren psychische Abläufe und Vorgänge darstellen, ohne jedoch psychologisierend zu erzählen, wie ein Emile Zola, Gustav Freytag oder Theodor Fontane.
Döblins psychiatrisches Hintergrundwissen legt eine interdisziplinäre Untersuchung seiner Werke nahe. Man könnte sogar behaupten, dass interdisziplinäre Texte, wie die Döblins, geradezu nach einer interdisziplinären Analyse verlangen. Die bisherige, sehr umfangreiche Forschung befasste sich jedoch fast ausschließlich mit Döblin als Autor und rückte dessen moderne Erzähl- und Montagetechniken sowie die Symbolik der Werke in den Mittelpunkt. Döblin selbst aber betonte mit Schriften wie "Arzt und Dichter", "Zwei Seelen in einer Brust" oder "Eine kassenärztliche Sprechstunde" die Bedeutsamkeit seines Arztberufes. In der vorliegenden Arbeit soll daher an einem Beispiel die Verbindung von Psychologie und Literatur in Döblins Schaffen herausgearbeitet werden. Ziel ist es, mit Hilfe der modernen Psychotraumatologie und vor dem Hintergrund psychiatrischen Wissens zu Döblins Zeiten, neue Einsichten in sein bekanntestes Werk, Berlin Alexanderplatz, zu gewinnen. (...) Im Zentrum steht dabei die Frage, inwieweit Döblins ärztliche Erfahrungen mit psychischen Störungen in der Darstellung des Franz Biberkopf zum Ausdruck kommen und wie diese mit Hilfe der heutigen Psychotraumatologie gedeutet werden können. Ich möchte dieser Frage mit Hilfe einer hermeneutischen Textanalyse und auf der Grundlage des "Lehrbuchs der Psychotraumatologie" von Fischer und Riedesser nachgehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Psychotraumatologie
- Psychiatrisches Wissen zu Beginn des 19. Jahrhunderts
- Einführung in den Roman
- Überblick über Handlung und Struktur
- Formale Aspekte der literarischen Traumadarstellung
- Franz Biberkopfs Leidensweg
- ,,Die Strafe beginnt“
- Erster Schlag
- Zweiter Schlag
- Dritter Schlag
- Direkte und mittelbare Traumafolgen
- Aspekte peritraumatischer Situationen
- Direkte Traumafolgen
- Mittelbare Traumafolgen
- Ausblick: Dissoziale Persönlichkeitsstörung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, anhand der modernen Psychotraumatologie und vor dem Hintergrund psychiatrischen Wissens zu Alfred Döblins Zeiten, neue Einsichten in sein bekanntestes Werk, Berlin Alexanderplatz, zu gewinnen. Im Zentrum steht die Frage, inwieweit Döblins ärztliche Erfahrungen mit psychischen Störungen in der Darstellung des Franz Biberkopf zum Ausdruck kommen und wie diese mit Hilfe der heutigen Psychotraumatologie gedeutet werden können.
- Die Verbindung von Psychologie und Literatur in Döblins Schaffen
- Die Anwendung der Psychotraumatologie auf die Figur des Franz Biberkopf in Berlin Alexanderplatz
- Die Darstellung von psychischen Traumata in der Literatur des frühen 20. Jahrhunderts
- Die Rolle psychiatrischer Erkenntnisse im literarischen Werk Alfred Döblins
- Die Frage der Dissoziation und Traumaverarbeitung in der Figur des Franz Biberkopf
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Verbindung zwischen Döblins ärztlicher Tätigkeit und seinem literarischen Schaffen heraus und führt die zentrale Forschungsfrage der Arbeit ein.
- Psychotraumatologie: Dieses Kapitel erläutert wichtige Aspekte der Psychotraumatologie und definiert den Begriff der psychischen Traumatisierung. Es beschreibt das Traumaverarbeitungsprozess und die möglichen Folgen einer nicht erfolgreichen Traumaverarbeitung.
- Psychiatrisches Wissen zu Beginn des 19. Jahrhunderts: Hier wird ein kurzer Blick auf den damaligen Forschungsstand in der Psychiatrie geworfen, um den Kontext der Döblinschen Arbeit zu beleuchten.
- Einführung in den Roman: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Handlung und Struktur von Berlin Alexanderplatz und beleuchtet formale Aspekte der literarischen Traumadarstellung im Roman.
- Franz Biberkopfs Leidensweg: Hier wird der Leidensweg der Hauptfigur Franz Biberkopf anhand der Handlungsstruktur des Romans nachgezeichnet, wobei die traumatogenen Stimuli und Biberkopfs Reaktionen auf diese im Mittelpunkt stehen.
- Direkte und mittelbare Traumafolgen: Dieses Kapitel analysiert die aus der Traumatisierung resultierenden direkten und indirekten Folgen für Franz Biberkopf.
- Ausblick: Dissoziale Persönlichkeitsstörung: Dieses Kapitel bietet einen Ausblick auf die mögliche Interpretation von Franz Biberkopfs Verhalten im Kontext der dissozialen Persönlichkeitsstörung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen der psychischen Traumatisierung, der Traumaverarbeitung, der Dissoziation, der literarischen Darstellung von Traumata, der psychiatrischen Erkenntnisse in der Literatur und der Figur des Franz Biberkopf in Alfred Döblins Roman Berlin Alexanderplatz.
- Arbeit zitieren
- Claudia Till (Autor:in), 2008, Trauma und Dichtung - Eine Untersuchung zur Literarisierung psychischer Traumata in Alfred Döblins "Berlin Alexanderplatz", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90944