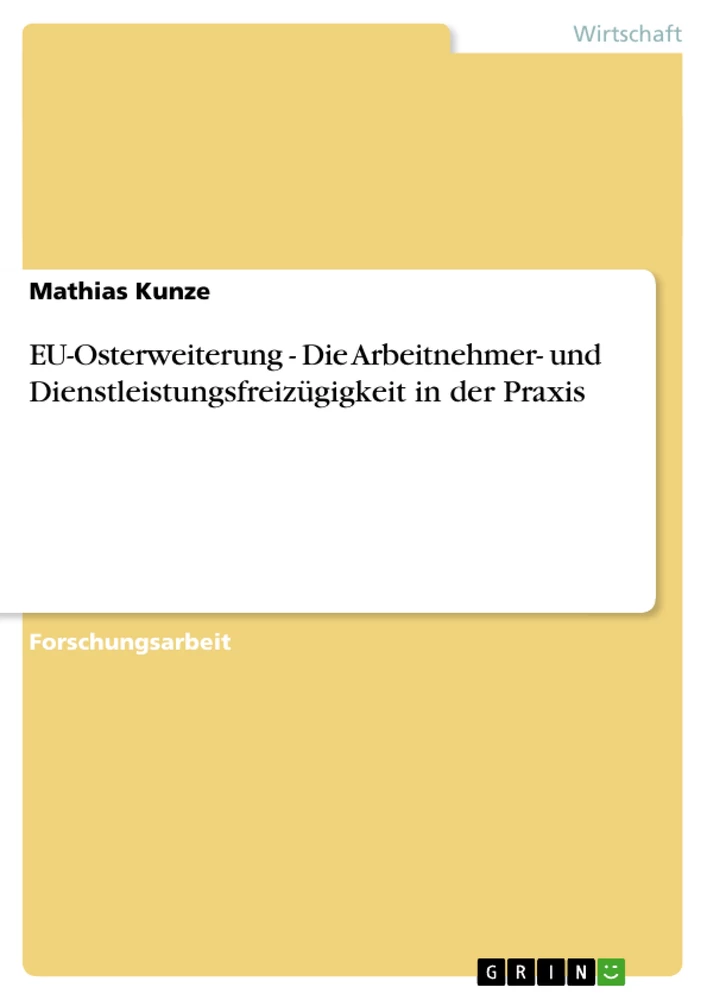Die Europäische Union (EU) steht vor der Herausforderung, die unnatürliche Spaltung Europas als Ergebnis des Zweiten Weltkriegs endgültig zu überwinden.
Nach dem Zusammenbruch der politischen Systeme in Osteuropa begleitet und unterstützt die EU die demokratische und wirtschaftliche Transformation der mittel- und osteuropäischen Länder (MOEL). Am 01. Mai 2004 sind zehn Länder der EU beigetreten, die von anfänglich sechs auf mittlerweile 25 Mitgliedstaaten angewachsen ist. Die Beitrittsstaaten bestehen aus der Tschechische Republik, der slowakischen Republik, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowenien, Ungarn, Malta und Zypern.
Die EU-Osterweiterung hat für ein engeres Zusammenrücken zwischen einem Großteil der Staaten gesorgt. Auch Skepsis und Befürchtungen sind sowohl bei den bisherigen als auch bei den neuen EU-Mitgliedern erkennbar. Dafür lassen sich mehrere Gründe anführen. Zum einen ist der beträchtliche Entwicklungs- und Einkommensrückstand gegenüber den EU-15-Mitgliedstaaten zu nennen. Zum anderen hat die EU noch nie schlagartig 100 Millionen Menschen aufgenommen und integriert, deren Lebensstandard etwa nur ein Fünftel dessen beträgt, was die EU mit 15 Mitgliedern aufzuweisen hat. Die MOEL befürchteten u. a. als Staaten zweiter Klasse behandelt zu werden.
Ferner geht mit der Erweiterung des europäischen Binnenmarktes ein neuer Interessenkampf einher, welcher für heftige Auseinandersetzungen innerhalb von Politik und Wirtschaft sorgt. Denn mit der EU-Osterweiterung scheint der Weg für die unbeschränkte Arbeitnehmer- und Dienstleistungsfreizügigkeit geebnet. Die Freizügigkeit der Arbeitskräfte war seit Aufnahme der Beitrittsverhandlungen ein zentraler Bestandteil des europäischen Integrationsprozesses. Vor dem Hintergrund der EU-Osterweiterung wurde und wird die Wanderung von Arbeitskräften kontrovers diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Osterweiterung der Europäischen Union - ein Überblick
- Grundsätzliche Kriterien und Voraussetzung für den EU-Beitritt
- Ausgewählte Instrumentarien der EU-Osterweiterung
- Beigetretene Staaten im Zuge der EU-Osterweiterung
- Estland
- Lettland
- Litauen
- Polen
- Slowakei
- Slowenien
- Tschechien
- Ungarn
- Wirtschaftliche Auswirkungen der EU-Osterweiterung nach dem Beitritt und Aussicht auf Beitritt zur Währungsunion
- Die Arbeitnehmer- und Dienstleistungsfreizügigkeit - Eine Bestandsaufnahme
- Erwartungen und Befürchtungen auf dem Arbeitsmarkt
- Gesetzliche Regelungen und Maßnahmen
- Die Arbeitnehmer- und Dienstleistungsfreizügigkeit in der Europäischen Union
- Das 2 3 2 -Modell
- Der Arbeitsmarktzugang für ausgewählte Arbeitnehmergruppen
- Werkvertragsarbeitnehmer
- Saisonarbeiter
- Grenzgänger
- Gastarbeiter
- Das Arbeitnehmer-Entsendegesetz
- Ausgewählte Regeln und Maßnahmen in der Kritik
- Bedeutungen und Übergangsfristen im Rahmen der 2-3 2-Regelung
- Aufhebung der Übergangsregeln nach zwei Jahren
- Beibehaltung der Übergangsfristen in Deutschland
- Der deutsche Arbeitsmarkt und die allgemeinen Wirtschaftsprobleme im Osten als Rechtfertigung
- Grenzland als Rechtfertigung
- Gezielte Steuerung des Arbeitsmarktzuganges als Rechtfertigung
- Entsendegesetz, Mindestlöhne und Missbrauch der Arbeitnehmer- und Dienstleistungsfreizügigkeit
- Exkurs: Schwarzarbeit und deutsche Arbeitslose
- Ausweitung des Entsendegesetzes auf alle Branchen – Richtig oder falsch?
- Position polnischer Experten zur Arbeitnehmer- und Dienstleistungsfreizügigkeit
- Die Brisanz der Bolkestein-Direktive
- Potenziale der geplanten Dienstleistungsrichtlinie
- Entstehung und Ziele der Dienstleistungsrichtlinie
- Inhalte der Dienstleistungsrichtlinie
- Herkunftslandprinzip als Kernstück der Dienstleistungsrichtlinie
- Kompromiss zur Dienstleistungsrichtlinie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Auswirkungen der Osterweiterung der Europäischen Union auf den deutschen Arbeitsmarkt. Dabei werden die rechtlichen Rahmenbedingungen der Arbeitnehmer- und Dienstleistungsfreizügigkeit sowie die damit verbundenen Chancen und Herausforderungen analysiert.
- Die rechtlichen Grundlagen der Arbeitnehmer- und Dienstleistungsfreizügigkeit in der EU
- Die ökonomischen Auswirkungen der EU-Osterweiterung auf den deutschen Arbeitsmarkt
- Die Folgen der Arbeitnehmer- und Dienstleistungsfreizügigkeit für die deutsche Wirtschaft
- Die Rolle des Entsendegesetzes in der Debatte um die Arbeitnehmerfreizügigkeit
- Die Brisanz der Bolkestein-Direktive und ihre potenziellen Folgen für den deutschen Arbeitsmarkt
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Relevanz der Osterweiterung der EU für den deutschen Arbeitsmarkt dar und skizziert die Themen und Fragestellungen der Arbeit.
- Kapitel 2 bietet einen Überblick über die Osterweiterung der EU, einschließlich der Kriterien für den Beitritt, der wichtigsten Instrumentarien der Erweiterung und der einzelnen Beitrittsstaaten.
- Kapitel 3 analysiert die wirtschaftlichen Auswirkungen der EU-Osterweiterung auf den deutschen Arbeitsmarkt, insbesondere im Hinblick auf die Arbeitnehmer- und Dienstleistungsfreizügigkeit.
- Kapitel 4 befasst sich mit ausgewählten Regeln und Maßnahmen im Rahmen der Arbeitnehmer- und Dienstleistungsfreizügigkeit, die in der Kritik stehen, insbesondere der 2-3 2-Regelung und dem Entsendegesetz.
- Kapitel 5 diskutiert die Brisanz der Bolkestein-Direktive und ihre potenziellen Auswirkungen auf den deutschen Arbeitsmarkt.
Schlüsselwörter
EU-Osterweiterung, Arbeitnehmerfreizügigkeit, Dienstleistungsfreizügigkeit, Arbeitsmarkt, Entsendegesetz, Bolkestein-Direktive, Wirtschaftliche Auswirkungen, Rechtliche Rahmenbedingungen, Chancen und Herausforderungen.
Häufig gestellte Fragen
Was war die größte Herausforderung der EU-Osterweiterung 2004?
Die Integration von zehn Ländern mit beträchtlichem Einkommensrückstand und die Überwindung der wirtschaftlichen Spaltung Europas nach dem Zweiten Weltkrieg.
Was versteht man unter der 2-3-2-Regelung?
Dies war ein Modell für Übergangsfristen, bei dem alte EU-Mitglieder den Arbeitsmarktzugang für Bürger der neuen Mitgliedstaaten für bis zu sieben Jahre einschränken konnten.
Welche Rolle spielt das Entsendegesetz?
Das Arbeitnehmer-Entsendegesetz soll Mindeststandards und Löhne sichern, um Lohndumping und Missbrauch der Dienstleistungsfreizügigkeit zu verhindern.
Was ist die Bolkestein-Direktive?
Eine umstrittene EU-Dienstleistungsrichtlinie, die den grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr vereinfachen sollte, aber Befürchtungen hinsichtlich des Herkunftslandprinzips auslöste.
Welche Länder traten 2004 der EU bei?
Estland, Lettland, Litauen, Polen, die Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn, Malta und Zypern.
- Quote paper
- Mathias Kunze (Author), 2006, EU-Osterweiterung - Die Arbeitnehmer- und Dienstleistungsfreizügigkeit in der Praxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/91076