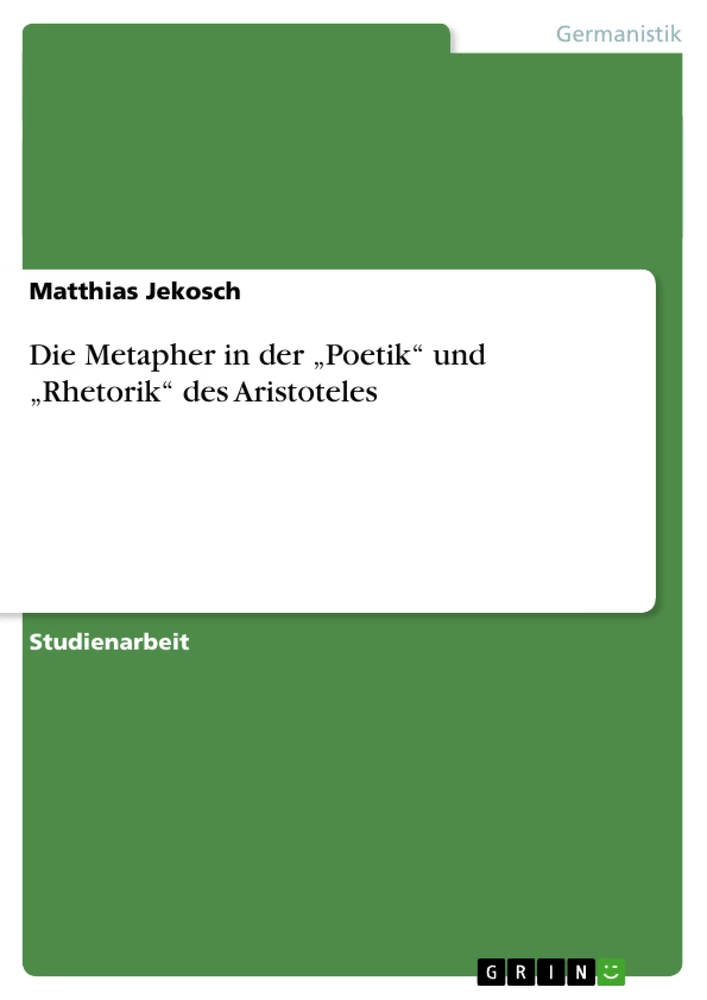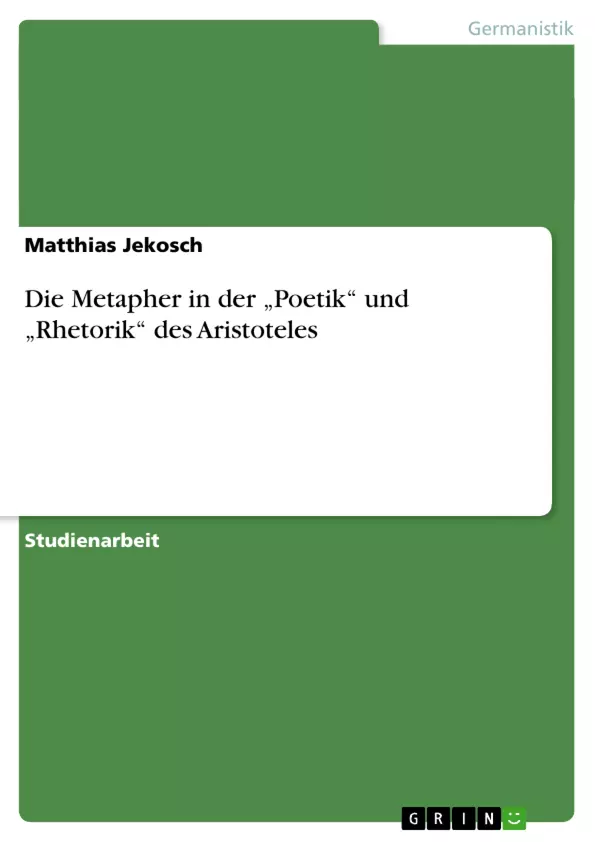Bekannt und verbreitet in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Metapher ist inzwischen die Aussage von Anselm Haverkamp, dass es keine einheitliche Theorie der Metapher gebe, dass diese vielmehr „nur als Sammelname konkurrierender Ansätze“ auftritt. Vielen dieser Ansätze gemeinsam ist jedoch die Rezeption des aristotelischen Metaphernbegriffes, insbesondere die Substitutionstheorie und die Vergleichstheorie greifen auf ihn zurück. Kritiker wiederum bemängeln diese Ansätze und die Tradition, in der sie stehen, als veraltet und längst überholt. In dieser Arbeit soll anhand der Primärtexte Poetik und Rhetorik des griechischen Denkers dessen Metapherbegriff herausgearbeitet werden. Weiterhin soll davon ausgehend die Rezeption aufgegriffen und untersucht werden, um am Ende Probleme aber auch Chancen der über 2.300 Jahre alten Werke deutlich zu machen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vor Aristoteles
- Metapher in der „Poetik\" und der „,Rhetorik\"\
- Probleme mit der Rezeption des aristotelischen Metapherbegriffs
- Falsch oder Wahr?
- Metapher auf Wortebene?
- Metapher und Vergleich
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, anhand der Primärtexte Poetik und Rhetorik von Aristoteles dessen Metapherbegriff zu erarbeiten und zu untersuchen. Im Fokus steht die Rezeption des aristotelischen Metapherbegriffes, insbesondere die Substitutionstheorie und die Vergleichstheorie, sowie die damit verbundenen Probleme und Chancen.
- Der Metapherbegriff des Aristoteles in Poetik und Rhetorik
- Die Rezeption des aristotelischen Metapherbegriffes
- Probleme und Chancen der über 2.300 Jahre alten Werke
- Die Bedeutung von Aristoteles für die Metaphertheorie
- Der Einfluss des aristotelischen Metapherbegriffes auf die heutige Diskussion
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Metapherbegriff des Aristoteles und seiner Rezeption. Sie beleuchtet die beiden Primärtexte Poetik und Rhetorik und untersucht, wie der Metapherbegriff des griechischen Denkers in der wissenschaftlichen Diskussion bis heute rezipiert wird.
Vor Aristoteles
Der Abschnitt beleuchtet die Entwicklung der Metaphertheorie vor Aristoteles. Er stellt heraus, dass es vor Aristoteles keine einheitliche Theorie der Metapher gab und dass Aristoteles mit seiner Poetik Neuland betrat.
Metapher in der „Poetik\" und der „,Rhetorik\"
In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Stellen zur Metapher bei Aristoteles in Poetik und Rhetorik beleuchtet. Dabei wird der Fokus auf die Unterscheidung zwischen der Metapher in der schriftlichen und der oralen Kommunikation gelegt.
Probleme mit der Rezeption des aristotelischen Metapherbegriffs
Dieser Abschnitt befasst sich mit den kritischen Stimmen zur Rezeption des aristotelischen Metapherbegriffes. Er analysiert die Substitutionstheorie und die Vergleichstheorie sowie die Kritik an diesen Ansätzen.
Falsch oder Wahr?
In diesem Abschnitt wird die Frage nach der Wahrheit oder Falschheit der Metapher erörtert. Die Diskussion um die Metapher als "Falschheit" oder "Wahrheit" wird aus der Perspektive des aristotelischen Metapherbegriffes beleuchtet.
Metapher auf Wortebene?
Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Frage, ob die Metapher auf Wortebene funktioniert. Er analysiert, ob sich die Metapher auf einzelne Wörter bezieht oder auf einen umfassenderen sprachlichen Kontext.
Metapher und Vergleich
In diesem Abschnitt wird der Zusammenhang zwischen Metapher und Vergleich untersucht. Er beleuchtet die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden sprachlichen Figuren und deren Bedeutung für den aristotelischen Metapherbegriff.
Fazit
Dieser Abschnitt bietet eine zusammenfassende Betrachtung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen der Arbeit. Er beleuchtet die wichtigsten Erkenntnisse der Analyse des aristotelischen Metapherbegriffes und seiner Rezeption.
Schlüsselwörter
Aristoteles, Metapher, Poetik, Rhetorik, Substitutionstheorie, Vergleichstheorie, Rezeption, Sprache, Kommunikation, Wahrheit, Falschheit, Wortebene.
- Quote paper
- Matthias Jekosch (Author), 2005, Die Metapher in der „Poetik“ und „Rhetorik“ des Aristoteles, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/91099