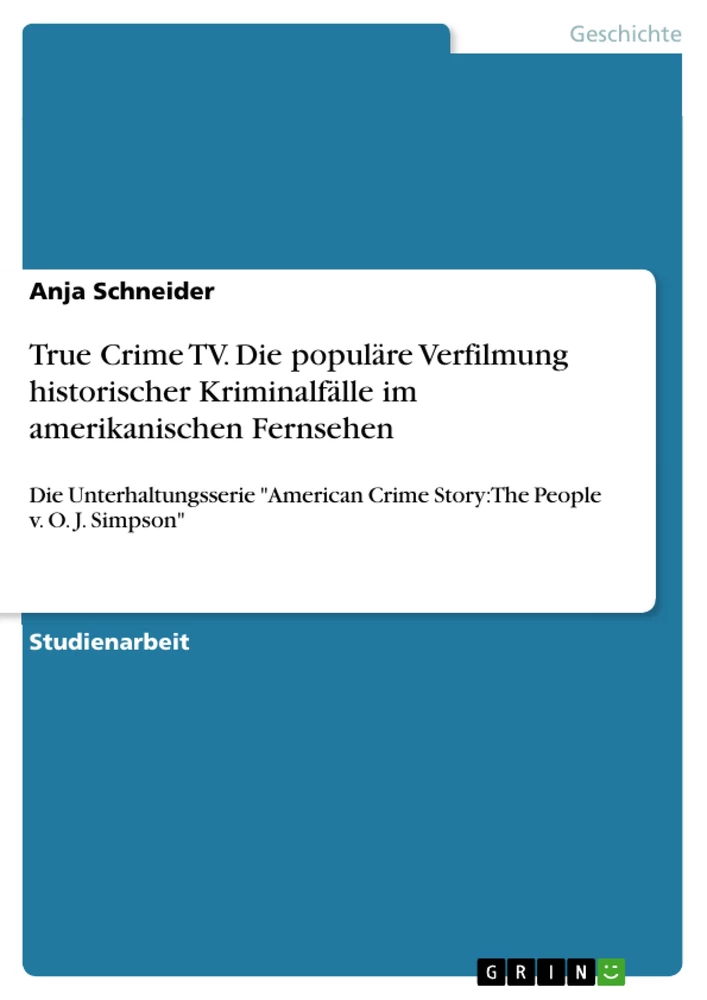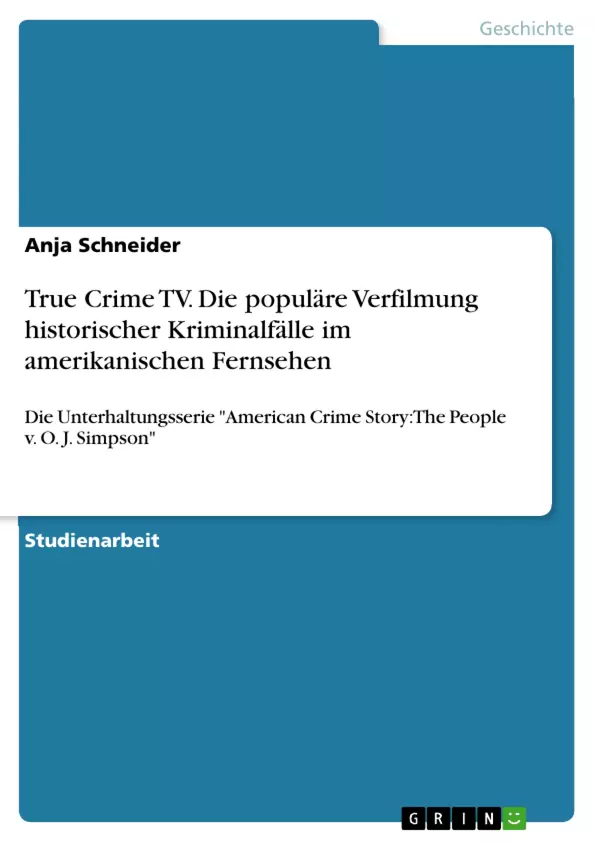Diese Arbeit befasst sich mit der Popularität von True Crime- Produktionen, die sich die Beliebtheit echter Verbrechen in den Medien für neue Serien zunutze machen. Betrachtet werden der Fall von O.J. Simpson, der in Amerika für große Medienaufmerksamkeit sorgte, und die zugehörige Verfilmung American Crime Story: The People v. O. J. Simpson.
Die Arbeit besteht aus der Betrachtung des Simpson-Falls und der Analyse der Verfilmung. Zunächst wird die gesellschaftliche Situation im Amerika der neunziger Jahre beleuchtet. Im Anschluss werden Fakten zu Kriminalfall und Gerichtsprozess dargelegt, wobei auf den Faktor Race und die Rolle der Medienberichterstattung eingegangen wird.
Anschließend wird eine Einführung in das True Crime TV gegeben und der Trend der Neuverfilmung vergangener Kriminalfälle kritisch beleuchtet. Dazu wird die FX-Serie ACS vergleichend zu den realen Ereignissen betrachtet. Hierbei wird nach einem kurzen Überblick über die Produktion die neunte Folge „Manna vom Himmel” in den Fokus gestellt und mit Quellen aus dem historischen Geschehen verglichen. Die leitenden Fragen sind hier, ob die Serie die tatsächlichen Gegebenheiten wiedergibt, ob jene zu Unterhaltungszwecken verändert werden und wenn ja, inwiefern und warum.
Als Vergleich zur Serie werden Mitschnitte aus dem Gerichtssaal und zeitgenössische Zeitungsartikel und Bücher der Beteiligten über den Prozess als Quellen verwendet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Fall O.J. Simpson
- Historischer Kontext
- Ablauf der Ereignisse
- Medienberichterstattung
- American Crime Story: The People v. O. J. Simpson
- True Crime Television
- American Crime Story - Überblick
- Manna vom Himmel
- Rezeption
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Popularität von True Crime-Produktionen, die sich die Beliebtheit echter Verbrechen in den Medien für neue Serien zunutze machen. Betrachtet werden der Fall des O.J. Simpson, der in den neunziger Jahren in Amerika für große Medienaufmerksamkeit sorgte, und die zugehörige Verfilmung American Crime Story: The People v. O. J. Simpson. Die Arbeit untersucht, wie die Serie die realen Ereignisse wiedergibt und ob diese zu Unterhaltungszwecken verändert werden.
- Der Fall O.J. Simpson und seine Bedeutung im Kontext der amerikanischen Gesellschaft der neunziger Jahre
- Die Rolle der Medienberichterstattung im Simpson-Prozess
- Der Aufstieg des True Crime-Genres im amerikanischen Fernsehen
- Die Darstellung des Simpson-Falls in American Crime Story und dessen Vergleich zu den realen Ereignissen
- Die Frage, ob und inwiefern die Serie die tatsächlichen Gegebenheiten zu Unterhaltungszwecken verändert
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung erläutert die Popularität des True Crime-Genres im amerikanischen Fernsehen und die Bedeutung des Falls O.J. Simpson als Beispiel für die Verfilmung realer Kriminalfälle.
- Der Fall O.J. Simpson - Historischer Kontext: Dieses Kapitel beleuchtet die gesellschaftliche Situation in den USA der neunziger Jahre, insbesondere die Themen Rassismus, Polizeibrutalität und Medienberichterstattung.
- Der Fall O.J. Simpson - Ablauf der Ereignisse: Dieses Kapitel bietet eine Zusammenfassung des Falls O.J. Simpson, der im Zentrum der Hausarbeit steht. Hier werden die wichtigsten Ereignisse und die Rolle des Faktors Race im Kontext des Prozesses hervorgehoben.
- American Crime Story: The People v. O. J. Simpson - True Crime Television: Dieses Kapitel liefert eine Einführung in das Genre True Crime TV und beleuchtet den Trend der Neuverfilmung vergangener Kriminalfälle.
- American Crime Story: The People v. O. J. Simpson - Überblick: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die FX-Serie American Crime Story und vergleicht sie mit den realen Ereignissen.
- American Crime Story: The People v. O. J. Simpson - Manna vom Himmel: Dieses Kapitel fokussiert auf die neunte Folge der Serie „Manna vom Himmel“ und vergleicht sie mit Quellen aus dem historischen Geschehen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen dieser Hausarbeit sind der Fall O.J. Simpson, True Crime Television, American Crime Story, Medienberichterstattung, Rassismus, Polizeibrutalität, Gerichtsprozess und die Darstellung historischer Kriminalfälle in Unterhaltungssendungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus dieser Hausarbeit zu "True Crime TV"?
Die Arbeit untersucht die Popularität von True-Crime-Produktionen am Beispiel des Falls O.J. Simpson und dessen Verfilmung in der Serie "American Crime Story".
Welche Rolle spielt der Faktor "Race" in der Analyse?
Die Arbeit beleuchtet den historischen Kontext der neunziger Jahre in den USA, insbesondere Themen wie Rassismus und Polizeibrutalität, die den Simpson-Prozess maßgeblich beeinflussten.
Wie vergleicht die Arbeit die TV-Serie mit der Realität?
Es werden Mitschnitte aus dem Gerichtssaal, zeitgenössische Zeitungsartikel und Bücher der Prozessbeteiligten herangezogen, um die Darstellung in der Serie kritisch zu prüfen.
Was wird in der Episode „Manna vom Himmel“ besonders untersucht?
In dieser Folge steht der Vergleich zwischen den filmischen Mitteln zur Unterhaltung und den tatsächlichen historischen Gegebenheiten des Prozesses im Vordergrund.
Was versteht man unter dem Genre "True Crime TV"?
Es handelt sich um ein Genre, das reale Kriminalfälle filmisch aufarbeitet, wobei oft die Grenze zwischen dokumentarischer Genauigkeit und fiktionaler Unterhaltung verschwimmt.
Welche Leitfrage verfolgt die Analyse der Serie "American Crime Story"?
Die zentrale Frage ist, ob und inwiefern reale Ereignisse zu Unterhaltungszwecken verändert wurden und welche Auswirkungen dies auf die Wahrnehmung des Falls hat.
- Quote paper
- Anja Schneider (Author), 2019, True Crime TV. Die populäre Verfilmung historischer Kriminalfälle im amerikanischen Fernsehen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/912106