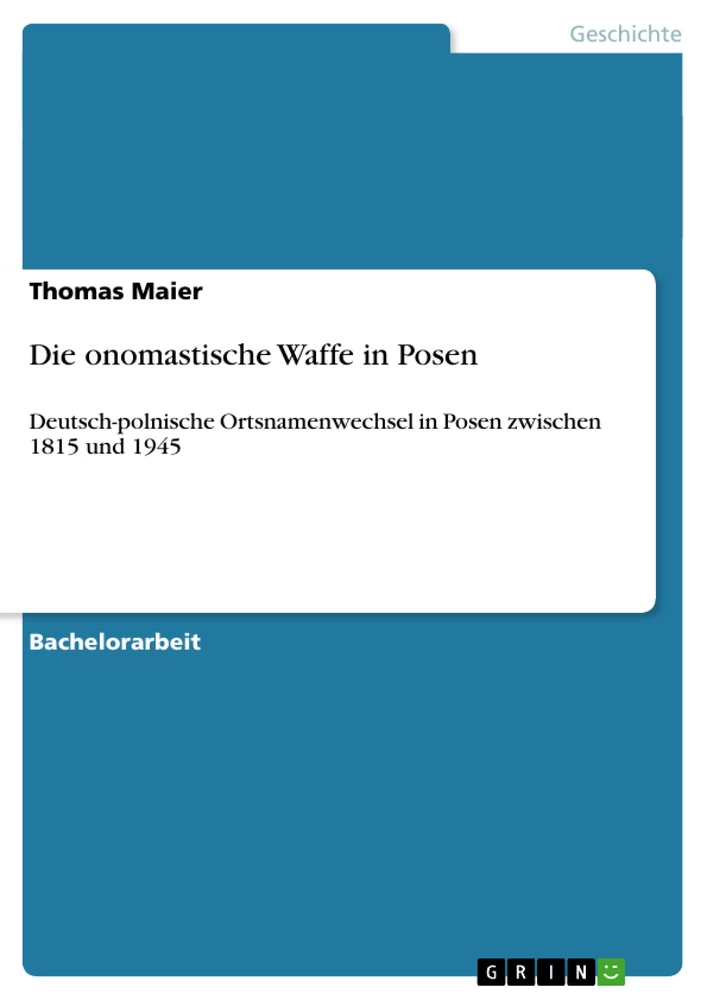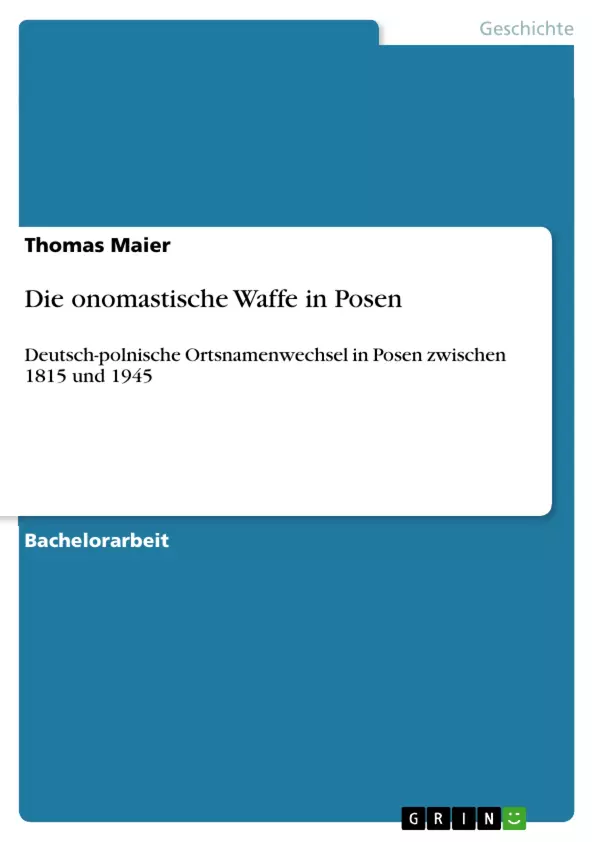Gegenstand dieser Arbeit soll die Ortsnamenpolitik in dem heute in Polen gelegenen Gebiet Posen sein, in welchem als „Raum nationaler Konfrontation“ im Wechsel zwischen deutschen und polnischen Machthabern seit 1815 viermal Ortsnamen geändert wurden. Dabei geht es um die Ideologien und deren Durchführung seitens der Herrschenden, sowie den Vergleich untereinander mit der Frage, ob die jeweils gesetzten Ziele erreicht wurden. Betrachtet werden daher weniger die konkreten Namenwechsel oder die Benutzung der Namen durch die Bevölkerung, sondern ihre Festsetzung seitens der Herrschenden.
Eine besondere Bedeutung erhält die im Titel erwähnte Idee der ‚onomastischen Waffe’, deren Anwendungsmöglichkeiten im Posener Gebiet herausgearbeitet und bewertet werden. Einen Schwerpunkt nimmt in diesem Zusammenhang die Analyse der deutschen Besatzer ein, da hier vermutet wird, dass sie, ausgehend von Geschichte und Bevölkerung, die eigentlichen ‚Fremden’ in der Region waren und wahrscheinlich nicht auf eine eigene Ortsnamenlandschaft zurückgreifen konnten. Wie und warum sie trotzdem eine schaffen wollten, soll diese Arbeit darstellen.
Ausgehend von einer Arbeitsdefinition zu Ortsnamen und ihren Wechseln, wird die Ortsnamenpolitik Preußens, Polens nach 1918, der Nationalsozialisten und Polens nach 1945 im Gebiet um Posen vorgestellt. Um auf umfangreicheres Material polnischer Ortsnamenpolitik zurückzugreifen, werden für die Zeit ab 1945 die Ereignisse auf den neupolnischen West- und Nordgebiete betrachtet, auch wenn Posen nicht zu diesen gehörte. Den Einzelausarbeitungen vorangestellt, erfolgt jeweils eine geschichtliche, politische und geographische Einordnung, was besonders aus dem Grund von Bedeutung ist, da es sich nicht jeweils um ein deckungsgleiches Gebiet handelt, jedoch bei allen die Stadt Posen den Mittelpunkt der politischen und gesellschaftlichen Kräfte bildet. Im Vergleichskapitel werden Zielstellungen, Durchführung und Kriterien neuer Ortsnamen zwischen den Machthabern verglichen und anhand eines kleinen Namenkorpus des Kreises Schrimm an Beispielen festgemacht. Der Begriff der onomastischen Waffe wird im Schlussteil wieder aufgegriffen, in welchem die in der Einleitung aufgeworfenen Fragen beantwortet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Ortsnamen und die onomastische Waffe
- 2.1 Ortsnamen und Ortsnamenwechsel
- 2.2 Die onomastische Waffe
- 3. Die Provinz Posen zwischen 1815 und 1918
- 3.1 Die polnische Frage
- 3.2 Ortsnamenpolitik in Posen
- 4. Die Woiwodschaft Poznań zwischen 1918 und 1939
- 4.1 Der neue polnische Staat
- 4.2 Ortsnamenpolitik
- 5. Das Reichsgau Wartheland von 1939 bis 1945
- 5.1 Die nationalsozialistische Siedlungspolitik
- 5.2 Ortsnamenpolitik im Reichsgau Wartheland
- 6. Polnische Ortsnamenänderungen nach 1945
- 6.1 Die polnische Westverschiebung
- 6.2 Ortsnamenpolitik in den wiedergewonnenen Gebieten
- 7. Ortsnamenwechsel im Vergleich
- 7.1 Vergleich der Machthaber
- 7.2 Änderungen im Kreis Schrimm
- 8. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ortsnamenpolitik im Gebiet von Posen zwischen 1815 und 1945, einem Raum nationaler Konfrontation unter wechselnden deutschen und polnischen Machthabern. Ziel ist die Analyse der ideologischen Grundlagen und der praktischen Umsetzung der Ortsnamenänderungen durch die jeweiligen Herrscher, sowie ein Vergleich der erzielten Ergebnisse. Der Fokus liegt auf der "onomastischen Waffe" als Instrument der politischen Macht und Identitätsbildung.
- Analyse der Ortsnamenpolitik in Posen unter preußischer, polnischer und nationalsozialistischer Herrschaft.
- Untersuchung der "onomastischen Waffe" als Mittel der politischen und kulturellen Einflussnahme.
- Vergleich der Strategien und Ziele der verschiedenen Machthaber in Bezug auf die Ortsnamenänderung.
- Bewertung des Erfolgs der jeweiligen Ortsnamenpolitik.
- Einordnung der Ortsnamenwechsel in den historischen und politischen Kontext.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der onomastischen Waffe ein und beschreibt den politischen Willen, durch Ortsnamenwechsel die Geschichte und Identität einer Kulturlandschaft zu beeinflussen. Der Fokus liegt auf der Ortsnamenpolitik in Posen als Raum nationaler Konfrontation, wobei die Ideologien und deren Umsetzung der verschiedenen Machthaber untersucht werden. Die Arbeit betont die Bedeutung der "onomastischen Waffe", insbesondere im Hinblick auf die deutsche Besatzungspolitik und die Frage, warum die Deutschen trotz ihrer vermeintlichen Fremdheit in der Region eine eigene Ortsnamenlandschaft schaffen wollten. Die Einleitung hebt die Forschungslücke bezüglich umfassender Analysen von Ortsnamenwechseln hervor und beschreibt den Ansatz der vorliegenden Arbeit, der einen Vergleich verschiedener Machthaber und deren Ortsnamenpolitik beinhaltet. Die langfristige Wirkung vergangener Ortsnamenwechsel, zum Beispiel durch die Verwendung nationalsozialistischer Ortsnamen durch deutsche Landsmannschaften, wird ebenfalls angesprochen.
2. Ortsnamen und die onomastische Waffe: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Ortsname" und beleuchtet den Aspekt der Ortsnamenwechsel. Es wird erläutert, dass Ortsnamen nicht nur eine funktionale, sondern auch eine soziale Bedeutung haben, die mit einem Ort, einer Zeit und den Menschen verbunden ist, die den Namen geben, überliefern und verwenden. Unter Verwendung des semiotischen Dreiecks wird gezeigt, wie Ortsnamen wertgeladene Assoziationen hervorrufen, die Teil der Identität eines Menschen und seiner Heimat werden können. Das Kapitel betont, dass Ortsnamen nicht statisch sind, sondern sich wie andere sprachliche Elemente verändern und anpassen können. Der Begriff des Ortsnamenwechsels wird definiert als die Aufgabe eines alten und die Annahme eines neuen Namens.
3. Die Provinz Posen zwischen 1815 und 1918: Dieses Kapitel behandelt die politische und gesellschaftliche Situation in der Provinz Posen während der preußischen Herrschaft. Es wird die "polnische Frage" beleuchtet und die damit verbundene Ortsnamenpolitik untersucht. Die Zusammenfassung würde detailliert auf die preußischen Strategien zur Germanisierung der Region eingehen und konkrete Beispiele für die Umsetzung der Ortsnamenpolitik nennen.
4. Die Woiwodschaft Poznań zwischen 1918 und 1939: Hier wird die Zeit der zweiten polnischen Republik in Posen betrachtet. Die Zusammenfassung würde den Fokus auf die polnische Perspektive legen und die Maßnahmen zur Polonisierung der Region, inklusive der damit einhergehenden Ortsnamenpolitik, detailliert beschreiben. Der Zusammenhang zwischen der Wiedererlangung der Unabhängigkeit Polens und den entsprechenden Veränderungen in der Ortsnamengebung wäre ein wichtiger Aspekt.
5. Das Reichsgau Wartheland von 1939 bis 1945: Dieser Abschnitt befasst sich mit der nationalsozialistischen Herrschaft im Wartheland. Die Zusammenfassung würde die nationalsozialistische Siedlungspolitik und die damit verbundene gewaltsame Umsiedlung der polnischen Bevölkerung sowie die systematische Umgestaltung der Ortsnamen im Kontext der "Germanisierung" detailliert analysieren. Die Rolle der ideologischen Motivation in der nationalsozialistischen Ortsnamenpolitik wäre ein Schwerpunkt.
6. Polnische Ortsnamenänderungen nach 1945: Dieses Kapitel behandelt die Veränderungen der Ortsnamen nach dem Zweiten Weltkrieg, im Zusammenhang mit der polnischen Westverschiebung und der Rückeroberung der Gebiete. Die Zusammenfassung würde die polnische Ortsnamenpolitik nach dem Krieg beschreiben und die Ziele und Methoden dieser Politik im Kontext der Neuordnung der Grenzen und der gesellschaftlichen Transformation beleuchten.
7. Ortsnamenwechsel im Vergleich: Dieser Abschnitt zieht einen Vergleich der Ortsnamenpolitik der verschiedenen Machthaber (Preußen, Polen, NS-Regime, Polen nach 1945) und analysiert die Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihrer Strategien und Ziele. Ein genauer Vergleich der angewendeten Methoden und die Ergebnisse im Kreis Schrimm würden detailliert dargestellt werden. Die Zusammenfassung würde die Ergebnisse dieses Vergleichs zusammenfassen und die langfristigen Folgen der verschiedenen Ortsnamenpolitiken beleuchten.
Schlüsselwörter
Ortsnamenpolitik, Posen, Poznań, Deutsch-polnische Beziehungen, onomastische Waffe, Nationalsozialismus, Preußen, Polonisierung, Germanisierung, Siedlungspolitik, Identität, Heimat, Sprachpolitik.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu: Ortsnamenpolitik in Posen (1815-1945)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Ortsnamenpolitik im Gebiet von Posen zwischen 1815 und 1945 unter preußischer, polnischer und nationalsozialistischer Herrschaft. Der Fokus liegt auf der „onomastischen Waffe“ als Instrument der politischen Macht und Identitätsbildung und vergleicht die Strategien und Ziele der verschiedenen Machthaber.
Welche Zeiträume werden untersucht?
Die Arbeit umfasst die Zeiträume von 1815 bis 1918 (Preußische Provinz Posen), 1918 bis 1939 (Woiwodschaft Poznań), 1939 bis 1945 (Reichsgau Wartheland) und die polnische Ortsnamenpolitik nach 1945.
Welche Machthaber werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Ortsnamenpolitik Preußens, Polens (zweite Republik und nach 1945) und des nationalsozialistischen Deutschlands.
Was versteht man unter der „onomastischen Waffe“?
Die „onomastische Waffe“ beschreibt die gezielte Änderung von Ortsnamen als Instrument der politischen und kulturellen Einflussnahme. Ortsnamen werden als wertgeladene Symbole betrachtet, die mit der Identität einer Bevölkerungsgruppe und ihrer Heimat verbunden sind. Der Wechsel von Ortsnamen dient dazu, diese Identität zu beeinflussen oder zu zerstören.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Ortsnamen und die onomastische Waffe, Die Provinz Posen (1815-1918), Die Woiwodschaft Poznań (1918-1939), Das Reichsgau Wartheland (1939-1945), Polnische Ortsnamenänderungen nach 1945 und Ortsnamenwechsel im Vergleich. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit analysiert die ideologischen Grundlagen und die praktische Umsetzung der Ortsnamenänderungen. Sie untersucht die Strategien und Ziele der verschiedenen Machthaber, vergleicht deren Erfolg und ordnet die Ortsnamenwechsel in den historischen und politischen Kontext ein. Ein besonderer Fokus liegt auf der „onomastischen Waffe“ im Kontext der deutschen Besatzungspolitik und der langfristigen Wirkung vergangener Ortsnamenwechsel.
Wie werden die Ortsnamenwechsel im Vergleich dargestellt?
Das Kapitel „Ortsnamenwechsel im Vergleich“ analysiert Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Strategien und Ziele der verschiedenen Machthaber. Es wird ein detaillierter Vergleich der angewendeten Methoden und der Ergebnisse, u.a. im Kreis Schrimm, durchgeführt. Die langfristigen Folgen der verschiedenen Ortsnamenpolitiken werden beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ortsnamenpolitik, Posen, Poznań, Deutsch-polnische Beziehungen, onomastische Waffe, Nationalsozialismus, Preußen, Polonisierung, Germanisierung, Siedlungspolitik, Identität, Heimat, Sprachpolitik.
Wo liegt der Fokus der Kapitelzusammenfassungen?
Die Kapitelzusammenfassungen geben einen Überblick über den jeweiligen historischen Kontext und die spezifische Ortsnamenpolitik der jeweiligen Machthaber. Sie beleuchten die Strategien, Ziele und Methoden sowie die Ergebnisse der jeweiligen Maßnahmen.
- Quote paper
- Thomas Maier (Author), 2006, Die onomastische Waffe in Posen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/91435