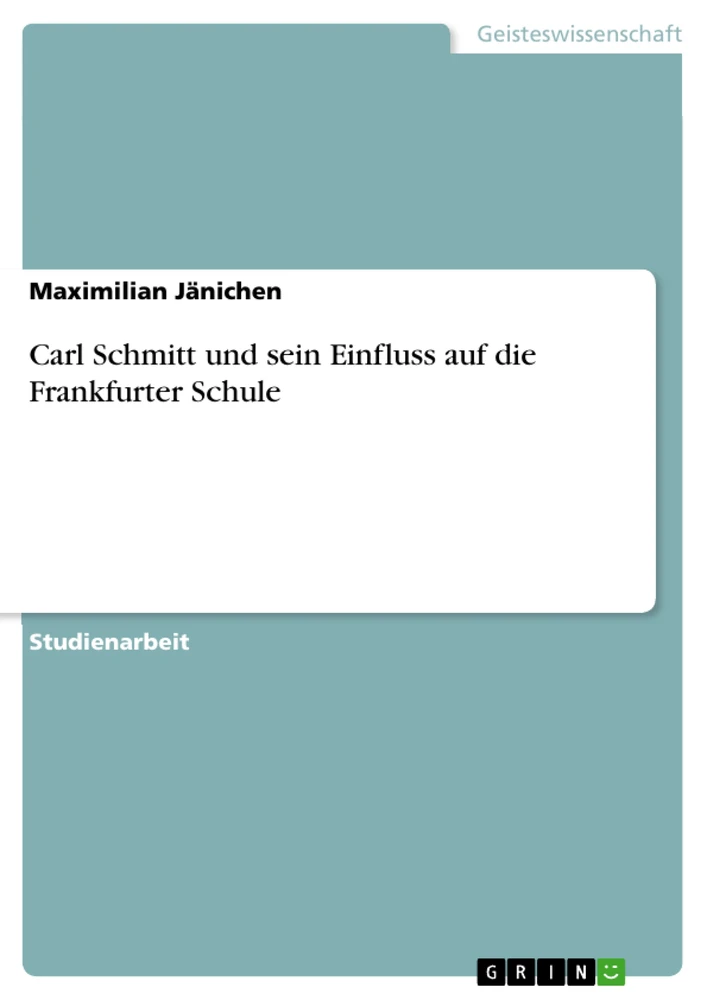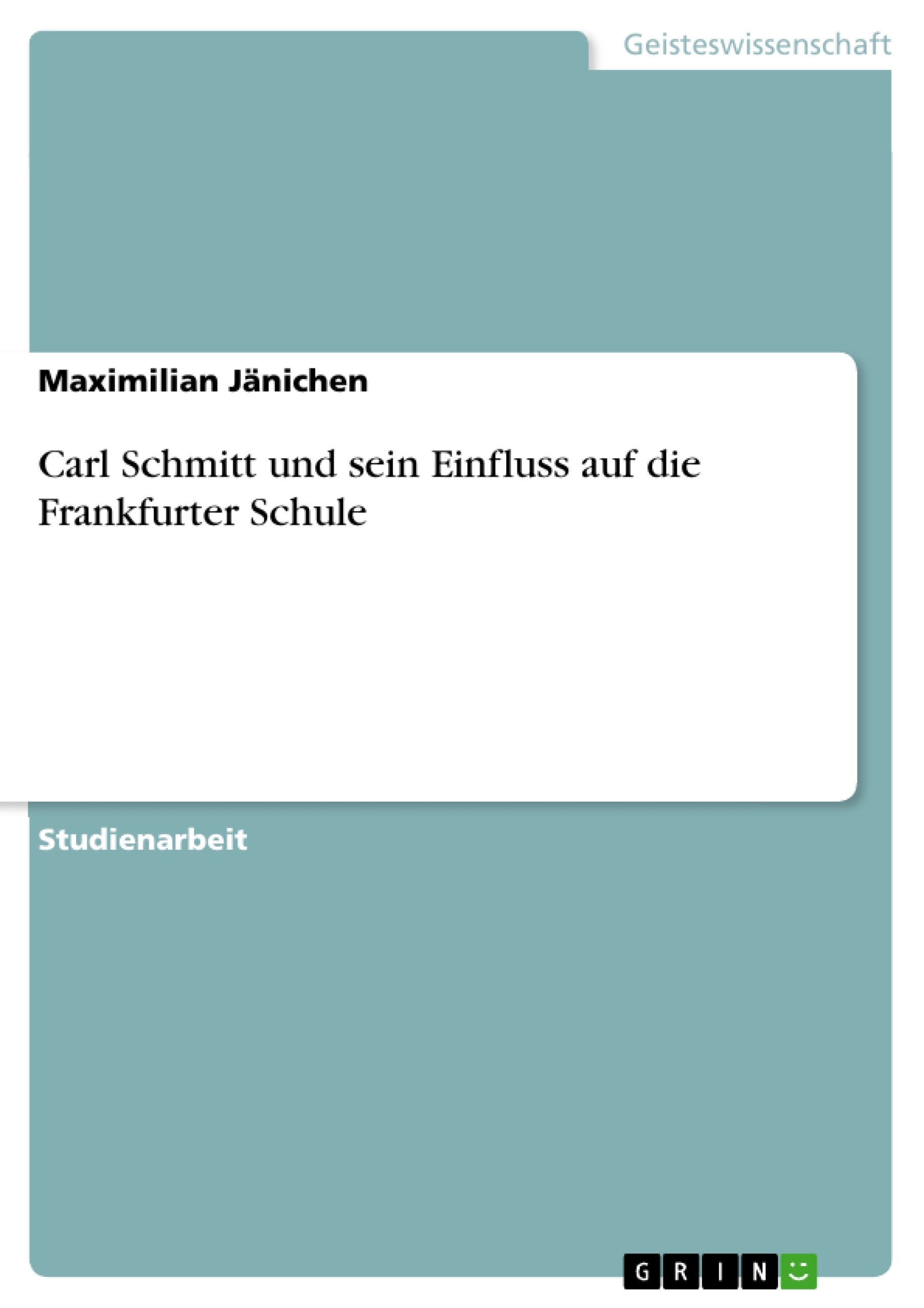Lässt sich ein "Links-Schmittianismus" innerhalb der Frankfurter Schule nachweisen? Diese Frage wurde in den 80er Jahren durch einen Aufsatz von Ellen Kennedy kontrovers diskutiert. Noch heute verfügt die Person Carl Schmitt in gewissen Kreisen über eine Anziehungskraft.
Die Arbeit will sich im ersten Teil mit den Thesen, die Ellen Kennedy in ihrem Aufsatz "Carl Schmitt und die Frankfurter Schule. Deutsche Liberalismuskritik im 20. Jahrhundert" aufgeworfen hat, auseinandersetzen. Diesen Thesen sollen dann jeweils verschiedene Gegenpositionen aus der Literatur und eigene Positionen gegenübergestellt werden. Im Schlussteil sollen die Erkenntnisse zusammengefasst werden. Zudem soll eine kurze Skizze erstellt werden, inwieweit Carl Schmitt im aktuellen politischen Diskurs wieder an Bedeutung gewinnt.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Kennedys These der Schmitt-Rezeption
- 1. Benjamin und Schmitt
- 2. Kirchheimer und Schmitt
- 3. Habermas und Schmitt
- 3.1 Demokratie bei Habermas und Schmitt
- 3.2 Legalität und Legitimität bei Habermas und Schmitt
- III. Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der These von Ellen Kennedy, die in einem Aufsatz von 1986 die Frage aufwirft, ob die „Frankfurter Schule“ von Carl Schmitts Ideen beeinflusst wurde. Die Arbeit analysiert Kennedys Argumentation anhand von Beispielen aus dem Werk von Walter Benjamin, Otto Kirchheimer und Jürgen Habermas, um herauszufinden, ob sich eine Rezeption von Schmitts Theorien in deren Schriften tatsächlich nachweisen lässt.
- Die Rolle von Carl Schmitt in der frühen Bundesrepublik Deutschland
- Die These des „Links-Schmittianismus“ und die „Frankfurter Schule“
- Die Rezeption von Schmitts Theorien in der politischen Philosophie
- Die Debatte um die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Argumentationen von Schmitt und den Theoretikern der „Frankfurter Schule“
- Der Einfluss von Schmitts Theorien auf den heutigen politischen Diskurs
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Die Einleitung stellt die Person Carl Schmitt und seine Bedeutung für den wissenschaftlichen Diskurs in der Bundesrepublik Deutschland vor. Sie erklärt die Faszination, die von Schmitt ausging, und stellt die These von Ellen Kennedy vor, die sich mit der Frage beschäftigt, ob die „Frankfurter Schule“ von Schmitts Ideen beeinflusst wurde.
II. Kennedys These der Schmitt-Rezeption
1. Benjamin und Schmitt
Dieser Abschnitt analysiert Kennedys Argumentation bezüglich einer Rezeption von Schmitt bei Walter Benjamin. Die Arbeit geht auf Kennedys zentrale Argumente ein, wie beispielsweise den Brief von Benjamin an Schmitt und die streitigen Vorgänge bei der Herausgabe des Buches „Der Ursprung des deutschen Trauerspieles“. Auch Kritiker der These von Kennedy, wie beispielsweise Martin Jay und Alfons Söllner, werden in diesem Zusammenhang behandelt.
2. Kirchheimer und Schmitt
Dieser Abschnitt soll die Argumentation von Kennedy bezüglich einer Rezeption von Schmitt bei Otto Kirchheimer analysieren. Die Arbeit wird auf Kennedys zentrale Argumente eingehen, wie beispielsweise die Gemeinsamkeiten in den Argumentationen von Schmitt und Kirchheimer zum Thema Demokratie und die Rolle des Staates. Auch Kritiker der These von Kennedy, die beispielsweise argumentieren, dass Kirchheimers Kritik am Liberalismus unabhängig von Schmitt entstanden ist, werden in diesem Zusammenhang behandelt.
3. Habermas und Schmitt
Dieser Abschnitt untersucht Kennedys Argumentation bezüglich einer Rezeption von Schmitt bei Jürgen Habermas. Die Arbeit wird auf Kennedys zentrale Argumente eingehen, wie beispielsweise die Gemeinsamkeiten in den Argumentationen von Schmitt und Habermas zum Thema Demokratie, Legalität und Legitimität. Auch Kritiker der These von Kennedy, die beispielsweise argumentieren, dass Habermas sich von Schmitts Konzepten distanziert, werden in diesem Zusammenhang behandelt.
Schlüsselwörter
Carl Schmitt, Frankfurter Schule, Liberalismuskritik, Rechtsphilosophie, Politische Theorie, Demokratie, Legalität, Legitimität, Walter Benjamin, Otto Kirchheimer, Jürgen Habermas, „Links-Schmittianismus“, Ellen Kennedy, Theodor W. Adorno, Ernst-Wolfgang Böckenförde.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Debatte um den „Links-Schmittianismus“?
Es geht um die Frage, ob Denker der Frankfurter Schule (wie Benjamin oder Habermas) trotz politischer Gegensätze Theorien des konservativen Staatsrechtlers Carl Schmitt rezipiert haben.
Wer war Ellen Kennedy und was war ihre These?
Ellen Kennedy löste in den 80ern eine Kontroverse aus, indem sie behauptete, dass die Liberalismuskritik der Frankfurter Schule maßgeblich von Carl Schmitt beeinflusst wurde.
Welche Verbindung gibt es zwischen Walter Benjamin und Carl Schmitt?
Kennedy verweist auf einen Brief Benjamins an Schmitt und auf Ähnlichkeiten in ihren Theorien zum Ausnahmezustand und zur Souveränität.
Wurde auch Jürgen Habermas von Schmitt beeinflusst?
Kennedy sieht Parallelen in der Diskussion um Legalität und Legitimität, während Kritiker betonen, dass Habermas sich deutlich von Schmitts antiliberalen Konzepten distanziert.
Warum ist Carl Schmitt heute noch relevant?
Seine Analysen zur Macht, zum Politischen und zur Krise des Parlamentarismus gewinnen in aktuellen politischen Diskursen weltweit wieder an Bedeutung.
- Citation du texte
- Maximilian Jänichen (Auteur), 2019, Carl Schmitt und sein Einfluss auf die Frankfurter Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/916083