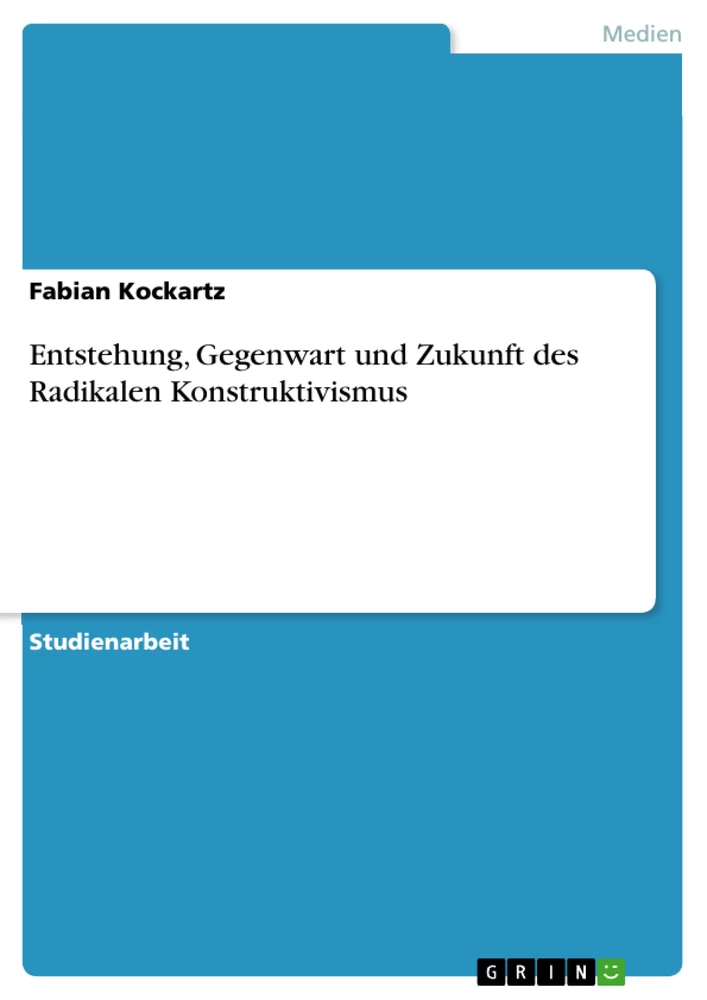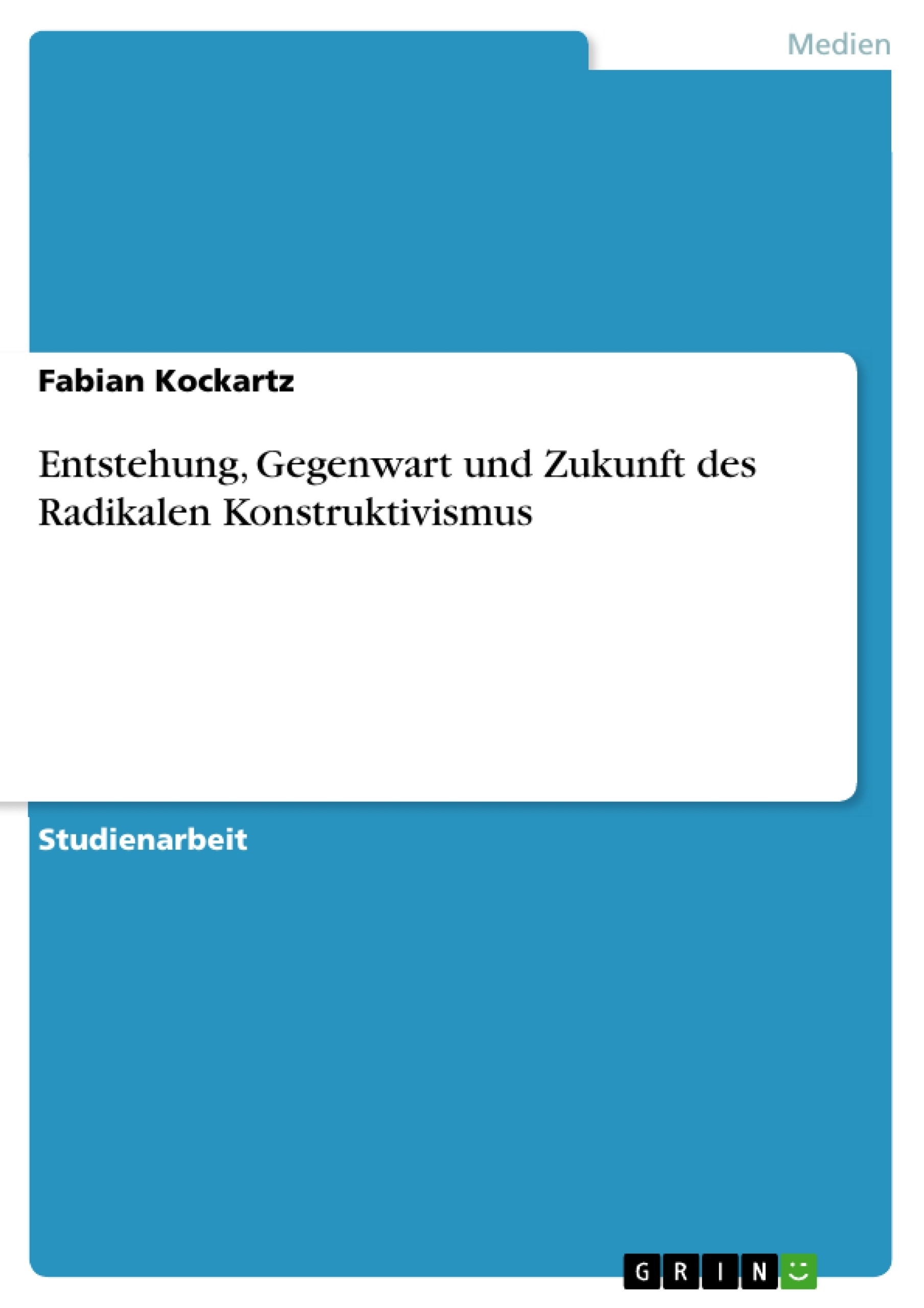Die vorliegende Arbeit behandelt die recht junge Theorie des Radikalen Konstruktivismus. Diese spezielle Art des konstruktivistischen Denkens entstand Mitte der 70er Jahre des 20. Jh. und schlug „große Wellen“, die über die Scientific Community hinaus bis in die Alltagsvorstellungen der Menschen reichten.
Im wissenschaftlichen Bereich bedeuteten die neuen, skeptisch geprägten, Überlegungen und Postulate der Anhänger des Radikalen Konstruktivismus (RK) zwar keinen Paradigmenwechsel, sie sorgten allerdings gerade in den Medien- und Kommunikationswissenschaften nachhaltig für große Veränderungen in Bezug auf Theorien- und Modellbildungen. Der RK lieferte beispielsweise die Grundlagen für die Entwicklung eines komplett neuen Konzepts zur Bestimmung und Analyse von Kommunikations- und Medienereignissen. In wie weit beeinflussen Medien das Erkennen und die Vorstellung der Wirklichkeit? Für diese und ähnliche zentrale Fragen in den Medienwissenschaften gab der RK neue Antwortmöglichkeiten, die klassische, behavioristische Erklärungen (scheinbar) obsolet machten.
Ziel der Arbeit ist es, die wichtigsten Kritikpunkte am RK aufzuzeigen und daraus Ansätze zu entwickeln, die sich auf die zukünftige Entwicklung dieses Diskurses beziehen.
Da ich der Auffassung bin, dass man sich im Zuge von wissenschaftlichen Diskursen durchaus einer objektiven Wahrheit (zumindest) annähern kann und ich diesen Anspruch auch in den folgenden Ausführungen vertrete, lässt sich die Position, die ich in dieser Arbeit einnehme, als realistisch bezeichnen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Wurzeln des Radikalen Konstruktivismus
- Die Vorsokratiker
- Giambattista Vico
- Jean Piaget
- Kybernetik und Systemtheorie
- Hirnforschung
- Der Radikale Konstruktivismus - Viabilität als Maßstab des Handelns
- Wissenschaft verläuft in Kontroversen - Kritik am Radikalen Konstruktivismus
- Das Problem der Viabilität als Maßstab des Handelns
- Das Argument des ethischen Vorteils
- Selbstanwendung und Selbstwiderlegung
- Zukunftskonstruktionen
- Solide Grundlage schaffen
- Realen Gegner benennen
- Entglorifizierung von Trivialem
- Zentrale Begriffe und Sachverhalte klären
- Mehr Homogenität
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit setzt sich mit der Entstehung, Gegenwart und Zukunft des Radikalen Konstruktivismus auseinander. Ziel ist es, die wichtigsten Kritikpunkte am Radikalen Konstruktivismus aus realistischer Sicht aufzuzeigen und daraus Ansätze für die zukünftige Entwicklung des Diskurses abzuleiten.
- Die Wurzeln des Radikalen Konstruktivismus in verschiedenen Disziplinen
- Die zentrale Rolle der Viabilität als Maßstab des Handelns im Radikalen Konstruktivismus
- Kritische Analyse der Konzepte und Argumente des Radikalen Konstruktivismus
- Entwicklung von Vorschlägen für die zukünftige Entwicklung des Diskurses
- Die Auseinandersetzung mit der Frage nach der Objektivität von Wissen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einführung in das Thema und stellt die Grundannahmen des Radikalen Konstruktivismus vor. Kapitel zwei beleuchtet die historischen Wurzeln des Radikalen Konstruktivismus und zeigt die Einflüsse von verschiedenen Denkern und Disziplinen auf. Im dritten Kapitel wird die zentrale Rolle der Viabilität als Maßstab des Handelns im Radikalen Konstruktivismus erläutert. In Kapitel vier werden die wichtigsten Kritikpunkte am Radikalen Konstruktivismus dargestellt, und Kapitel fünf befasst sich mit der zukünftigen Entwicklung des Diskurses und gibt Ansätze für eine weiterführende Diskussion.
Schlüsselwörter
Radikale Konstruktivismus, Viabilität, Erkenntnistheorie, Realismus, Objektivität, Kritik, Wissenschaft, Zukunftskonstruktionen, Interdisziplinarität, Medienwissenschaften, Kommunikation, Modellbildung.
- Arbeit zitieren
- Fabian Kockartz (Autor:in), 2002, Entstehung, Gegenwart und Zukunft des Radikalen Konstruktivismus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/9160