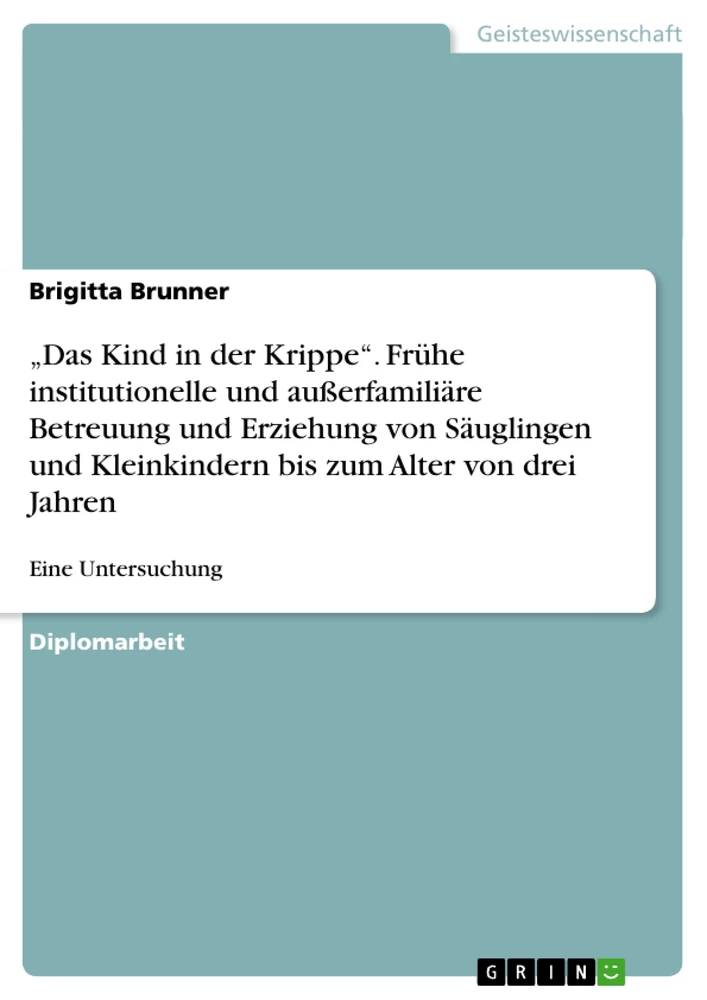Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, ob die Erziehung und Betreuung in einer Kinderkrippe den Bedürfnissen eines Kleinkindes entspricht und eine gesunde Entwicklung ermöglicht.
Nach der Schaffung von Grundlagen, besonders hinsichtlich der aktuellen Situation in Deutschland, werden verschiedene wissenschaftliche Bereiche bezüglich des Themas beleuchtet und am Ende jeweils mit einem Resümee abgeschlossen. Jede eigene Abhandlung und jedes Resümee zeigen verschiedene schwerwiegende Risiken einer Krippenerziehung auf, da diese Art der Erziehung und Betreuung den Bedürfnissen des Kleinkindes in den wichtigsten Bereichen nicht gerecht wird.
Nach diesem Block werden zur Veranschaulichung verschiedene Konzeptionen vor- und gegenübergestellt.
Das Ergebnis ist, dass eine optimale Erziehung von Kleinkindern nur in der Familie gewährleistet werden kann, wofür jedoch einige Bedingungen erfüllt sein müssen. In bestimmten problematischen Fällen kann eine Fremdbetreuung dennoch die bessere, aber nicht optimale Lösung sein.
Die Schlussfolgerung dieser Arbeit ist, dass die Familien aufgrund der derzeitigen Lage verstärkt familienpolitisch und gesellschaftlich unterstützt werden müssen, aber nicht durch die Verlagerung des Kindes in eine Fremdbetreuung. Maßnahmen müssen die Familie als Einheit sehen und dementsprechend fördern, um dem Wohl des Kindes gerecht zu werden.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- 1. Einleitung
- 1.1. Motivation zum Thema
- 1.2. Aktualität des Themas
- 1.3. Zielsetzung und Aufbau
- 2. Zu den Grundlagen der Erziehung in Krippen
- 2.1. Zum Verständnis - Worterklärungen
- 2.1.1. Erziehung
- 2.1.2. Frühkindliche Erziehung
- 2.1.3. Außerfamiliäre/ außerfamiliale Erziehung
- 2.1.4. Innerfamiliale Erziehung/ Familienerziehung
- 2.1.5. Frühpädagogik
- 2.1.6. Kindertageseinrichtung und Kinderkrippe
- 2.2. Geschichte der Kleinkindpädagogik
- 2.2.1. Die Entwicklung bis 1900
- 2.2.2. Veränderungen ab 1900
- 2.2.3. Entwicklungen seit 1960
- 2.2.3.1. Die antiautoritäre Kinderladen-Bewegung
- 2.2.3.2. Strukturelle Veränderungen in den Krippen
- 2.3. Aktuelle Entwicklungen
- 2.3.1. Die moderne Kindheit
- 2.3.2. Die Rolle der Frau in der Gesellschaft
- 2.3.3. Die ,,vaterlose Gesellschaft“
- 2.3.4. Die aktuelle Familienpolitik
- 2.3.5. Gründe für die Entscheidung zur Krippenbetreuung
- 2.3.6. Studien zur Thematik Kleinkindererziehung und Familie
- 2.3.6.1. Ergebnisse einer repräsentativen Befragung junger Eltern
- 2.3.6.2. ifo Projekt
- 2.3.6.3. Ergebnisse des Arnold Bergstraesser Instituts Freiburg
- 2.3.6.4. Ergebnisse der Zeitschrift „ELTERN“ und „ELTERN for family“
- 2.3.6.5. Emnid Studie: Wie Mütter in Deutschland wirklich sind
- 2.4. Zur Situation von Kleinkindern
- 2.4.1. Ergebnisse des „Zwölften Kinder- und Jugendberichtes\" hinsichtlich der Kleinkindpädagogik mit kritischer Hinterfragung
- 2.4.1.1. Grundlegendes
- 2.4.1.2. Bildungsprozesse in den ersten Jahren
- 2.4.1.3. Leistungen und Veränderungsmöglichkeiten der Bildungswelten
- 2.4.1.4. Kritische Hinterfragung
- 2.4.2. Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan (BEP)
- 2.4.2.1. Menschenbild und Grundsätze des BEP
- 2.4.2.2. Basiskompetenzen
- 2.4.2.3. Themenübergreifende und themenbezogeneZiele
- 2.4.2.4. Schlüsselprozesse für Erziehungsqualität
- 2.4.2.5. Kritik am BEP hinsichtlich der Kinderkrippen
- 2.4.3. Rechtliche Grundlagen
- 2.4.3.1. Artikel 6 des Grundgesetzes
- 2.4.3.2. Neue Bundesgesetze: TAG und KICK
- 2.4.3.3. Das Bayerische Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG)
- 3. Human- und Sozialwissenschaftliche Ergebnisse
- 3.1. Familiensoziologie nach Rene König
- 3.1.1. Definition der Familie
- 3.1.2. Das Verhältnis von Familie und Wirtschaft
- 3.1.3. Die Bedeutung der Kontinuität in der Familie
- 3.1.4. Der Desintegrationsprozess
- 3.1.5. Die sozial-kulturelle Persönlichkeit
- 3.1.6. Resümee und Schlussfolgerungen
- 3.2. Hirnforschung und Neurobiologie nach Lise Eliot
- 3.2.1. Das Gehirn: Gene und Umwelt
- 3.2.2. Körperkontakte
- 3.2.3. Die Sinnesorgane
- 3.2.3.1. Der Geruchsinn
- 3.2.3.2. Das Sehen
- 3.2.3.3. Das Hören
- 3.2.4. Motorik
- 3.2.5. Soziale und emotionale Entwicklung
- 3.2.5.1. Grundlagen
- 3.2.5.2. Entwicklung des limbischen Systems
- 3.2.5.3. Temperament und Persönlichkeit
- 3.2.5.4. Das Sozialleben
- 3.2.5.5. Emotionales Lernen
- 3.2.5.6. Die Bedeutung der Mutter-Kind-Bindung
- 3.2.5.7. Die Objektpermanenz
- 3.2.5.8. Außerfamiliäre Betreuung
- 3.2.5.9. Soziale und emotionale Deprivation
- 3.2.6. Gedächtnis
- 3.2.6.1. Das präexplizite Gedächtnis
- 3.2.6.2. Das explizite Gedächtnis
- 3.2.7. Sprache
- 3.2.7.1. Die Sprachentwicklung
- 3.2.7.2. Die Rolle der Erfahrung
- 3.2.8. Die Intelligenz
- 3.2.8.1. Die Entwicklung der Intelligenz
- 3.2.8.2. Gene und Milieu
- 3.2.9. Resümee und Schlussfolgerungen
- 3.2.9.1. Entwicklungsbedingungen
- 3.2.9.2. Die Eltern-Kind-Bindung
- 3.2.9.3. Die Folgen bei Trennung
- 3.2.9.4. Die Bedeutung des Stillens
- 3.2.9.5. Die kognitive Entwicklung
- 3.2.9.6. Sozial benachteiligte Kinder
- 3.3. Psychologie
- 3.3.1. Die Entwicklungspsychologie des Kleinkindes nach Hellgard Rauh
- 3.3.1.1. Frühe Kindheit als Lebensabschnitt
- 3.3.1.2. Erstes Stadium (bis sechs Monate)
- 3.3.1.3. Zweites Stadium (sechs bis acht Monate)
- 3.3.1.4. Drittes Stadium (acht bis zehn Monate)
- 3.3.1.5. Viertes Stadium (zehn bis zwölf Monate)
- 3.3.1.6. Fünftes Stadium (bis drei Jahre)
- 3.3.1.7. Resümee und Schlussfolgerungen
- 3.3.2. Die Mutter-Kind-Beziehung nach Rene Spitz
- 3.3.2.1. Die besondere Beziehung zwischen Mutter und Kind
- 3.3.2.2. Auswirkungen der Beziehung auf die Entwicklung des Kindes
- 3.3.2.3. Geschädigte Mutter-Kind-Beziehung und ihre Folgen
- 3.3.2.4. Resümee und Schlussfolgerungen
- 3.3.3. Die Bindungsforschung nach John Bowlby
- 3.3.3.1. Die Rolle der Familie
- 3.3.3.2. Seelische Gesundheit
- 3.3.3.3. Die „Mutterentbehrung“
- 3.3.3.4. Schäden der Deprivation
- 3.3.3.5. Beobachtungen an Kleinkindern in Heimen
- 3.3.3.6. Retrospektive Untersuchungen
- 3.3.3.7. Außerfamiliäre Erziehung
- 3.3.3.8. Resümee und Schlussfolgerungen
- 3.3.4. Die Antriebslehre nach Christa Meves (Kinder- und Jugendpsychotherapeutin)
- 3.3.4.1. Kinderpsychologie und Ethologie
- 3.3.4.2. Die Theorie der Instinkthandlung
- 3.3.4.3. Der Nahrungstrieb und seine Störungen
- 3.3.4.4. Der Bindungstrieb und seine Störungen
- 3.3.4.5. Der Selbstbehauptungstrieb und seine Störungen
- 3.3.4.6. Der seelische gesunde und der kranke Lebensaufbau
- 3.3.4.7. Pädagogische Konsequenzen
- 3.3.4.8. Resümee und Schlussfolgerungen
- 3.3.5. Die Persönlichkeitsentwicklung nach Erik Erikson
- 3.3.5.1. Gesundes Wachsen
- 3.3.5.2. Urvertrauen und Urmisstrauen
- 3.3.5.3. Autonomie
- 3.3.5.4. Resümee und Schlussfolgerungen
- 3.3.6. Das Grundbedürfnis des Kindes nach beständigen Beziehungen aus kinderpsychiatrischer Sicht nach T.B. Brazelton und S.I. Greenspan
- 3.3.6.1. Konstante Beziehungen
- Entwicklungsgeschichte der Kleinkindpädagogik
- Aktuelle Herausforderungen der Kleinkindbetreuung
- Wissenschaftliche Erkenntnisse aus verschiedenen Disziplinen (Familiensoziologie, Hirnforschung, Psychologie)
- Der Einfluss der frühen Betreuung auf die Entwicklung von Kindern
- Die Bedeutung von Bindung und Beziehungsgestaltung für das Kindeswohl
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit „Das Kind in der Krippe“ untersucht die frühe institutionelle und außerfamiliäre Betreuung und Erziehung von Säuglingen und Kleinkindern bis zum Alter von drei Jahren. Die Arbeit beleuchtet die Entwicklungen und Herausforderungen der Kleinkindpädagogik im Kontext der modernen Gesellschaft und analysiert verschiedene wissenschaftliche Perspektiven auf die Entwicklung und das Wohlbefinden von Kleinkindern in den ersten Lebensjahren.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Motivation und Aktualität des Themas sowie die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit erläutert. Anschließend werden die Grundlagen der Erziehung in Krippen beleuchtet, wobei die verschiedenen Begriffsdefinitionen und die historische Entwicklung der Kleinkindpädagogik bis zur Gegenwart im Fokus stehen. Darüber hinaus werden die aktuellen Entwicklungen in der Gesellschaft, die die Entscheidung zur Krippenbetreuung beeinflussen, analysiert.
Im dritten Kapitel werden die Ergebnisse aus verschiedenen human- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen vorgestellt. Hier werden die Erkenntnisse der Familiensoziologie nach Rene König, die Hirnforschung und Neurobiologie nach Lise Eliot sowie die Entwicklungspsychologie des Kleinkindes nach Hellgard Rauh, die Mutter-Kind-Beziehung nach Rene Spitz und die Bindungsforschung nach John Bowlby beleuchtet. Die Arbeit analysiert zudem die Antriebslehre nach Christa Meves und die Persönlichkeitsentwicklung nach Erik Erikson, um die Bedeutung von Beziehungen und Entwicklungsförderung für das Kindeswohl zu verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Frühkindliche Erziehung, Kleinkindpädagogik, Krippenbetreuung, Familiensoziologie, Hirnforschung, Entwicklungspsychologie, Bindungsforschung, Kindeswohl, Beziehungsgestaltung, Entwicklungsförderung.
Häufig gestellte Fragen
Entspricht die Krippenerziehung den Bedürfnissen eines Kleinkindes?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass Krippenerziehung oft nicht den Grundbedürfnissen nach beständigen Beziehungen gerecht wird und Risiken für die Entwicklung birgt.
Warum ist die Mutter-Kind-Bindung laut Bindungsforschung so wichtig?
Nach John Bowlby und Rene Spitz ist eine stabile Bindung in den ersten Lebensjahren essenziell für die seelische Gesundheit und zur Vermeidung von Deprivationsschäden.
Welche Rolle spielt die Hirnforschung in dieser Debatte?
Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung von Körperkontakt und emotionalem Lernen für die Entwicklung des limbischen Systems im Gehirn.
Was sind die Kritikpunkte am Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP)?
Die Arbeit kritisiert den BEP hinsichtlich der Umsetzung von Erziehungsqualität in Kinderkrippen im Vergleich zur familiären Erziehung.
Was ist das Fazit zur außerfamiliären Betreuung unter drei Jahren?
Die Arbeit plädiert für eine stärkere Förderung der Familie als Einheit, da eine optimale Erziehung von Kleinkindern primär dort gewährleistet werden kann.
- Arbeit zitieren
- Brigitta Brunner (Autor:in), 2007, „Das Kind in der Krippe“. Frühe institutionelle und außerfamiliäre Betreuung und Erziehung von Säuglingen und Kleinkindern bis zum Alter von drei Jahren, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/91632