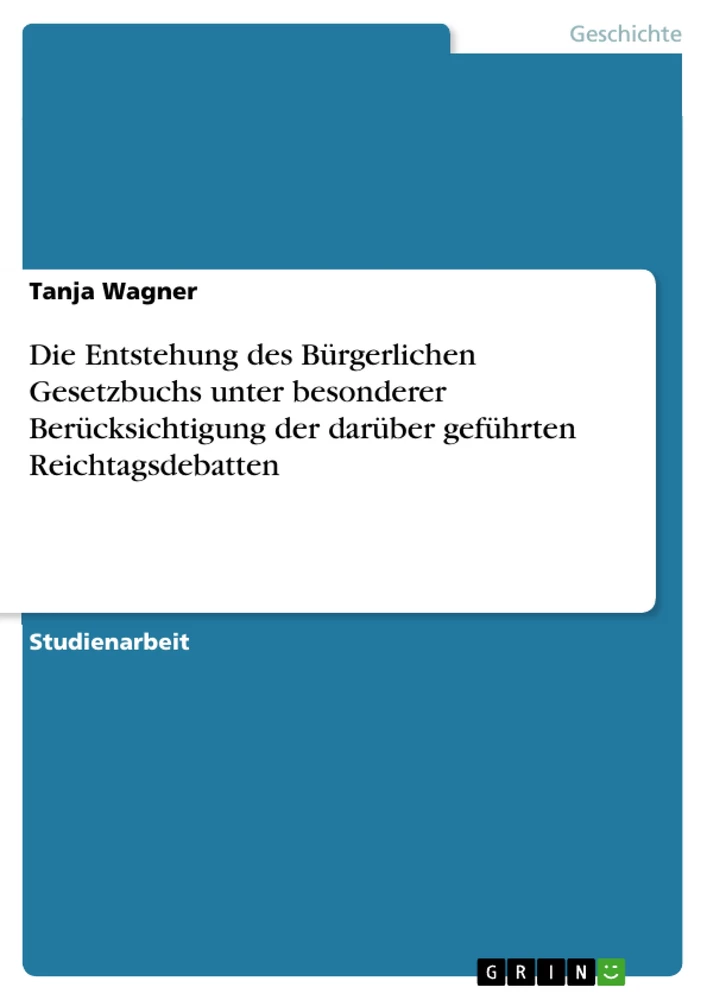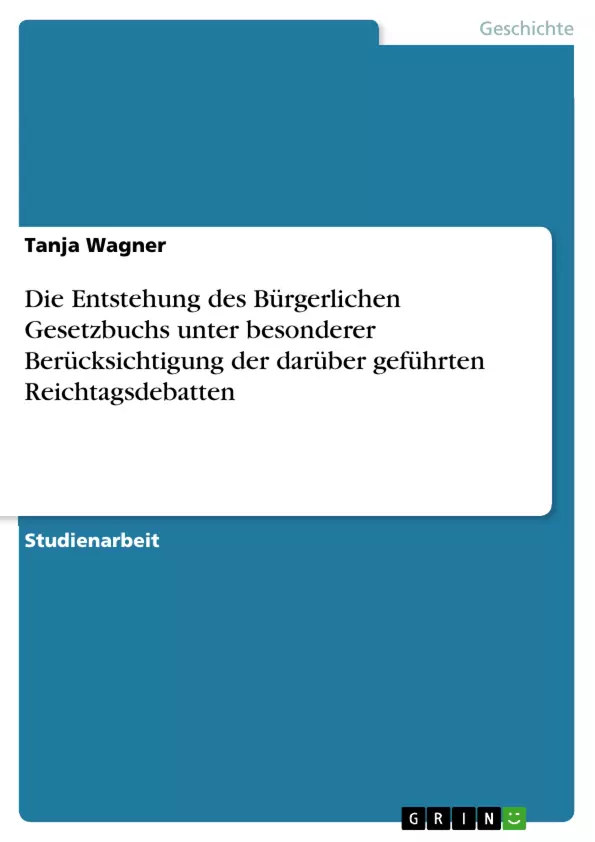Das deutsche Kaiserreich ist am 01.01.1871 durch Inkrafttreten seiner Verfassung entstanden. Grundlage war der Beitritt der süddeutschen Staaten zum Norddeutschen Bund. Die angegliederten 25 Staaten galten als Staaten innerhalb des Bundes, mithin als Bundesstaaten, bei denen alle Zuständigkeiten verbleiben, die von der Verfassung nicht ausdrücklich oder sinngemäß auf das Reich übertragen werden. Der Aspekt der Gesetzgebung gewann ein besonderes Gewicht unter dem Gesichtspunkt, dass nun nach dem Zusammenschluss der einzelnen Länder auch Bestrebungen zu einer Rechtsvereinheitlichung zu gelangen, intensiviert wurden. Die ersten Schritte hin zu einem einheitlichen Handels- und Wirtschaftsrecht waren bereits 1834 durch die Gründung des Deutschen Zollvereins gemacht worden. Am 01.01.1869 wurde ein Entwurf, der fast in allen deutschen Ländern einheitlich war, in Kraft gesetzt und wurde dann vom deutschen Reich als Allgemeines Deutsches Handelsrecht reichsgesetzmäßig übernommen. Nach der Schaffung von Rechtseinheit in Handel und Wirtschaft war auch eine Vereinheitlichung des eng damit verbundenen Schuldrechts vonnöten. Ein Entwurf war bereits 1866 ausgearbeitet, wurde aber nicht Gesetz. Weitere Maßnahmen hin zur Rechtseinheit im deutschen Kaiserreich unternahm man durch die Verkündung des Reichsstrafgesetzbuchs am 15.05.1871, ebenso durch die Straf- und Zivilprozessordnungen von 1877, die wie das Gerichtsverfassungsgesetz 1879 in Kraft traten. Wonach das deutsche Kaisereich als Rechtsstaat aber insbesondere verlangte, war ein einheitliches Zivilrecht - ein Prozess, an dessen Ende das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) stand.
In der Arbeit wird in einem 1. Punkt dargestellt, wie die Ausarbeitung des BGB vonstatten gegangen ist. Im 2. Abschnitt werden dann die über den Entwurf geführten Reichstagsdebatten anhand parteipolitischer Aspekte an den Rechtsgebieten Vereins-, Dienst-und eheliches Güterrecht untersucht. Insbesondere wird dabei auf die für die Rekapitulation des Ausarbeitungsprozesses so wichtige Quelle, nämlich die Protokolle „Stenographische Berichte des Reichstags. Erste, zweite und dritte Berathung des Entwurfs eines bürgerlichen Gesetzbuchs im Reichstage“, ausführlich zurückgegriffen und häufig zitiert. Außerdem werden zu allen genannten Personen des Entstehungsprozesses reichhaltige biographische Daten bereitgestellt. Zum Schluss erfolgt eine knappe Zusammenfassung der Ergebnisse. Das angehängte Literaturverzeichnis bietet weitere Recherchemöglichkeiten.
Inhaltsverzeichnis
- Das deutsche Kaiserreich als Rechtsstaat
- Die Entstehungsgeschichte des BGB
- Erweiterung der Reichskompetenzen auf das Zivilrecht
- Die Vorkommission
- Die 1. Kommission
- Die 2. Kommission
- Der BGB-Entwurf im Bundesrat
- Der BGB-Entwurf im Reichstag
- Die Reichstagsdebatten über den Entwurf des BGB unter parteipolitischen Gesichtspunkten am Beispiel von Vereins-, Dienstvertrags- und ehelichem Güterrecht in 2. und 3. Lesung
- Vereinsrecht
- Nationalliberale
- Deutsche Freisinnige Volkspartei
- Zentrum
- Deutsch-Konservative Partei
- Sozialdemokratische Partei Deutschlands
- Deutsche Reichspartei
- Polen
- Ergebnis der Debatte über das Vereinsrecht
- Dienstvertragsrecht
- Sozialdemokratische Partei Deutschlands
- Zentrum
- Nationalliberale
- Ergebnis der Debatte über das Dienstrecht
- Eheliches Güterrecht
- Deutsche Reichspartei
- Sozialdemokratische Partei Deutschlands
- Freisinnige Vereinigung
- Zentrum
- Ergebnis der Debatte über das eheliche Güterrecht
- Abschluss der Debatte im Reichstag
- Vereinsrecht
- Zusammenfassung und Abschluss der Debatten um das BGB
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) im Deutschen Kaiserreich (1871-1914) unter besonderer Berücksichtigung der Reichstagsdebatten. Ziel ist es, den Prozess der Rechtsvereinheitlichung im Kaiserreich zu beleuchten und die parteipolitischen Auseinandersetzungen um zentrale Aspekte des BGB zu analysieren.
- Die Erweiterung der Reichskompetenzen auf das Zivilrecht
- Der Entstehungsprozess des BGB und die Rolle verschiedener Kommissionen
- Parteipolitische Auseinandersetzungen in den Reichstagsdebatten
- Die Diskussion um zentrale Rechtsgebiete wie Vereins-, Dienstvertrags- und Ehegüterrecht
- Der Einfluss der verschiedenen politischen Parteien auf die Ausgestaltung des BGB
Zusammenfassung der Kapitel
Das deutsche Kaiserreich als Rechtsstaat: Das Kapitel beschreibt die Rechtslage im Deutschen Kaiserreich nach 1871. Es betont den Prozess der Rechtsvereinheitlichung, der nach der Reichsgründung an Fahrt gewann. Die Gründung des Deutschen Zollvereins (1834) und die Einführung eines einheitlichen Handelsrechts (1869) legen den Grundstein. Die Einführung des Reichsstrafgesetzbuchs (1871) und weiterer Prozessordnungen in den 1870er Jahren unterstreichen diesen Trend zur Vereinheitlichung. Das Kapitel hebt die Notwendigkeit eines einheitlichen Zivilrechts hervor und führt als wichtigstes Beispiel das Fehlen eines solchen im Vergleich zu anderen Rechtsbereichen an. Die Schaffung des Reichsgerichts (1877/79) wird als symbolische Krönung dieser Entwicklung dargestellt. Das Kapitel legt den Fokus auf den dringenden Bedarf eines einheitlichen Zivilrechts als Grundlage eines funktionierenden Rechtsstaates.
Die Entstehungsgeschichte des BGB: Dieses Kapitel skizziert den komplexen Prozess der Ausarbeitung des BGB. Zunächst wird die Erweiterung der Reichskompetenzen auf das Zivilrecht behandelt, welche durch die nationalliberale Partei vorangetrieben wurde und auf erheblichen Widerstand, insbesondere von Bayern und Württemberg, stieß. Der Kapitelverlauf beleuchtet die verschiedenen Kommissionen (Vorkommission, 1. und 2. Kommission), die an der Ausarbeitung beteiligt waren, und zeigt die Herausforderungen bei der Harmonisierung der unterschiedlichen Rechtsvorschriften der Bundesstaaten. Der Weg zur Durchsetzung der Reichsgesetzgebung auf dem Gebiet des Zivilrechts ist ein wichtiger Aspekt, welcher die späteren Reichstagsdebatten prägt.
Häufig gestellte Fragen zum Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) im Deutschen Kaiserreich
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Entstehung des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) im Deutschen Kaiserreich (1871-1914), mit besonderem Fokus auf die Reichstagsdebatten. Sie untersucht den Prozess der Rechtsvereinheitlichung und die parteipolitischen Auseinandersetzungen um zentrale Aspekte des BGB.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt die Erweiterung der Reichskompetenzen auf das Zivilrecht, den Entstehungsprozess des BGB inklusive der Rolle verschiedener Kommissionen, die parteipolitischen Auseinandersetzungen in den Reichstagsdebatten, die Diskussion um zentrale Rechtsgebiete wie Vereins-, Dienstvertrags- und Ehegüterrecht und den Einfluss verschiedener politischer Parteien auf die Ausgestaltung des BGB.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst Kapitel zum deutschen Kaiserreich als Rechtsstaat, zur Entstehungsgeschichte des BGB, detaillierte Analysen der Reichstagsdebatten zu Vereins-, Dienstvertrags- und ehelichem Güterrecht unter parteipolitischen Gesichtspunkten (mit Betrachtung der Positionen von Nationalliberalen, Deutsch-Freisinnigen, Zentrum, Deutsch-Konservativen, SPD, Deutscher Reichspartei und Polen) und eine Zusammenfassung der Debatten und deren Ergebnisse.
Welche Rolle spielte die Erweiterung der Reichskompetenzen?
Die Erweiterung der Reichskompetenzen auf das Zivilrecht war ein entscheidender Schritt für die Einführung des BGB. Dieser Prozess, vorangetrieben von der nationalliberalen Partei, stieß jedoch auf Widerstand von einigen Bundesstaaten wie Bayern und Württemberg.
Wie verlief der Entstehungsprozess des BGB?
Der Entstehungsprozess war komplex und umfasste verschiedene Kommissionen (Vorkommission, 1. und 2. Kommission), die an der Ausarbeitung des BGB beteiligt waren. Die Harmonisierung der unterschiedlichen Rechtsvorschriften der Bundesstaaten stellte eine große Herausforderung dar.
Welche Rolle spielten die politischen Parteien in den Reichstagsdebatten?
Die Reichstagsdebatten waren geprägt von parteipolitischen Auseinandersetzungen. Die Arbeit analysiert die Positionen verschiedener Parteien (z.B. Nationalliberale, SPD, Zentrum) zu zentralen Rechtsgebieten wie Vereins-, Dienstvertrags- und Ehegüterrecht und deren Einfluss auf die endgültige Formulierung des BGB.
Welche zentralen Rechtsgebiete wurden in den Reichstagsdebatten diskutiert?
Die Arbeit analysiert im Detail die Debatten um das Vereinsrecht, das Dienstvertragsrecht und das eheliche Güterrecht. Für jedes dieser Rechtsgebiete werden die Positionen der verschiedenen Parteien im Reichstag dargestellt.
Welche Zusammenfassung bietet die Arbeit?
Die Arbeit fasst den Prozess der Rechtsvereinheitlichung im Deutschen Kaiserreich zusammen, beleuchtet den komplexen Entstehungsprozess des BGB und analysiert die parteipolitischen Auseinandersetzungen, die diesen Prozess prägten. Die Ergebnisse der Reichstagsdebatten werden zusammengefasst und deren Einfluss auf die Ausgestaltung des BGB wird hervorgehoben.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, Studierende und alle, die sich für Rechtsgeschichte, insbesondere die Entstehung des BGB, und die politische Geschichte des Deutschen Kaiserreichs interessieren.
- Citar trabajo
- Tanja Wagner (Autor), 2007, Die Entstehung des Bürgerlichen Gesetzbuchs unter besonderer Berücksichtigung der darüber geführten Reichtagsdebatten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/91638