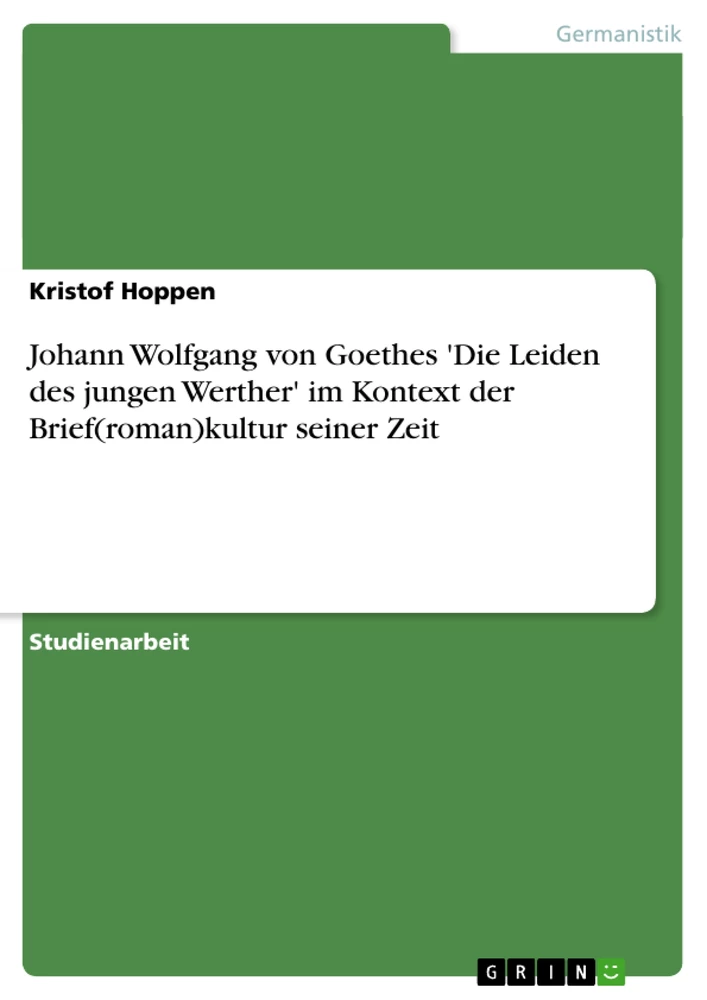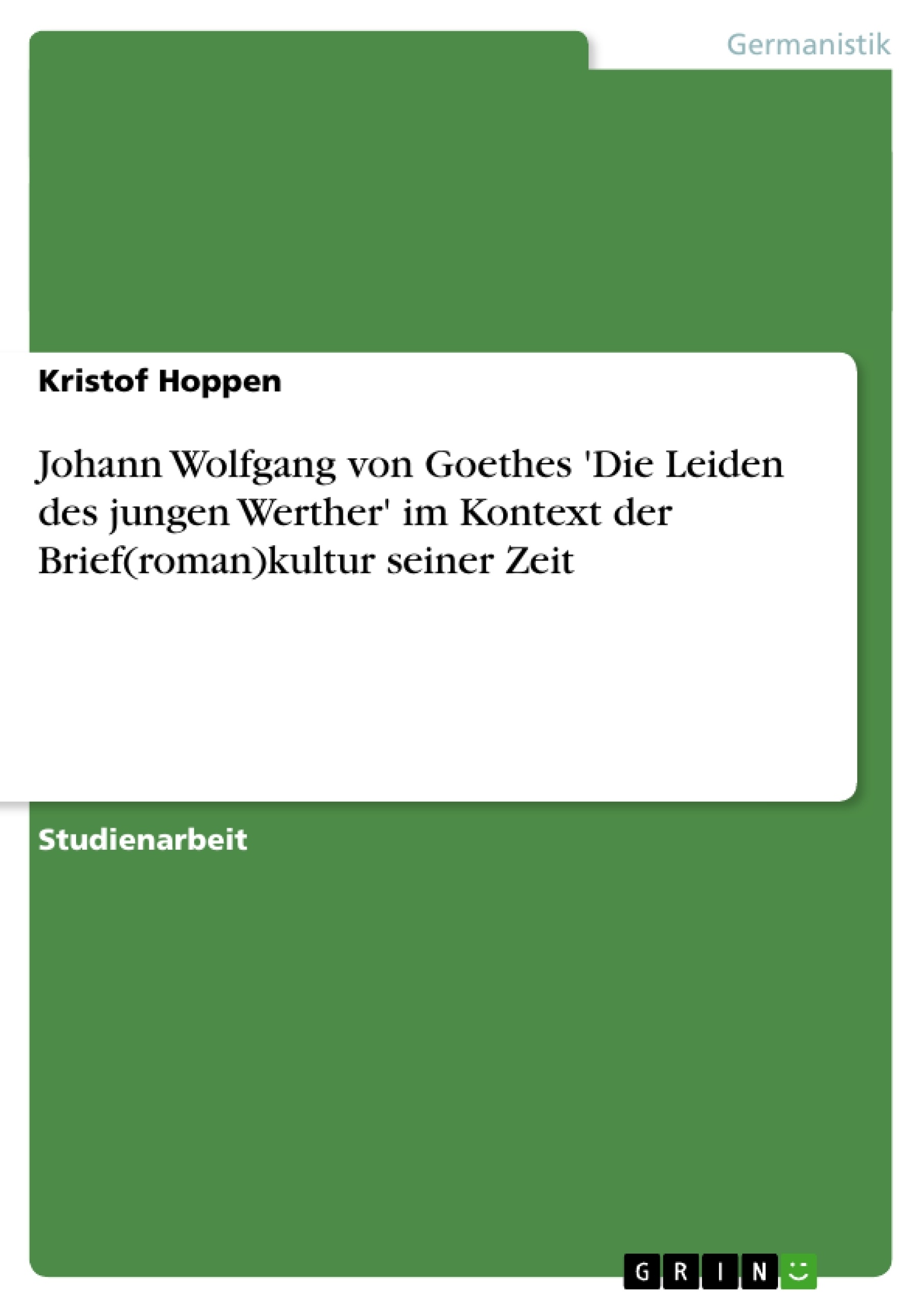J.W. von Goethes Roman Die Leiden des jungen Werthers gilt heute als be-sonderes Literaturereignis, das auf vielfältigste Weise interpretiert wird und interpretiert worden ist. Doch schon zu seiner Zeit hat der Werther eine unge-heure Welle der Begeisterung, ja ein regelrechtes ‚Wertherfieber’, ausgelöst. Als erster deutschsprachiger Roman, der Weltliteratur geworden ist, ist er als literarische Revolution in die Literaturgeschichte eingegangen, und er gehört auch heute noch zu den wohl wichtigsten Werken des deutschen Literaturkanons.
Doch was macht die Besonderheit des Werthers aus? Warum hatte gerade der Werther so einen durchschlagenden Erfolg? Dies zu beantworten, muss man den Roman im Kontext seiner Zeit betrachten.
Der Werther entsteht als Briefroman in einer Zeit, in der sich sowohl in der Briefkultur, als auch in der Briefromankultur grundlegende Änderungen ein-stellen. Als eine besondere Form des modernen Briefromans bildet der Wer-ther selbst dabei einen entscheidenden Einschnitt.
Vorliegende Arbeit will den Werther im Kontext der Brief- und Briefro-mankultur des 18. Jahrhunderts darstellen und daraus seinen durchschlagen-den Erfolg begründen.
Dazu soll zunächst einmal die Briefkultur und ihre grundlegenden Entwick-lungen im 18. Jahrhundert dargestellt werden. In einem weiteren Kapitel wird der Briefroman des 18. Jahrhunderts, der sich unter Einfluss der Veränderun-gen in der Briefkultur entwickelt, vorgestellt, den Goethe sich zum Vorbild nimmt, um ihn dann umzuformen.
Das vierte Kapitel der Arbeit betrachtet Goethes Werther als Besonderheit und Weiterentwicklung im Kontext der dargestellten Brief- und Briefroman-kultur.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Briefkultur des 18. Jahrhunderts
- Der Briefroman des 18. Jahrhunderts
- J. W. von Goethes Werther als Radikalisierung des Briefromans des 18. Jahrhunderts
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht J.W. von Goethes „Die Leiden des jungen Werthers“ im Kontext der Brief- und Briefromankultur des 18. Jahrhunderts, um dessen außergewöhnlichen Erfolg zu erklären. Die Analyse beleuchtet die Veränderungen in der Briefkultur und deren Einfluss auf die Entwicklung des Briefromans als literarische Gattung.
- Die Entwicklung der Briefkultur im 18. Jahrhundert
- Der Briefroman als literarische Form im 18. Jahrhundert
- Goethes „Werther“ als radikale Weiterentwicklung des Briefromans
- Der Einfluss des Pietismus auf die Briefkultur und den Briefroman
- Der Brief als Medium der sozialen und politischen Emanzipation des Bürgertums
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach dem außergewöhnlichen Erfolg von Goethes „Werther“ im Kontext seiner Zeit. Sie skizziert den Ansatz der Arbeit, der den Roman im Kontext der sich verändernden Brief- und Briefromankultur des 18. Jahrhunderts betrachtet und so die Beweggründe für den Erfolg zu ergründen versucht. Die Arbeit kündigt die einzelnen Kapitel an, welche die Briefkultur, den Briefroman und schließlich Goethes „Werther“ als dessen Radikalisierung behandeln.
Die Briefkultur des 18. Jahrhunderts: Dieses Kapitel beleuchtet die tiefgreifenden Veränderungen der Briefkultur im 18. Jahrhundert. Es beschreibt die Entwicklung vom stark formalisierten, rhetorisch geprägten Brief des frühen 18. Jahrhunderts hin zu einem Ausdruck persönlicher Subjektivität und Emotionalität. Die zunehmende Bedeutung des Briefes für das Bürgertum wird herausgestellt, das darin eine Möglichkeit fand, sein neu gewonnenes Selbstwertgefühl und seine Identität zu formulieren. Der Einfluss des Pietismus auf die Entwicklung eines innerlichkeit-betonten Briefes wird ebenfalls behandelt, wobei der Brief als Medium des Austausches über Frömmigkeit und Glaubenserfahrungen eine besondere Rolle spielte. Darüber hinaus wird die Bedeutung des Briefes als Mittel des kulturellen Austauschs und als eine Art „Ersatzparlament“ für die politisch nicht privilegierten Schichten des Bürgertums betont. Diese Entwicklung zeigt den Wandel vom formellen zum privaten und emotionalisierten Brief.
Der Briefroman des 18. Jahrhunderts: Dieses Kapitel untersucht die literarische Adaption der im vorherigen Kapitel dargestellten Entwicklungen der Briefkultur im Briefroman. Es beschreibt die Entstehung und Evolution des Briefromans als literarische Gattung im 18. Jahrhundert, die eng mit den Veränderungen in der Briefkultur verwoben ist. Die Arbeit zeigt auf, wie der literarische Briefroman die Möglichkeiten und Merkmale des neuen, subjektiven und emotionalen Briefs aufnimmt und in eine narrative Struktur integriert. Der Einfluss der sich verändernden gesellschaftlichen Strukturen und der damit einhergehenden Veränderungen der Kommunikation auf die Form und den Inhalt des Briefromans bildet den Mittelpunkt der Diskussion.
Schlüsselwörter
Goethe, Werther, Briefkultur, Briefroman, 18. Jahrhundert, Pietismus, Bürgertum, Emotionalität, Subjektivität, Literaturgeschichte, literarische Revolution.
Häufig gestellte Fragen zu: J.W. von Goethes „Die Leiden des jungen Werthers“ im Kontext der Briefkultur des 18. Jahrhunderts
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert J.W. von Goethes „Die Leiden des jungen Werthers“ im Kontext der Brief- und Briefromankultur des 18. Jahrhunderts, um dessen außergewöhnlichen Erfolg zu erklären. Sie untersucht die Veränderungen in der Briefkultur und deren Einfluss auf die Entwicklung des Briefromans als literarische Gattung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der Briefkultur im 18. Jahrhundert, den Briefroman als literarische Form, Goethes „Werther“ als radikale Weiterentwicklung des Briefromans, den Einfluss des Pietismus auf die Briefkultur und den Briefroman, und den Brief als Medium der sozialen und politischen Emanzipation des Bürgertums.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Einleitung, Die Briefkultur des 18. Jahrhunderts, Der Briefroman des 18. Jahrhunderts, J. W. von Goethes Werther als Radikalisierung des Briefromans des 18. Jahrhunderts, und Fazit. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den Ansatz der Arbeit vor. Die folgenden Kapitel behandeln die jeweiligen Themen im Detail.
Was wird in dem Kapitel "Die Briefkultur des 18. Jahrhunderts" behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet den Wandel der Briefkultur vom formalen, rhetorischen Brief hin zu einem Ausdruck persönlicher Subjektivität und Emotionalität. Es betont die zunehmende Bedeutung des Briefs für das Bürgertum, den Einfluss des Pietismus und die Rolle des Briefs als Medium des kulturellen Austauschs und der politischen Partizipation.
Was wird in dem Kapitel "Der Briefroman des 18. Jahrhunderts" behandelt?
Dieses Kapitel untersucht die literarische Adaption der Entwicklungen der Briefkultur im Briefroman. Es beschreibt die Entstehung und Evolution des Briefromans als literarische Gattung und wie er die Merkmale des neuen, subjektiven und emotionalen Briefs in eine narrative Struktur integriert.
Welche Rolle spielt Goethes "Werther" in dieser Arbeit?
Goethes „Werther“ wird als radikale Weiterentwicklung des Briefromans analysiert. Die Arbeit untersucht, wie der Roman die Möglichkeiten und Merkmale des neuen, subjektiven und emotionalen Briefs nutzt und wie dies zu seinem außergewöhnlichen Erfolg beitrug.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Goethe, Werther, Briefkultur, Briefroman, 18. Jahrhundert, Pietismus, Bürgertum, Emotionalität, Subjektivität, Literaturgeschichte, literarische Revolution.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende der Literaturwissenschaft, Germanistik und Geschichte, die sich mit dem 18. Jahrhundert, der Literaturgeschichte, dem Briefroman und der Entwicklung der Briefkultur auseinandersetzen.
- Arbeit zitieren
- Kristof Hoppen (Autor:in), 2008, Johann Wolfgang von Goethes 'Die Leiden des jungen Werther' im Kontext der Brief(roman)kultur seiner Zeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/91739