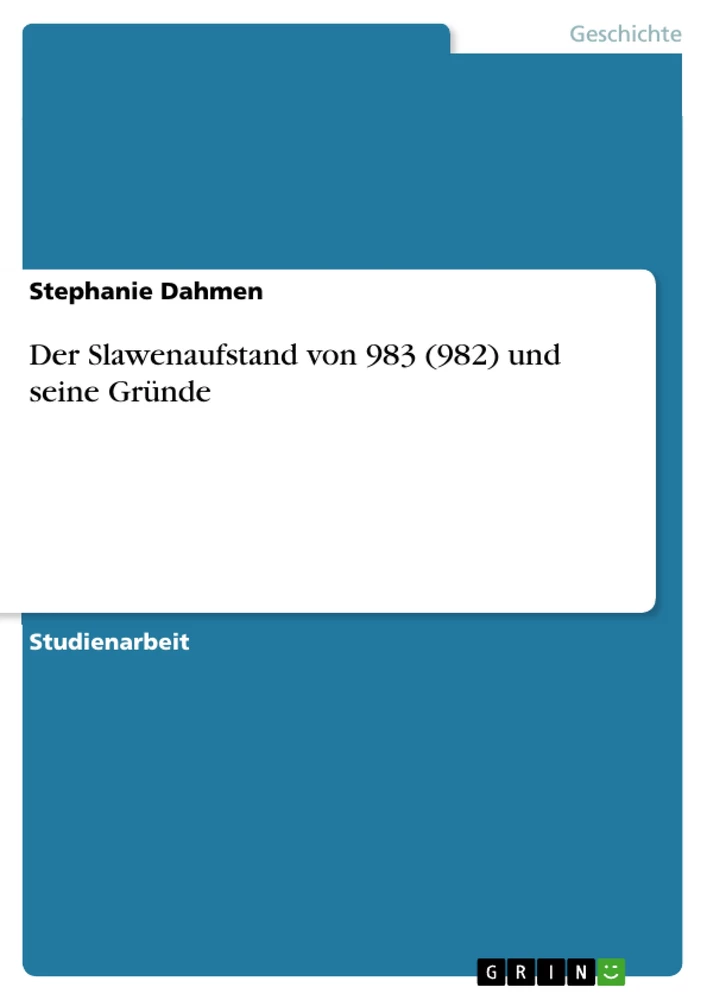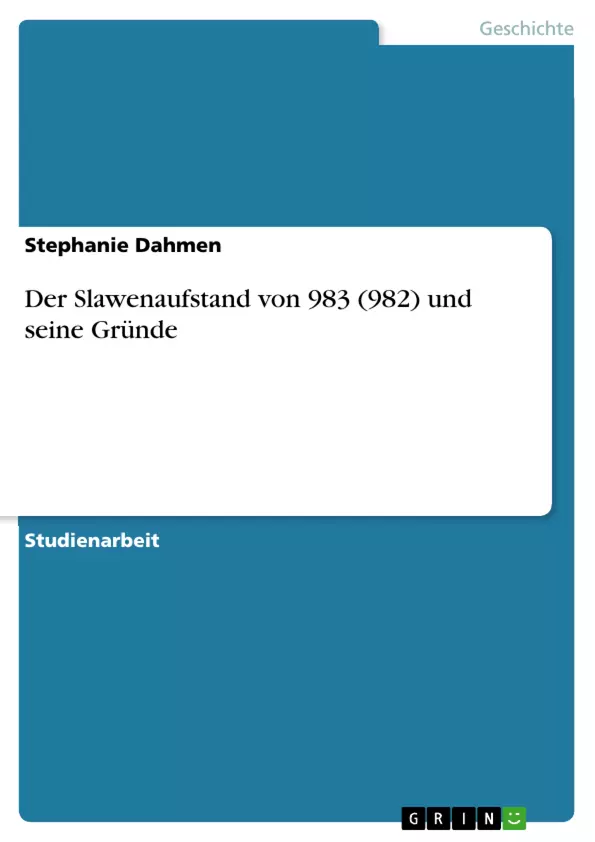Einleitung
Seit dem 6. Jahrhundert kamen slawisch sprechende Völker in das ehemals von Germanen bewohnte Gebiet zwischen Elbe und Saale, um sich dort niederzulassen. Während ihre Siedlungen im 7. Jahrhundert die größte Ausdehnung erlebten und auch ein kultureller Anstieg erreicht wurde, führte die Expansion des Frankenreiches unter den Karolingern dazu, dass die Westslawen nun die direkten Nachbarn waren. Feindschaften zwischen einzelnen slawischen Stämmen machte sich die fränkische Politik zu Nutze, um die eigenen Interessen bezüglich der Unterwerfung der Slawen zu verwirklichen. Nach dem Machtverfall des fränkischen Reiches im 9. Jahrhundert ging erst wieder Heinrich I. offensiv gegen die Slawen vor, um sie zur Anerkennung der deutschen Oberhoheit zu zwingen.
Der Aufstand der slawischen Lutizenstämme von 983 (982) bildete den Höhepunkt der Auseinandersetzung zwischen Slawen und Deutschen und hatte zur Folge, dass die Gebiete jenseits der Elbe dem Reich für mehr als ein Jahrhundert verloren blieben.
Diese Arbeit soll zunächst einen Überblick bezüglich des Verlaufs des Aufstandes und der daran beteiligten Stämme vermitteln. Im Weiteren liegt der Schwerpunkt in der Klärung der Frage, welche Gründe den Aufstand der Slawen verursacht haben. Ziel dieser Arbeit ist die Analyse dieser Gründe unter Berücksichtigung der Informationen, die den Quellen zu entnehmen sind, um herauszufinden welche Aspekte am wahrscheinlichsten den historischen Tatsachen entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Organisation des Aufstandes
- Die beteiligten Stämme
- Initiatoren des Aufstandes
- Der Aufstand der Elbslawen
- Die Quellen
- Der Verlauf
- Die Gründe des Aufstandes
- Die Aufhebung des Bistums Merseburg
- Das harte Regiment des Markgrafen Dietrich
- Die Niederlage Ottos II. bei Cotrone als Auslöser des Aufstandes
- Kampf gegen die deutsche Oberhoheit und das Christentum
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Slawenaufstand von 983/982. Ziel ist die Analyse der Ursachen des Aufstandes basierend auf den verfügbaren Quellen, um die wahrscheinlichsten historischen Fakten herauszuarbeiten. Der Fokus liegt auf dem Verlauf des Aufstandes und den beteiligten Stämmen sowie der Klärung der Gründe für die Rebellion.
- Die Organisation und die beteiligten Stämme des Aufstandes
- Der Verlauf des Elbslawenaufstandes und die relevanten Quellen
- Die verschiedenen Ursachen des Aufstandes
- Die Rolle der deutschen Oberhoheit und des Christentums
- Die politische Struktur der slawischen Stämme
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die slawische Besiedlung des Gebietes zwischen Elbe und Saale ab dem 6. Jahrhundert und die daraus resultierenden Konflikte mit dem fränkischen und später dem deutschen Reich. Sie hebt den Slawenaufstand von 983/982 als Höhepunkt dieser Auseinandersetzung hervor und benennt das Ziel der Arbeit: die Analyse der Ursachen des Aufstandes anhand der verfügbaren Quellen.
Die Organisation des Aufstandes: Dieses Kapitel analysiert die Organisation des Aufstandes von 983/982. Es beschreibt die beteiligten Stämme – Abodriten, Wilzen und Sorben – und ihre innere Organisation, die durch eine akephale Struktur gekennzeichnet war. Die Bedeutung der Redarier als Initiatoren des Aufstandes wird hervorgehoben, und die Frage nach der Beteiligung der Abodriten wird diskutiert. Das Kapitel betont den Mangel an zentraler Herrschaftsgewalt bei den slawischen Stämmen und die Auswirkungen der deutschen Politik auf die politische Organisation der einzelnen Stämme, insbesondere die Unterdrückung der Sorben unter Markgraf Gero.
Der Aufstand der Elbslawen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Quellenlage des Slawenaufstandes. Die Chronik des Bischofs Thietmar von Merseburg wird als Hauptquelle identifiziert und ihre Entstehung sowie die mögliche Perspektive Thietmars auf die Ereignisse werden erläutert. Der Einfluss von Thietmars Vater, Siegfried, der an der Schlacht an der Tanger teilnahm, auf seine Schilderung der Ereignisse wird als entscheidender Faktor berücksichtigt. Der Kapitel beschreibt die Bedeutung der Chronik für das Verständnis des Aufstands.
Schlüsselwörter
Slawenaufstand, 983/982, Elbslawen, Abodriten, Wilzen, Sorben, Thietmar von Merseburg, deutsche Oberhoheit, Christentum, politische Organisation, Quellenkritik.
Häufig gestellte Fragen zum Slawenaufstand von 983/982
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Slawenaufstand von 983/982. Sie untersucht die Ursachen des Aufstandes, den Verlauf und die beteiligten Stämme, basierend auf den verfügbaren historischen Quellen.
Welche Stämme waren am Aufstand beteiligt?
Am Aufstand beteiligt waren vor allem die Abodriten, Wilzen und Sorben. Die Redarier werden als Initiatoren des Aufstandes hervorgehoben, die Beteiligung der Abodriten wird jedoch diskutiert. Die Arbeit betont den Mangel an zentraler Herrschaftsgewalt bei den slawischen Stämmen.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Hauptquelle für diese Arbeit ist die Chronik des Bischofs Thietmar von Merseburg. Die Arbeit diskutiert die Entstehung der Chronik und die mögliche Perspektive Thietmars, inklusive des Einflusses seines Vaters, Siegfried, auf seine Schilderung der Ereignisse.
Was waren die Ursachen des Aufstandes?
Die Arbeit untersucht verschiedene Ursachen für den Aufstand. Diese beinhalten die Aufhebung des Bistums Merseburg, das harte Regiment des Markgrafen Dietrich, die Niederlage Ottos II. bei Cotrone als möglichen Auslöser und den generellen Kampf gegen die deutsche Oberhoheit und das Christentum.
Wie war der Aufstand organisiert?
Die Arbeit beschreibt die Organisation des Aufstandes als gekennzeichnet durch eine akephale Struktur, also das Fehlen einer zentralen Führung. Die Auswirkungen der deutschen Politik auf die politische Organisation der einzelnen slawischen Stämme, insbesondere die Unterdrückung der Sorben unter Markgraf Gero, werden ebenfalls beleuchtet.
Welche Rolle spielte die deutsche Oberhoheit und das Christentum?
Die Arbeit untersucht die Rolle der deutschen Oberhoheit und des Christentums als wichtige Faktoren, die zum Ausbruch des Aufstandes beitrugen. Der Konflikt zwischen slawischer und deutscher Herrschaft sowie die Verbreitung des Christentums werden als zentrale Aspekte des Konflikts betrachtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Slawenaufstand, 983/982, Elbslawen, Abodriten, Wilzen, Sorben, Thietmar von Merseburg, deutsche Oberhoheit, Christentum, politische Organisation, Quellenkritik.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zur Organisation des Aufstandes, ein Kapitel zum Verlauf des Elbslawenaufstandes, ein Kapitel zu den Gründen des Aufstandes und ein Fazit.
Welches ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist die Analyse der Ursachen des Slawenaufstandes von 983/982 basierend auf den verfügbaren Quellen, um die wahrscheinlichsten historischen Fakten herauszuarbeiten. Der Fokus liegt auf dem Verlauf des Aufstandes, den beteiligten Stämmen und der Klärung der Gründe für die Rebellion.
- Quote paper
- Stephanie Dahmen (Author), 2005, Der Slawenaufstand von 983 (982) und seine Gründe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92039