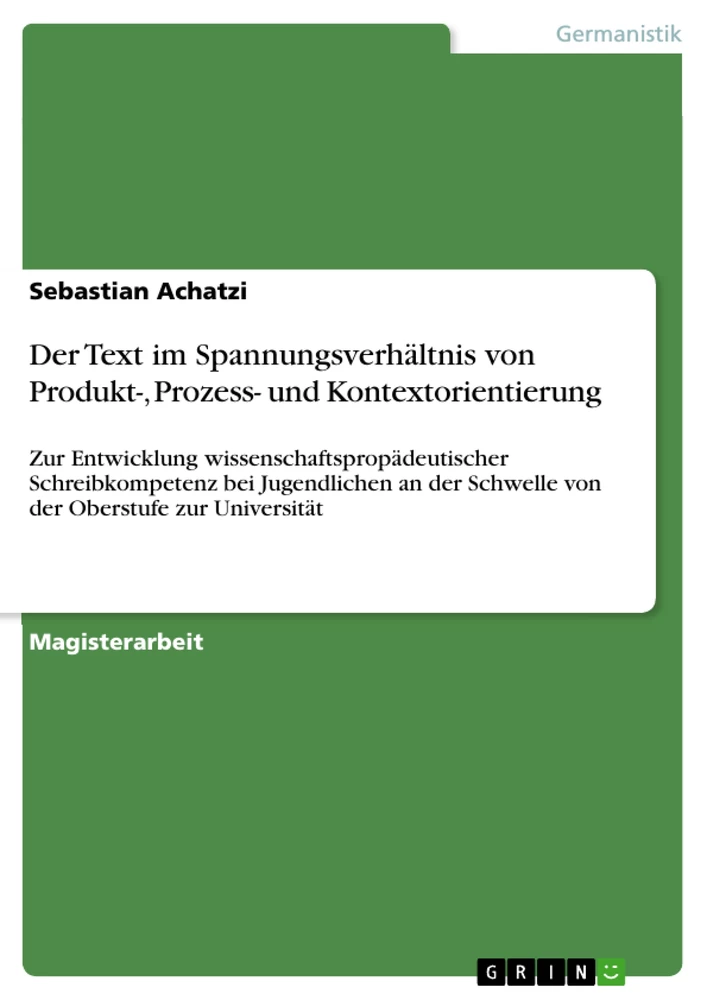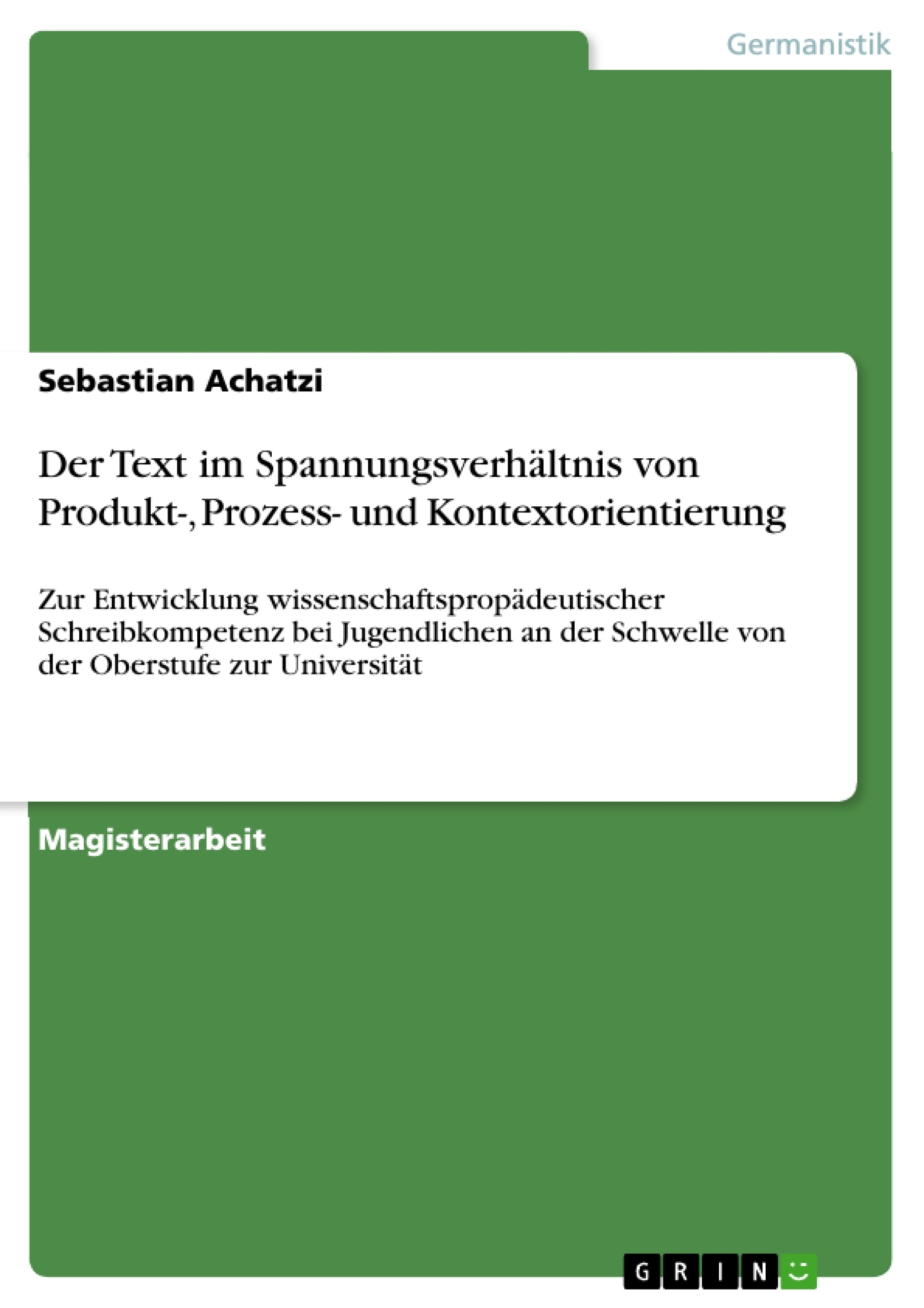Die Wirtschaft bescheinigt Auszubildenden in schöner Regelmäßigkeit eine defizitäre (Lese-) und Schreibfähigkeit; selbst die Schreibdidaktikforschung sieht seit einigen Jahrzehnten den Erwerb der Schriftsprache sowie das Formulieren von Texten als Problem an. Diese Missstände reflektierend befasst sich die vorliegende Studie mit der Notwendigkeit, den Voraussetzungen und Möglichkeiten der systematischen Entwicklung akademischer Schreibfähigkeit seitens der Schule und der Universität. Aus der wachsenden Kluft zwischen der Qualifizierung im Rahmen der gymnasialen Oberstufe und den Schreibanforderungen der Universität resultiert die Notwendigkeit einer Norm, Sinn und Funktion wissenschaftlicher Textproduktion reflektierenden und bewusst machenden integrativen Neukonzeption der Ontogenese von Schreibfähigkeiten und –fertigkeiten.
Zu diesem Zweck werden die traditionellen, teils monothematischen schreibdidaktischen Ansätze kritisch hinterfragt sowie die vier Anforderungsbereiche des Schreibens – Prozess, Produkt, Kontext und Kontent – in ihrer Wechselwirkung aufeinander beschrieben und diskutiert.
Der Fokus der Studie richtet sich auf die soziale Determiniertheit von Schreiben. Mithilfe einer interdisziplinären Herangehensweise wird anhand des soziologischen Konzeptes der „Sozialen Welt“ das spezifische Handlungsfeld „Wissenschaft“ ausgelotet und auf soziale Erwartungen, Stile sowie kommunikative Beziehungen in der entsprechenden Diskursgemeinschaft kapriziert. Es wird herausgearbeitet, dass wissenschaftliches Schreiben notwendig als kommunikativer Prozess zu verstehen sein muss und von daher seine Bewertungsparameter erhält. Wenn das finale Ziel wissenschaftlichen Schreibens und Kommunizierens das Beschreiben, Erklären und Lösen lebens- und gesellschaftspraktischer Probleme darstellt, so muss im Verlauf schulischer und akademischer Schreibsozialisation ein Bewusstsein generiert werden, das einer Progression der Abstraktion wissenschaftlichen Schreibens keinen Raum gewährt und die Tätigkeit des wissenschaftlichen Schreibens wieder in einen gesellschaftlich-kommunikativen Gesamtzusammenhang überführt.
Der Zweck der vorliegenden Arbeit besteht in einer Initialzündung, mithilfe jener die theoretisch erarbeiteten Hypothesen und Forderungen an adressaten-, absichts- und wirkungsorientiertes wissenschaftliches Arbeiten in eine empirische Studie zu den Möglichkeiten und Notwendigkeiten der Generierung reflektierter wissenschaftlicher Kompetenz überführt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Schreiben als interdisziplinäres Handeln: Welchen Beitrag können Angewandte Linguistik und Soziologie zur Reflexion über die Entwicklung wissenschaftspropädeutischer Schreibkompetenz leisten?
- 3. Propädeutisches, Begriffsbestimmungen und Allgemeines
- 3.1 Der Textbegriff
- 3.2 Schreiben
- 3.3 Wissenschaftssprachliche Schreibkompetenz – Versuch einer Begriffsbestimmung
- 3.4 Schreibprobleme im Studium - Hochschulsozialisation als Schreib- und Sprachsozialisation
- 4. Der Schreibprozess als komplexes Selbstmanagement
- 5. Der Kontext - die soziale Determiniertheit des Schreibens
- 6. Zur normorientierten Seite des Schreibens – die Produktperspektive
- 7. Zur inhaltlichen Dimension des Schreibens
- 7.1 Textproduktion und wissenschaftliche Erkenntnis
- 7.2 Epistemisches und emanzipiertes Schreiben
- 8. Perspektivenintegration und Schlussbetrachtung
- 8.1 Multiperspektivität als Chance
- 8.2 Zur Dekomponierung des Komplexphänomens „Schreiben“
- 8.3 Produkt und Prozess im Spannungsverhältnis – Zur Produkt- Prozess-Ambiguität
- 8.4 ,,Schwarze Spuren auf weißem Grund“
- 9. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entwicklung wissenschaftspropädeutischer Schreibkompetenz bei Jugendlichen an der Schwelle von der Oberstufe zur Universität. Sie analysiert den Schreibprozess als komplexes Selbstmanagement und betrachtet die sozialen Determinanten des Schreibens sowie die produkt- und prozessorientierte Sichtweise auf das Schreiben.
- Entwicklung wissenschaftspropädeutischer Schreibkompetenz
- Der Schreibprozess als Selbstmanagement
- Soziale Determinanten des Schreibens
- Produkt- und Prozessorientierung im Schreiben
- Wissenschaftliche Kommunikation und Textsorten
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik ein und stellt die Relevanz des Themas in der Postmoderne dar. Kapitel 2 beleuchtet den Beitrag von Angewandter Linguistik und Soziologie zur Reflexion über die Entwicklung wissenschaftspropädeutischer Schreibkompetenz. Kapitel 3 definiert zentrale Begriffe wie „Text“, „Schreiben“ und „Wissenschaftssprachliche Schreibkompetenz“. Kapitel 4 analysiert den Schreibprozess als komplexes Selbstmanagement und behandelt verschiedene Schreibprozessmodelle. Kapitel 5 untersucht den Kontext und die soziale Determiniertheit des Schreibens.
Schlüsselwörter
Wissenschaftspropädeutische Schreibkompetenz, Schreibprozess, Selbstmanagement, Soziale Determinanten, Produkt- und Prozessorientierung, Wissenschaftliche Kommunikation, Textsorten, Hochschulsozialisation, Schreibforschung, Wissenschaftssprache.
- Arbeit zitieren
- Magister Sebastian Achatzi (Autor:in), 2007, Der Text im Spannungsverhältnis von Produkt-, Prozess- und Kontextorientierung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92065