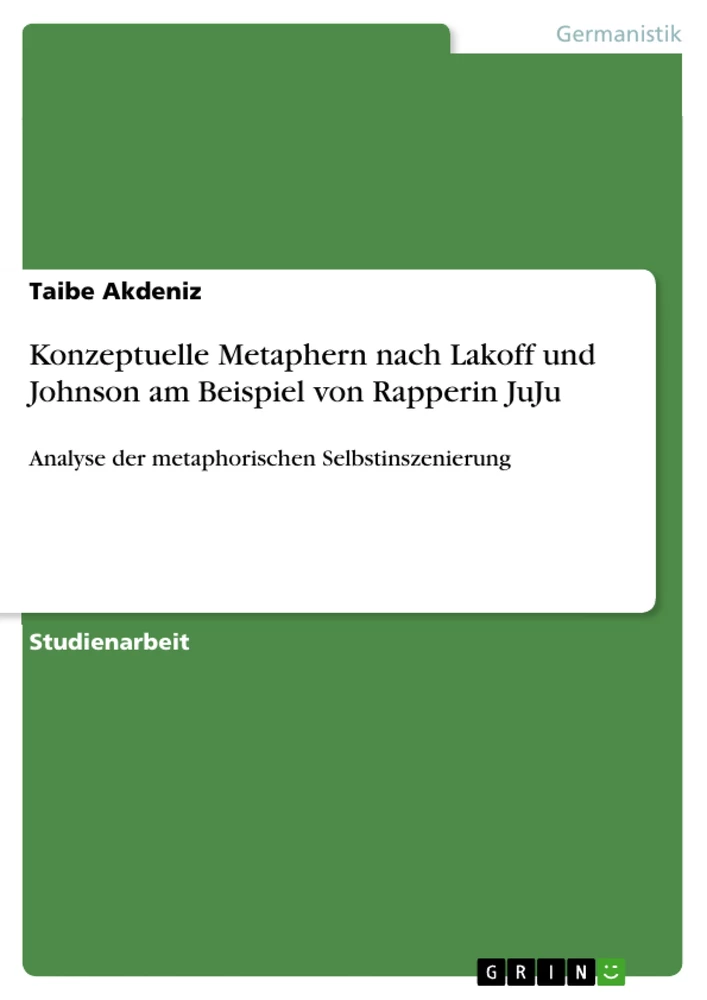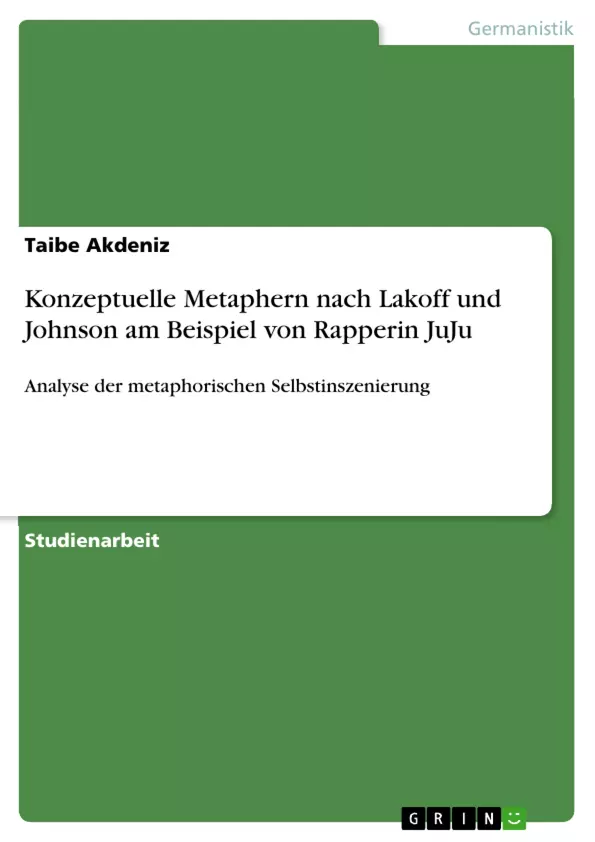Ziel dieser Hausarbeit ist es, am Beispiel der gewählten konzeptuellen Metaphorik von der Künstlerin JuJu herauszuarbeiten, wie sich Rapperinnen in ihren Texten selbstinszenieren. Im Folgenden wird daher zuerst für das bessere Verständnis der historische Kontext des HipHops, insbesondere des Genres Rap vorgestellt. Anschließend soll im theoretischen Teil der Arbeit die Metapherntheorie von Lakoff und Johnson als Grundlage für diese Hausarbeit dargestellt werden. Zum Abschluss folgt eine Metaphernanalyse anhand zweier Texte von Rapperin JuJu. Innerhalb des Fazits werden alle genannten Teilaspekte dieser Arbeit zusammengefasst und in Kürze hervorgehoben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Rap Geschichte: Aus der New Yorker Bronx nach Berlin
- 3. Sprachliche Charakteristika des Raps
- 4. Rhetorik des Raps: Der Reim
- 5. Metapherntheorie nach Lakoff & Johnson
- 6. Metaphorische Selbstinszenierung von Rapper*innen
- 7. Frauen im Deutschrap
- 8. Analysen der konzeptuellen Metaphern zur Selbstinszenierung
- 9. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die metaphorische Selbstinszenierung von Rapperinnen im Deutschrap, anhand der konzeptuellen Metaphorik der Künstlerin Juju. Das Ziel ist es, aufzuzeigen, wie Rapperinnen sich in ihren Texten selbst präsentieren. Die Arbeit beleuchtet den historischen Kontext des HipHops und Raps, die Metapherntheorie von Lakoff und Johnson und analysiert JuJus Texte auf deren metaphorische Strategien.
- Historischer Kontext des HipHops und Raps
- Metapherntheorie nach Lakoff & Johnson
- Sprachliche Charakteristika des Raps
- Metaphorische Selbstinszenierung von Rapperinnen
- Analyse der konzeptuellen Metaphorik von Juju
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der metaphorischen Selbstinszenierung von Rapperinnen im Deutschrap ein. Sie verweist auf die Bedeutung der Metapherntheorie von Lakoff und Johnson und den aktuellen Diskurs um weibliche Rollenbilder im, oft als patriarchalisch beschriebenen, HipHop. Die Arbeit kündigt die Analyse der Texte von Rapperin Juju an, um deren Selbstinszenierung anhand konzeptueller Metaphern zu untersuchen. Der Fokus liegt auf der Verwendung von Metaphern als Mittel der Selbstpräsentation und der Auseinandersetzung mit den gängigen Geschlechterrollen innerhalb der Rap-Szene. Die Einleitung dient als fundierte Einführung in das Thema und stellt die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz der Arbeit dar.
2. Rap-Geschichte: Aus der New Yorker Bronx nach Berlin: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehungsgeschichte des Raps, von seinen Wurzeln in den Ghettos der New Yorker Bronx bis zu seiner Entwicklung in der deutschen Rap-Szene. Es zeigt auf, wie der Rap als Ausdruck der Lebensrealität benachteiligter Jugendlicher entstand und sich zu einem erfolgreichen Genre entwickelte. Besonders wird die Rolle von Migrantenjugendlichen in Berlin hervorgehoben, die sich mit den Themen der amerikanischen Klassiker identifizierten und den Rap als Ventil für ihre Erfahrungen nutzten. Der Übergang von spontanen Auftritten zu durchdachten Texten mit kalkuliertem Reim und Metaphern wird detailliert dargestellt, und der Rap als „message music“ – Musik mit einer Botschaft – etabliert. Das Kapitel verdeutlicht die soziokulturellen Hintergründe und die Entwicklung des Raps bis zu seinem heutigen Erfolg im deutschsprachigen Raum, inklusive der Veränderung der Sprache und des Stils.
3. Sprachliche Charakteristika des Raps: Dieses Kapitel fokussiert sich auf die sprachlichen Besonderheiten des Raps. Es betont die direkte Kommunikation mit dem Publikum durch die Verwendung des „du“, das Ziel des Raps als „musikalisches Aufklärungs- und Kommunikations-Medium“ zu fungieren und die Bedeutung der Selbstvorstellung des Rappers zu Beginn eines Liedes. Am Beispiel von JuJus Intro wird die direkte Ansprache des Hörers und die Nennung des Künstlernamens als wichtiger formaler Bestandteil erläutert. Das Kapitel verdeutlicht die interaktive Natur des Raps und die strategische Nutzung der Sprache zur Vermittlung der Botschaft und zur Interaktion mit dem Publikum. Die Rolle des Rappers als Sprachrohr und Botschafter wird im Kontext der direkten Ansprache und des Aufbaus einer Verbindung zum Publikum erklärt.
Schlüsselwörter
Deutschrap, Juju, Metapher, konzeptuelle Metapher, Lakoff & Johnson, Selbstinszenierung, HipHop, Rapperinnen, Geschlechterrollen, Sprachliche Analyse, Metaphernanalyse, Identität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Metaphorische Selbstinszenierung von Rapperinnen im Deutschrap
Was ist das Thema der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die metaphorische Selbstinszenierung von Rapperinnen im Deutschrap, insbesondere anhand der Texte der Künstlerin Juju. Der Fokus liegt auf der Analyse der konzeptuellen Metaphern, die Juju verwendet, um sich in ihren Texten selbst zu präsentieren und mit den gängigen Geschlechterrollen innerhalb der Rap-Szene umzugehen.
Welche Ziele verfolgt die Hausarbeit?
Die Arbeit möchte aufzeigen, wie Rapperinnen sich durch Metaphern in ihren Texten inszenieren. Sie beleuchtet den historischen Kontext des HipHop und Raps, die Metapherntheorie von Lakoff und Johnson und analysiert JuJus Texte auf deren metaphorische Strategien. Zusammenfassend geht es darum, die Selbstpräsentation von Rapperinnen mittels sprachlicher Mittel zu verstehen.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Hausarbeit behandelt folgende Themen: die Geschichte des Raps von der New Yorker Bronx bis nach Berlin, die sprachlichen Charakteristika des Raps, die Metapherntheorie nach Lakoff & Johnson, die metaphorische Selbstinszenierung von Rapperinnen im Allgemeinen und speziell bei Juju, sowie eine Analyse der konzeptuellen Metaphern in JuJus Texten. Der Kontext der Geschlechterrollen im oft als patriarchalisch beschriebenen HipHop spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit besteht aus neun Kapiteln: Einleitung, Rap-Geschichte, sprachliche Charakteristika des Raps, Rhetorik des Raps (Reim), Metapherntheorie nach Lakoff & Johnson, metaphorische Selbstinszenierung von Rapperinnen, Frauen im Deutschrap, Analyse der konzeptuellen Metaphern zur Selbstinszenierung bei Juju und Fazit.
Wie wird die Metapherntheorie in der Arbeit angewendet?
Die Metapherntheorie von Lakoff und Johnson dient als theoretischer Rahmen für die Analyse der Texte von Juju. Die Arbeit untersucht, welche konzeptuellen Metaphern Juju verwendet und wie diese zur Konstruktion ihrer Selbstinszenierung beitragen. Es wird also analysiert, wie sie durch Metaphern bestimmte Bilder von sich selbst und ihrer Rolle im Deutschrap erzeugt.
Welche Rolle spielt die Künstlerin Juju in der Hausarbeit?
Juju dient als Fallbeispiel für die Analyse der metaphorischen Selbstinszenierung von Rapperinnen. Ihre Texte werden detailliert untersucht, um die Verwendung von konzeptuellen Metaphern und deren Bedeutung für ihre Selbstpräsentation aufzuzeigen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit am besten?
Deutschrap, Juju, Metapher, konzeptuelle Metapher, Lakoff & Johnson, Selbstinszenierung, HipHop, Rapperinnen, Geschlechterrollen, Sprachliche Analyse, Metaphernanalyse, Identität.
Wie ist der methodische Ansatz der Hausarbeit?
Die Arbeit verwendet eine sprachwissenschaftliche Methode, insbesondere die Analyse konzeptueller Metaphern nach Lakoff & Johnson, um die Selbstinszenierung von Rapperinnen im Deutschrap zu untersuchen. Der Fokus liegt auf der Interpretation der verwendeten Metaphern und deren Bedeutung im Kontext des Raps und der Geschlechterrollen.
Welche Bedeutung hat der historische Kontext des Raps für die Arbeit?
Der historische Kontext des Raps, von seinen Ursprüngen in der Bronx bis zur Entwicklung im deutschen Sprachraum, wird beleuchtet, um die soziokulturellen Hintergründe und die Entwicklung des Raps als Genre zu verstehen. Dies ermöglicht eine fundiertere Analyse der sprachlichen Mittel und der Selbstinszenierung der Rapperinnen im heutigen Deutschrap.
- Quote paper
- Taibe Akdeniz (Author), 2020, Konzeptuelle Metaphern nach Lakoff und Johnson am Beispiel von Rapperin JuJu, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/920660