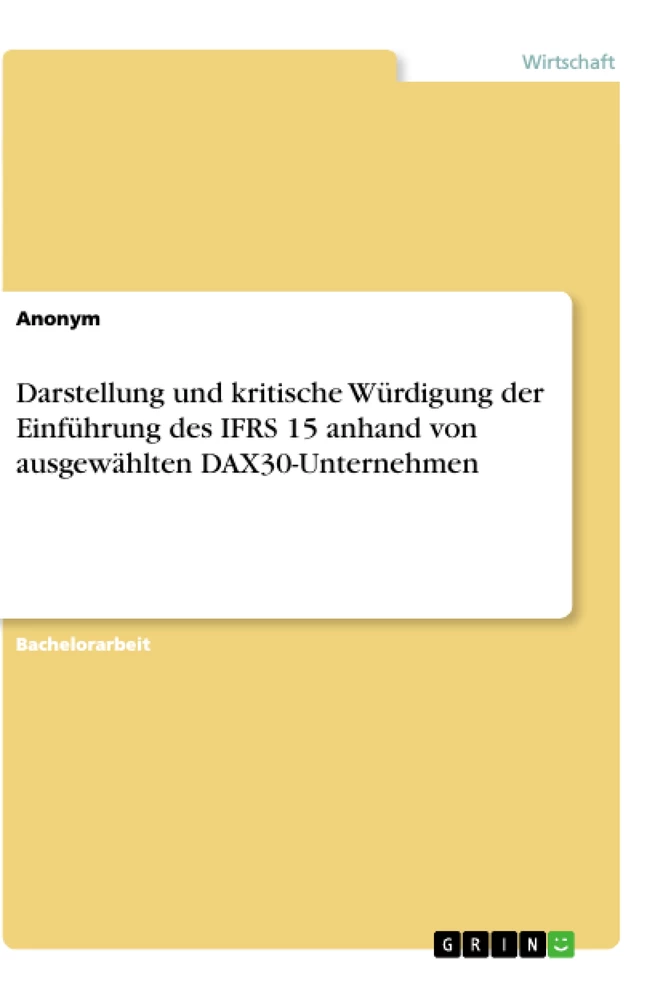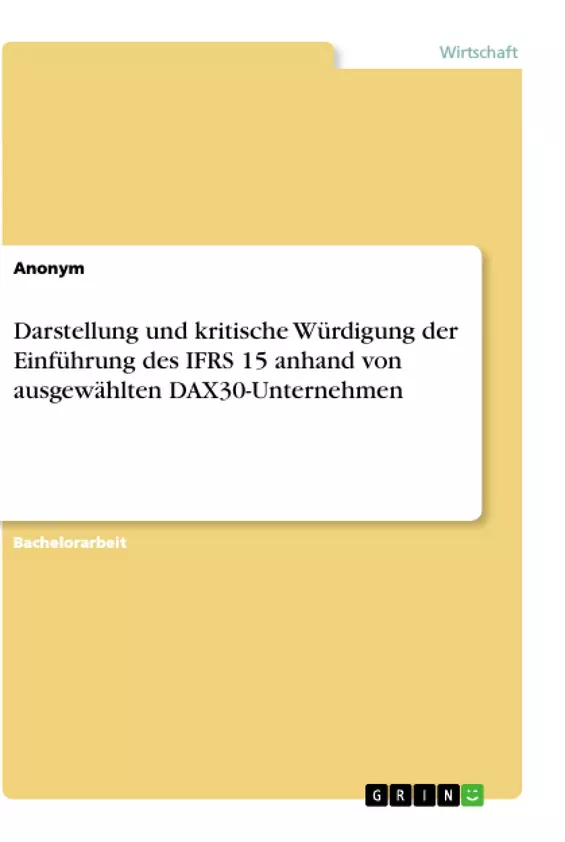Mit Blick auf die hohe Relevanz der Umsatzerlöse soll der IFRS 15 im Rahmen der Bachelor-Thesis untersucht werden. Die Forschungsfrage lautet, welche Veränderungen in der Bilanzierungspraxis auftreten. Ferner ist zu untersuchen, wie sich der neue IFRS 15 in der Bilanz, der Gesamtergebnisrechnung und im Anhang bei den Unternehmen auswirkt bzw. wie er umgesetzt wird.
Zur Beantwortung der Forschungsfrage erfolgt zunächst eine Darstellung der ehemaligen Standards zur Umsatzrealisation, IAS 11: Fertigungsaufträge sowie IAS 18: Umsatzerlöse. Nach einer historischen Veranschaulichung der Entstehung des IFRS 15 wird das Fünf-Schritte-Konzept zur Umsatzrealisierung vorgestellt sowie die Darstellung und dazugehörigen Angaben beschrieben. Darauffolgend wird innerhalb der kritischen Würdigung auf die primären Unterschiede der alten und des neuen Standards verwiesen, um die Veränderungen in der Bilanzierungspraxis zu diskutieren, sowie die durch das IASB verfolgte
Zielsetzung zu evaluieren.
Bereits vor dem Inkrafttreten des Standards haben sich zahlreiche Veröffentlichungen mit möglichen Konsequenzen des Standards auseinandergesetzt. Dabei erfolgt im empirischen Teil dieser Arbeit eine Untersuchung ausgewählter DAX30-Unternehmen, die Aufschluss über die Auswirkungen geben soll. Mit der Veröffentlichung der Geschäftsberichte für das Jahr 2019 ergibt sich erstmals die Gelegenheit, die Auswirkungen des IFRS 15 auf Basis von zwei Anwendungsjahren zu analysieren. Im fünften Kapitel der Arbeit erfolgt eine Darlegung der gewonnen Erkenntnisse und abschließende Betrachtung des IFRS 15.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung und Gang der Arbeit
- Darstellung der bisherigen Standards zur Umsatzrealisation
- Darstellung des IAS 18: Umsatzerlöse
- Erträge aus dem Verkauf von Gütern
- Erträge aus dem Erbringen von Dienstleistungen
- Erträge aus der Nutzung von Vermögensgegenständen durch Dritte
- Darstellung des IAS 11: Fertigungsaufträge
- Auftragserlöse und Auftragskosten
- Percentage-of-completion-Methode
- Modifizierte Completed-Contract-Methode
- Darstellung des IFRS 15: Erlöse aus Verträgen mit Kunden
- Entstehung des IFRS 15: Erlöse aus Verträgen mit Kunden
- Fünf-Schritte-Modell zur Umsatzrealisation
- Schritt 1: Identifikation von Verträgen mit Kunden
- Schritt 2: Identifikation separater Leistungsverpflichtungen
- Schritt 3: Bestimmung des Transaktionspreises
- Schritt 4: Allokation des Transaktionspreises
- Schritt 5: Erfassung der Umsatzerlöse
- Darstellung und Angaben zum IFRS 15
- Vergleichende kritische Würdigung der Standards
- Auswirkung des IFRS 15 auf ausgewählte DAX30-Unternehmen
- Stand der Forschung
- Untersuchungsdesign und Gang der Untersuchung
- Auswirkung durch IFRS 15: Erlöse aus Verträgen mit Kunden
- Kritische Würdigung der Ergebnisse
- Schlussbetrachtung
- Zusammenfassung der bisherigen Erkenntnisse
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelor-Thesis befasst sich mit der Darstellung und kritischen Würdigung der Einführung des IFRS 15 anhand von ausgewählten DAX30-Unternehmen. Sie analysiert die Auswirkungen des neuen Standards auf die Umsatzrealisation und die Jahresabschlüsse dieser Unternehmen.
- Entwicklung und Bedeutung des IFRS 15 für die Rechnungslegung
- Analyse der fünf Schritte zur Umsatzrealisation im IFRS 15
- Untersuchung der Auswirkungen des IFRS 15 auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung von DAX30-Unternehmen
- Kritische Würdigung der Auswirkungen des IFRS 15 auf die Transparenz und Vergleichbarkeit der Rechnungslegung
- Bewertung der Chancen und Risiken des IFRS 15 für Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit beleuchtet die Problemstellung und die Zielsetzung der Untersuchung. Es werden die Herausforderungen bei der Anwendung des IFRS 15 und die Notwendigkeit einer umfassenden Analyse der Auswirkungen des Standards hervorgehoben. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den bisherigen Standards zur Umsatzrealisation, insbesondere mit dem IAS 18 und dem IAS 11. Es analysiert die verschiedenen Kriterien und Methoden zur Erfassung von Umsatzerlösen und zeigt die Unterschiede zu den Vorgaben des IFRS 15 auf. Das dritte Kapitel stellt den IFRS 15 detailliert vor und erklärt das Fünf-Schritte-Modell zur Umsatzrealisation. Es beschreibt die einzelnen Schritte, die bei der Anwendung des Standards zu beachten sind, und geht auf die verschiedenen Arten von Verträgen und Leistungsverpflichtungen ein. Das vierte Kapitel untersucht die Auswirkungen des IFRS 15 auf ausgewählte DAX30-Unternehmen. Es analysiert die Anpassungseffekte des Standards auf die Vermögenslage, die Ertragslage und die Anhangangaben von Unternehmen. Das fünfte Kapitel fasst die Ergebnisse der Untersuchung zusammen und zieht ein Fazit. Es bewertet die Auswirkungen des IFRS 15 auf die Rechnungslegung und die Transparenz der Finanzberichterstattung.
Schlüsselwörter
IFRS 15, Umsatzrealisation, DAX30-Unternehmen, Rechnungslegung, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Transaktionspreis, Leistungsverpflichtungen, Vertragsänderungen, Anhangangaben, Transparenz, Vergleichbarkeit, Chancen, Risiken.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern von IFRS 15?
IFRS 15 regelt die Umsatzrealisierung aus Verträgen mit Kunden und ersetzt die alten Standards IAS 11 und IAS 18 durch ein einheitliches Fünf-Schritte-Modell.
Wie funktioniert das Fünf-Schritte-Modell?
Es umfasst: 1. Identifikation des Vertrags, 2. Identifikation der Leistungsverpflichtungen, 3. Bestimmung des Transaktionspreises, 4. Allokation des Preises, 5. Erfassung des Umsatzes bei Erfüllung.
Welche Auswirkungen hat IFRS 15 auf DAX30-Unternehmen?
Der Standard führt zu Änderungen in der Bilanzierungspraxis, beeinflusst die Gewinn- und Verlustrechnung und erfordert deutlich umfangreichere Angaben im Anhang.
Warum wurde IFRS 15 eingeführt?
Ziel des IASB war es, die Transparenz und weltweite Vergleichbarkeit von Umsatzerlösen zu verbessern und Schwächen der alten, oft branchenspezifischen Regeln zu beheben.
Was ist der Transaktionspreis laut IFRS 15?
Es ist der Betrag der Gegenleistung, den ein Unternehmen im Austausch für die Übertragung von Gütern oder Dienstleistungen erwartet, bereinigt um variable Bestandteile.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2020, Darstellung und kritische Würdigung der Einführung des IFRS 15 anhand von ausgewählten DAX30-Unternehmen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/922758