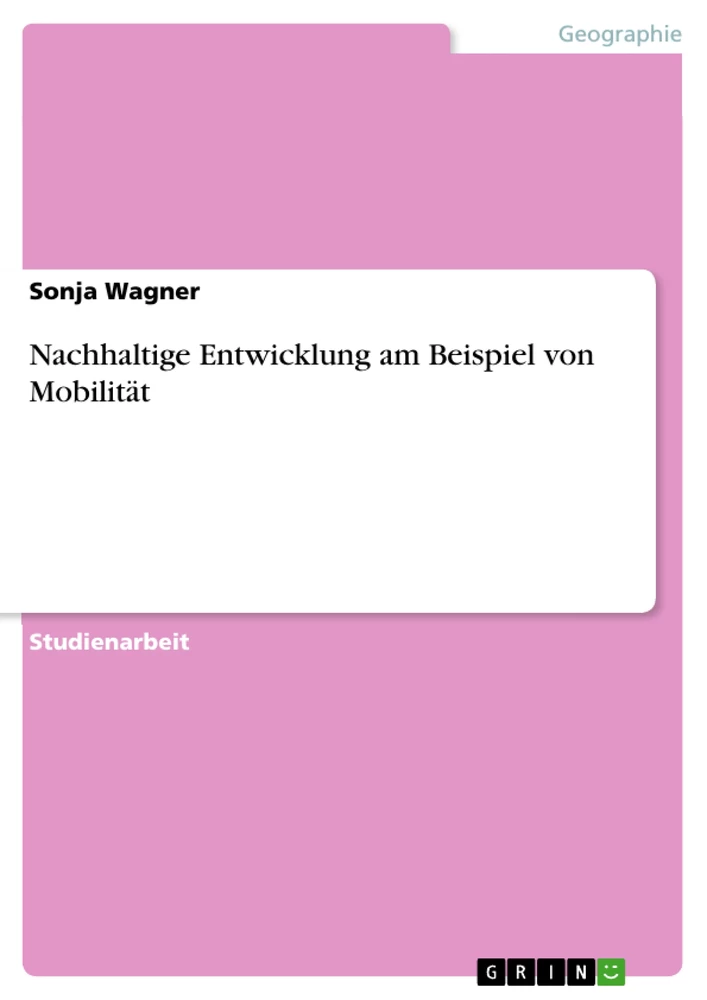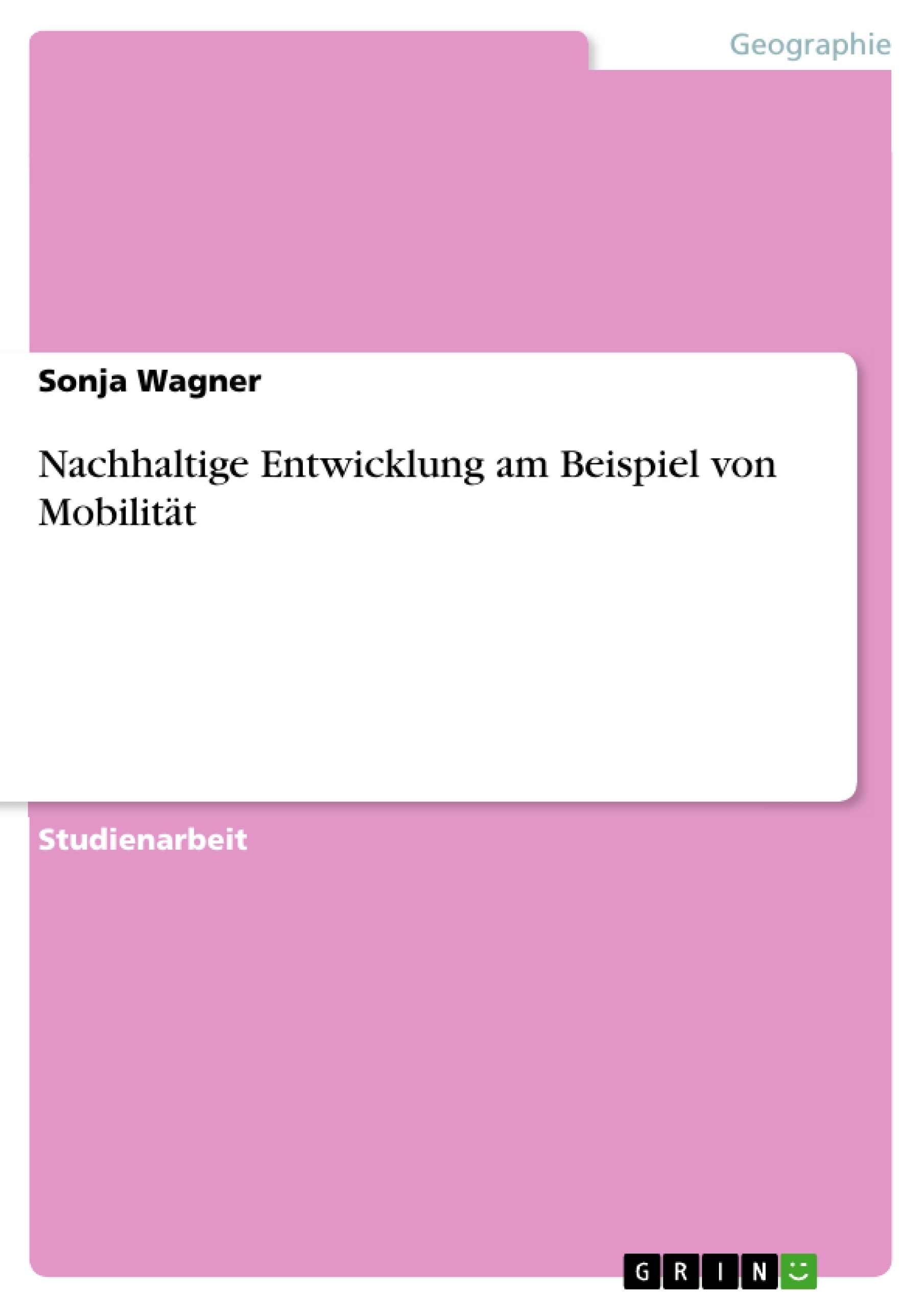In dieser Arbeit soll Mobilität in Zusammenhang mit Verkehr und einer nachhaltigen Entwicklung betrachtet werden.
Nachdem ich nun den Begriff „Mobilität“ geklärt habe, möchte ich darstellen, wie sich Mobilität im Laufe der Zeit entwickelt hat, welche Auswirkungen der Verkehr auf die Umwelt und die Psyche der Menschen hat und wie man Verkehr einschränken kann. Vor diesem Hintergrundwissen versuche ich dann Ansatzpunkte zu geben für konkrete Umsetzungsvorschläge im Unterricht zum Thema Mobilität und nachhaltige Entwicklung. Mobilität wird in unseren Zeiten immer wichtiger. Sei es in der Erwachsenenwelt, wo das
Berufsleben die Bereitschaft der Arbeitnehmer erfordert, täglich zum Arbeitsplatz zu pendeln
oder öfters den Wohnsitz zu wechseln, sei es in der Welt der Jugendlichen, wo Mobilität vor
allem mit Freizeitaktivitäten in Verbindung gebracht wird.
Doch was versteht man ganz genau unter Mobilität? Wörterbücher wie das Fremdwörterbuch
von WAHRIG (1993, S. 456) definieren unter „Mobilität“ „Beweglichkeit“ und „Häufigkeit
des Wohnungs-, Wohnsitzwechsels“.
Man kann verschiedene Arten von Mobilität unterscheiden; Mobilität ist dabei nicht nur auf
einen räumlichen Ortswechsel beschränkt, sondern kann auch einen gesellschaftlichen
Ortswechsel beschreiben. Den Begriff „soziale Mobilität“ beispielsweise definierte der
Soziologe Pitrim A. Sorokin 1927 folgendermaßen: Unter sozialer Mobilität versteht man
„positionell-soziale Bewegungsvorgänge von Personen oder Personengruppen zwischen
Regionen und/oder zwischen gesellschaftlich definierten Positionen, Kategorien, Berufen,
Klassen oder Schichten“ (zit. nach FELDHAUS 1998, S. 44 ff.). Diese Faktoren prägen also
eine „mobile Gesellschaft“.
Die Mobilitätsrate beschreibt die Summe aller Ortsveränderungen eines Individuums in einer
bestimmten Zeitspanne. Doch man darf Mobilität nach FELDHAUS nicht mit
Fahrtenhäufigkeit gleichsetzen und schon gar nicht mit nur motorisierten Fahrten, da unter
Mobilität Bewegung allgemein gemeint ist. Die Entwicklung der Mobilität ist also nicht mit
Entwicklung der Motorisierung gleichzusetzen! Die Weghäufigkeit stieg seit den 1950ern
nicht signifikant, dafür aber die Fahrtenhäufigkeit. Eine weitere Differenzierung der Mobilität kann zwischen Zweckmobilität und
Erlebnismobilität vorgenommen werden. Unter „Zweckmobilität“ versteht FELDHAUS
(1998, S.47) gebundene Reisezwecke wie Fahrten für den Beruf, das Geschäft oder die
Ausbildung.
Inhaltsverzeichnis
- Definition von Mobilität und Arten von Mobilität
- Mobilität früher und heute
- Auswirkungen des Verkehrs
- Soziale Auswirkungen des Verkehrs
- Ökologische Auswirkungen des Verkehrs
- Was kann man gegen den Verkehr tun oder wie kann man Mobilität sinnvoll nutzen, um die Umwelt zu schonen?
- Didaktischer Abriss
- Praktische Unterrichtsbeispiele
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema Mobilität und deren Auswirkungen auf die Umwelt, insbesondere im Kontext einer nachhaltigen Entwicklung. Ziel ist es, die Bedeutung von Mobilität in der heutigen Gesellschaft zu verdeutlichen und verschiedene Aspekte der Mobilität, wie Verkehr und Transport, zu beleuchten.
- Definition und Arten von Mobilität
- Entwicklung der Mobilität im Laufe der Zeit
- Soziale und ökologische Auswirkungen des Verkehrs
- Möglichkeiten zur Reduzierung des Verkehrs und sinnvolle Nutzung von Mobilität
- Didaktische Ansätze zur Vermittlung von Mobilität und nachhaltiger Entwicklung im Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel definiert den Begriff „Mobilität“ und unterscheidet verschiedene Arten von Mobilität, einschließlich sozialer Mobilität. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Entwicklung der Mobilität im Laufe der Geschichte, wobei die Motorisierung und die Zunahme des Autoverkehrs im Fokus stehen. Kapitel drei beleuchtet die sozialen und ökologischen Auswirkungen des Verkehrs, insbesondere die Belastungen für die Umwelt.
Schlüsselwörter
Mobilität, Verkehr, nachhaltige Entwicklung, Umwelt, Verkehrswende, Umwelterziehung, Didaktik, Erdkundeunterricht, soziale Auswirkungen, ökologische Auswirkungen, Verkehrsmittel, Mobilitätsverhalten.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Mobilität im Kontext dieser Arbeit definiert?
Mobilität wird als allgemeine Beweglichkeit verstanden, die sowohl räumliche Ortswechsel als auch soziale Veränderungen (Beruf, Schicht) umfasst.
Was ist der Unterschied zwischen Mobilität und Verkehr?
Mobilität ist das Bedürfnis oder die Fähigkeit zur Bewegung, während Verkehr die tatsächliche Realisierung dieser Bewegung mit Verkehrsmitteln beschreibt.
Welche ökologischen Auswirkungen hat der moderne Verkehr?
Verkehr trägt massiv zu Umweltbelastungen bei, darunter CO2-Emissionen, Lärmbelästigung und Flächenverbrauch, was im Widerspruch zu einer nachhaltigen Entwicklung steht.
Was versteht man unter „sozialer Mobilität“?
Nach Pitrim Sorokin beschreibt sie die Bewegung von Personen zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Positionen, Berufen oder Klassen.
Wie kann das Thema Mobilität im Unterricht vermittelt werden?
Die Arbeit bietet didaktische Ansätze und praktische Beispiele, um Schülern die Zusammenhänge zwischen Verkehrsverhalten, Umwelt und nachhaltiger Lebensweise näherzubringen.
- Arbeit zitieren
- M.B.A. + Eng. Sonja Wagner (Autor:in), 2002, Nachhaltige Entwicklung am Beispiel von Mobilität, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92553