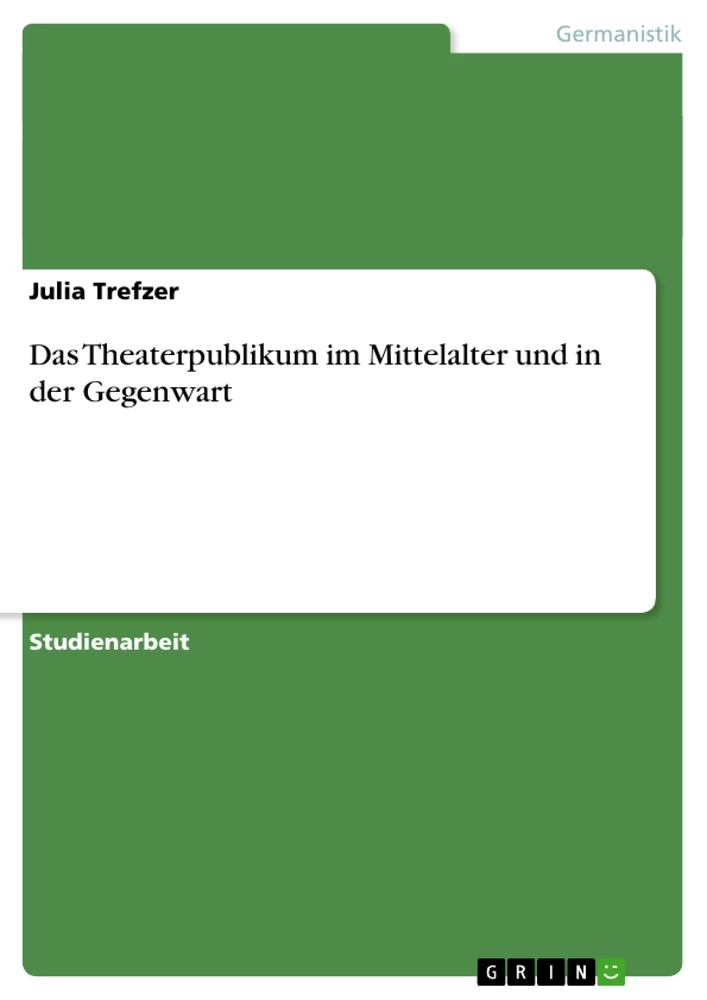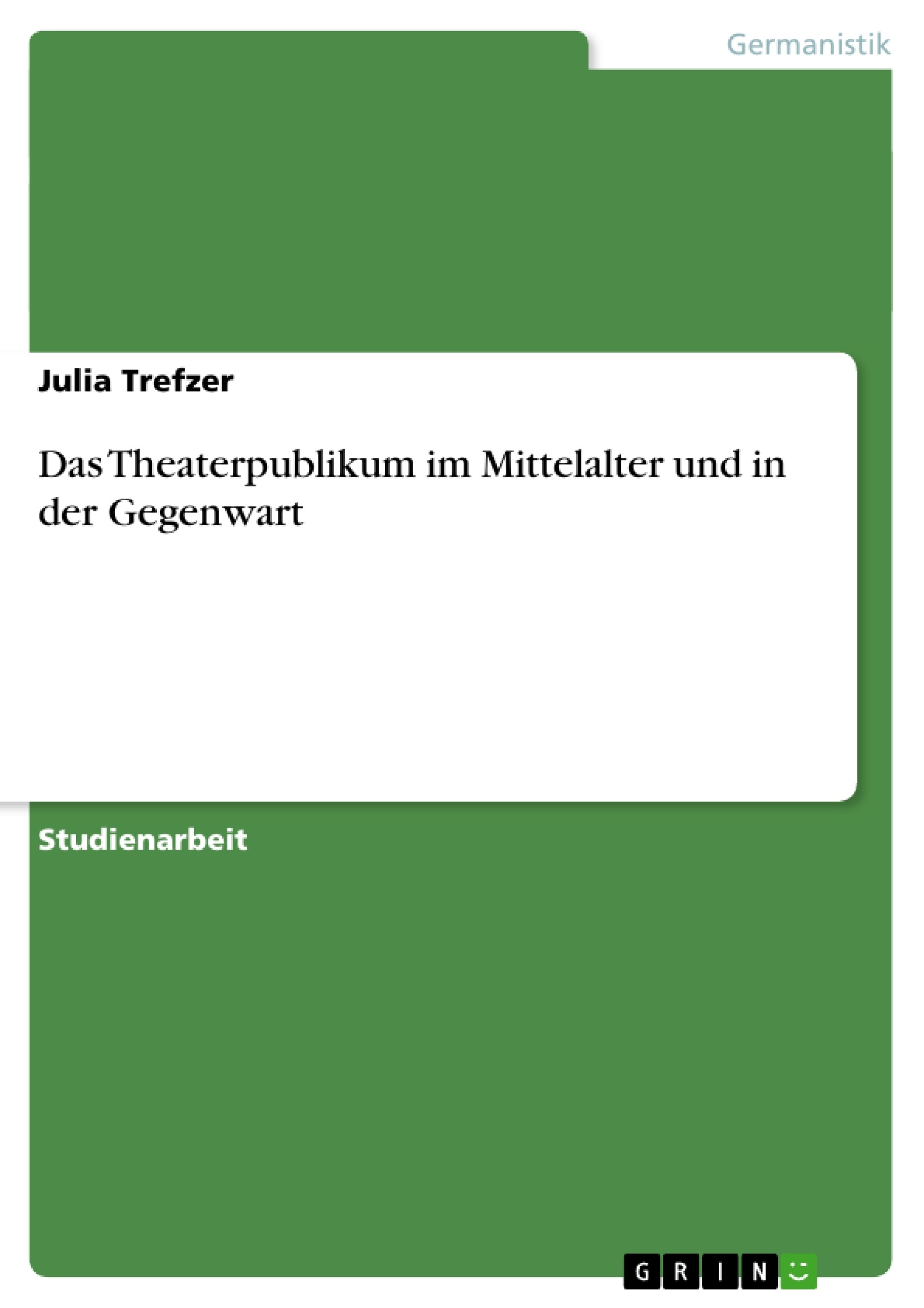Was sind unsere Versammlungen im Theater heute gegen die Versammlungen des Volkes im Spätmittelalter? Die alten Bühnen auf dem Marktplatz konnten an feierlichen Tagen die Aufmerksamkeit eines ganzen Volkes in ihren Bann ziehen. Wie viel Gewalt eine große Menge von Zuschauern hat wird deutlich an dem Eindruck, den die Menschen aufeinander machen. Die Schaubühne ist mehr als jede andere öffentliche Veranstaltung des Staates eine Schule der praktischen Weisheit oder ein Wegweiser durch das bürgerliche Leben. Das Massentheater entfaltete sich unter grundverschiedenen geistesgeschichtlichen Voraussetzungen. Im Mittelalter, einem Zeitalter des steil wachsenden Stadt- Phänomens, waren die sozialen Spannungen genauso spürbar wie die unterschiedlichen religiösen Impulse und die Reaktionen darauf, je nachdem, ob es um eine gradualistische oder nominalistische Entwicklungsphase ging. Von tiefer Furcht bis zur Freude am gemeinsamen Erlebnis ist am Publikumsverhalten im Mittelalter einiges abzulesen, was schon über den theatralischen Bereich hinausgeht. Das Verhalten des Publikums bei den religiösen Spielen ist ja nur ein stellvertretendes Symbol für den jeweiligen Kulturzustand des betreffenden Bevölkerungskreises und für die politische und wirtschaftliche Lebenserfahrung. Dies gilt für das Publikum im Spätmittelalter genauso wie für das der Gegenwart. Doch warum stand damals das Publikum stellvertretend für das ganze Volk und warum kann heute von ,,dem Publikum“ als solchem nicht mehr die Rede sein? Im Folgenden werde ich mich mit dieser Frage näher beschäftigen.
Im Hauptteil der Arbeit beleuchte ich die Wirkung der religiösen Spiele auf das spätmittelalterliche Volk und dessen Verhalten. Daran anknüpfend gebe ich einen Ausblick auf das Zuschauerverhalten der Gegenwart. Der Aufstieg von ,,Stadt und Bürgertum" im Spätmittelalter führte zu einer kulturellen Gegenposition gegenüber der ritterlich- höfischen Kultur des Hochmittelalters. Der Wille zur Selbstverantwortung setzte ein, nicht nur im Gemeinwesen und in der Wirtschaft, sondern auch in religiösen Bereichen. Die Bürger wollten nicht mehr bloß Empfangene, sondern Mitwirkende, Mitgestaltende und Mitverantwortliche sein. Die lateinische Botschaft, die sie früher in Symbolhandlungen sahen, wollten sie nun in ihrer eigenen Muttersprache in aktionelle Formen umsetzen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- 2.1 Rollenwechsel des Publikums
- 2.2 Folgen des Urbanismus
- 2.3 Identifikation des Publikums
- 2.4 Publikumswirksame Aktualisierung
- 2.5 Rhetorische Ansprache
- 2.6 Sprache der Schauspieler
- 2.7 Was lernt der Zuschauer vom Theater
- 2.8 Publikum Gegenwart im Vergleich Mittelalter
- 3. Schluss
- Quellenangaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Wandel des Theaterpublikums vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Sie analysiert die unterschiedlichen Rollen des Publikums in religiösen Spielen des Spätmittelalters und setzt diese in Relation zum modernen Theatererlebnis. Im Fokus steht der Vergleich der gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen, die das jeweilige Publikumsverhalten prägten.
- Rollenverständnis des Publikums im Mittelalter
- Einfluss des Urbanismus auf das Theatererlebnis
- Soziale Zusammensetzung und Identifikation des mittelalterlichen Publikums
- Vergleich des Publikumsverhaltens im Mittelalter und in der Gegenwart
- Die Funktion des Theaters als Spiegel der Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Unterschied zwischen dem Theaterpublikum des Spätmittelalters und dem der Gegenwart. Sie verweist auf die enorme Bedeutung öffentlicher Veranstaltungen im Mittelalter, insbesondere des Massentheaters, welches sich unter geistesgeschichtlich unterschiedlichen Bedingungen entwickelte. Die Einleitung hebt die sozialen Spannungen und religiösen Impulse des Mittelalters hervor und deutet auf die Bandbreite emotionaler Reaktionen des Publikums hin, die weit über das rein Theatralische hinausgingen. Die Arbeit kündigt die Auseinandersetzung mit dem Wandel des Publikumsverständnisses an.
2.1 Rollenwechsel des Publikums: Dieses Kapitel beschreibt den Rollenwechsel des Publikums im Spätmittelalter. Der Aufstieg des Bürgertums führte zu einer kulturellen Gegenposition zur höfischen Kultur. Bürger wollten nicht mehr passive Empfänger, sondern aktive Mitwirkende sein, was sich in der Forderung nach Aufführungen in der Muttersprache und der Betonung aktionaler Formen zeigte. Das Publikum und die Schauspieler bildeten eine Gemeinschaft, die die Heilsgeschichte gemeinsam erlebte. Der Ortswechsel von der Kirche zum Marktplatz symbolisierte diese neue Rolle des aktiven, mitgestaltenden Publikums, das seine eigene Wirklichkeit auf der Bühne spiegeln sehen wollte.
2.2 Folgen des Urbanismus: Der Marktplatz als Ort der Kommunikation und der religiösen Spiele wird hier beleuchtet. Diese Spiele dienten gleichzeitig als Hilferuf und Unterhaltung in einer Zeit politischer Instabilität, Seuchen und Gefährdungen. Die Ambivalenz von Angst und Freude, Grauen und Lachen kennzeichnet das Publikumserlebnis. Der Text verweist auf die Unsicherheiten im urbanen Leben, die die Bürger dazu zwangen, ihre Freiheiten zu verteidigen. Die Angst vor Unruhestiftern und Seuchen wird anhand des Beispiels der Vorsichtsmaßnahmen des Rates von Angers verdeutlicht. Die Spiele besaßen einen Beschwörungscharakter, der durch humorvolle Elemente die Todesangst der Menschen zu überdecken versuchte.
2.3 Identifikation des Publikums: Dieses Kapitel beschreibt die soziale Vielfalt des spätmittelalterlichen Theaterpublikums, das aus allen Gesellschaftsschichten bestand. Trotz unterschiedlicher Lebensrealitäten vereinte das gemeinsame Theatererlebnis die Zuschauer in Erwartung, Mitgefühl und dem gemeinsamen Hoffen auf göttliche Hilfe. Die Nennung von realen Orten aus dem Leben der Zuschauer verstärkte die Identifikation mit den dargestellten Ereignissen.
Schlüsselwörter
Theaterpublikum, Mittelalter, Gegenwart, religiöse Spiele, Urbanismus, soziale Identifikation, Rollenverständnis, Massentheater, gesellschaftliche Spiegelung.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Wandel des Theaterpublikums vom Mittelalter bis zur Gegenwart
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Wandel des Theaterpublikums vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der Rollen des Publikums in religiösen Spielen des Spätmittelalters und im modernen Theater, unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt unter anderem das Rollenverständnis des Publikums im Mittelalter, den Einfluss des Urbanismus auf das Theatererlebnis, die soziale Zusammensetzung und Identifikation des mittelalterlichen Publikums, einen Vergleich des Publikumsverhaltens im Mittelalter und in der Gegenwart sowie die Funktion des Theaters als Spiegel der Gesellschaft.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil (mit Unterkapiteln zu Rollenwechsel des Publikums, Folgen des Urbanismus, Identifikation des Publikums, Publikumswirksame Aktualisierung, Rhetorische Ansprache, Sprache der Schauspieler, Was lernt der Zuschauer vom Theater und Publikum Gegenwart im Vergleich Mittelalter) und einen Schluss sowie Quellenangaben.
Was ist die zentrale Forschungsfrage der Einleitung?
Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Unterschied zwischen dem Theaterpublikum des Spätmittelalters und dem der Gegenwart. Sie hebt die Bedeutung öffentlicher Veranstaltungen im Mittelalter und die sozialen Spannungen und religiösen Impulse hervor.
Wie beschreibt der Text den Rollenwechsel des Publikums im Spätmittelalter?
Kapitel 2.1 beschreibt den Aufstieg des Bürgertums und dessen Wunsch nach aktiver Mitwirkung am Theater, statt passiver Rezeption. Die Aufführungen in der Muttersprache und die Betonung aktionaler Formen spiegeln dies wider. Publikum und Schauspieler bildeten eine Gemeinschaft, die die Heilsgeschichte gemeinsam erlebte.
Welchen Einfluss hatte der Urbanismus auf das Theatererlebnis?
Kapitel 2.2 beleuchtet den Marktplatz als Ort der Kommunikation und der religiösen Spiele. Diese dienten als Hilferuf und Unterhaltung in einer Zeit politischer Instabilität und Seuchen. Die Ambivalenz von Angst und Freude kennzeichnete das Publikumserlebnis. Die Spiele besaßen einen Beschwörungscharakter.
Wie wird die Identifikation des Publikums beschrieben?
Kapitel 2.3 beschreibt die soziale Vielfalt des spätmittelalterlichen Publikums. Trotz unterschiedlicher Lebensrealitäten vereinte das gemeinsame Theatererlebnis die Zuschauer in Erwartung, Mitgefühl und dem gemeinsamen Hoffen auf göttliche Hilfe.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind Theaterpublikum, Mittelalter, Gegenwart, religiöse Spiele, Urbanismus, soziale Identifikation, Rollenverständnis, Massentheater und gesellschaftliche Spiegelung.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, der Text enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, die die wichtigsten Punkte und Argumente jedes Kapitels prägnant zusammenfasst.
- Quote paper
- Julia Trefzer (Author), 2005, Das Theaterpublikum im Mittelalter und in der Gegenwart, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92759