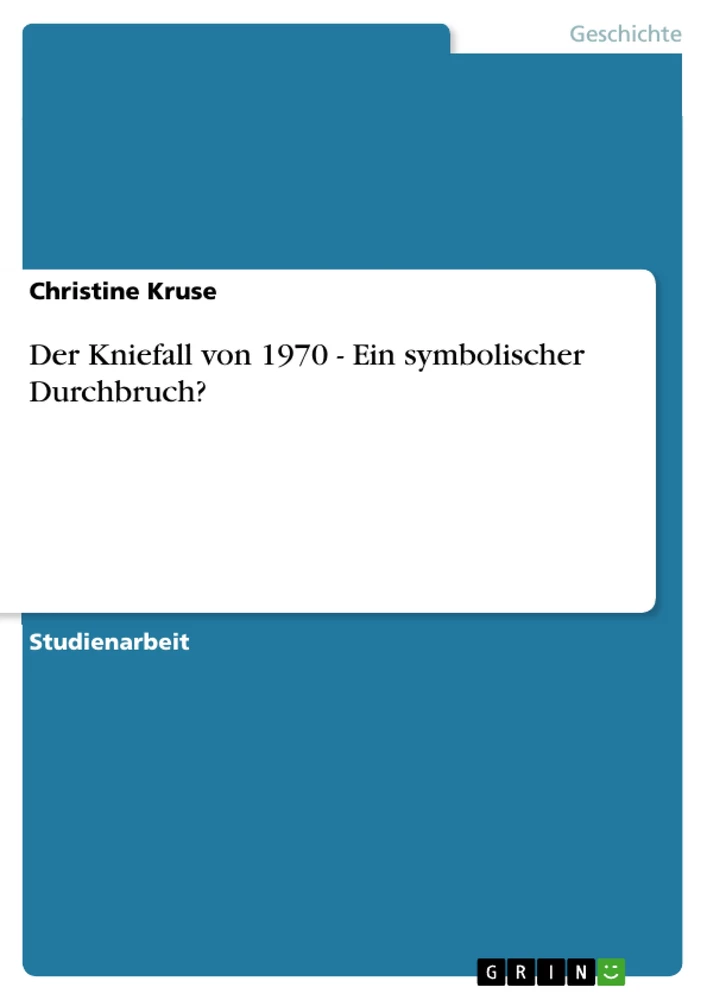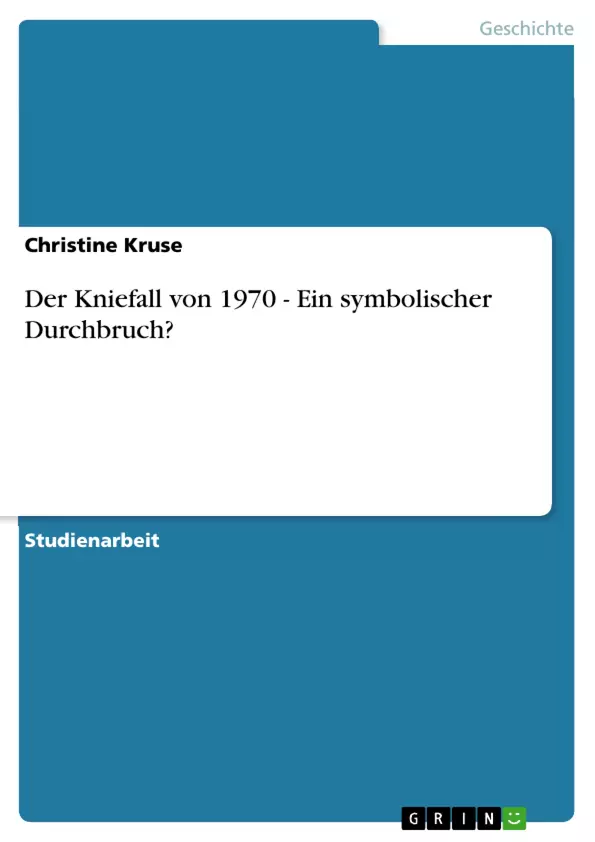Der Morgen des 7. Dezember 1970 ist ein kalter und regnerischer in Warschau. Um etwa 10.30 Uhr trifft der damalige Bundeskanzler Willy Brandt auf dem Platz vor dem Denkmal des Warschauer Ghettos ein. Begleitet wird er von einer Delegation an Politikern, Diplomaten und Journalisten aus Deutschland und dem Gastgeberland Polen. Zuerst hält sich der Kanzler ans vorgegebene Protokoll, ordnet die Schleife des niedergelegten Kranzes, verneigt sich und tritt dann zurück. Plötzlich jedoch fällt er auf die Knie, verharrt etwa eine halbe Minute demütig, steht dann ruckartig auf und wendet sich zum Gehen.
„So wird das alles nicht in den Geschichtsbücher stehen, in die es aber doch gehört: dieses wilde, füßescharrende Geschubse der Photographen plötzlich; die Sekunde der Atemlosigkeit; das Erschrecken. Wo ist er? Was ist denn passiert? Ist er gestürzt? Ohnmächtig geworden? Willy Brandt kniet.“ , schrieb der Reporter Hermann Schreiber, der den damaligen Bundeskanzler nach Warschau begleitete, einige Tage später im Spiegel.
Das Bild dieses Kniefalls ging um die Welt. Heute findet es sich in den meisten deutschen Schulbüchern und Lexika. Nahezu jeder von uns hat es schon einmal irgendwo gesehen. Doch die wenigsten wissen um die Geschichte und Hintergründe. Es scheint sich verselbständigt zu haben, dieses Bild von einer bewegenden Geste.
Eine Geste, die 30 Jahre später, am 6. Dezember 2000, durch eine Gedenktafel genau gegenüber des Warschauer Ghetto-Denkmals geehrt wird, eingeweiht durch den damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder und den polnischen Ministerpräsidenten Jerez Buzek.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Hintergründen, den Reaktionen und der heutigen Sicht des Kniefalls von Willy Brandt. Wie war sie gemeint? An wen gerichtet? War sie spontan oder doch geplant? Was trug zur Ikonisierung dieser Geste bei?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Der Kniefall - Die Hintergründe.
- 2. Deutungen und Reaktionen
- 2.1 Internationale Medien.....
- 2.2 Deutschland.....
- 2.3 Polen...\n
- 2.4 Die Juden in Westeuropa und Israel.
- 2.5 Willy Brandt......
- 3. Von der Geste zur Ikone…..\n
- 4. Fazit - Ein symbolischer Durchbruch?.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert den Kniefall von Willy Brandt im Dezember 1970 in Warschau und beleuchtet dessen Hintergründe, Deutungen und langfristige Bedeutung. Sie untersucht die Reaktion der internationalen Medien, der deutschen und polnischen Öffentlichkeit, sowie die Interpretation Brandts selbst. Des Weiteren wird der Prozess der Ikonisierung des Kniefalls betrachtet und seine Rolle als symbolischer Durchbruch für die deutsch-polnischen Beziehungen erörtert.
- Der Kniefall als Geste der Reue und Versöhnung
- Die Reaktion der Medien und Öffentlichkeit auf den Kniefall
- Die Hintergründe und die Bedeutung des Warschauer Vertrags
- Der Kniefall als symbolischer Durchbruch für die deutsch-polnischen Beziehungen
- Die Ikonisierung des Kniefalls und seine Bedeutung im historischen Gedächtnis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kniefall von Willy Brandt in Warschau vor und hebt seine Bedeutung als symbolisches Ereignis hervor. Kapitel 1 beleuchtet die Hintergründe des Kniefalls im Kontext der neuen Ostpolitik der sozialliberalen Koalition und des Warschauer Vertrags. Es geht dabei insbesondere um die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als Grenze zwischen Deutschland und Polen. Kapitel 2 befasst sich mit den Reaktionen auf den Kniefall in den Medien, der Politik und der Öffentlichkeit in Deutschland, Polen und international. Es werden verschiedene Deutungen und Interpretationen des Kniefalls erörtert, sowohl positive als auch negative. Kapitel 3 behandelt den Prozess der Ikonisierung des Kniefalls und untersucht, wie er im Laufe der Zeit zu einem Symbol für die deutsch-polnische Versöhnung geworden ist.
Schlüsselwörter
Willy Brandt, Kniefall, Warschau, Warschauer Vertrag, Ostpolitik, deutsch-polnische Beziehungen, Versöhnung, Reue, Symbol, Ikonisierung, Erinnerungskultur, Geschichtspolitik.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Anlass für Willy Brandts Kniefall in Warschau?
Der Kniefall erfolgte am 7. Dezember 1970 am Denkmal für die Helden des Warschauer Ghettos im Rahmen der Unterzeichnung des Warschauer Vertrages.
War der Kniefall eine geplante Geste?
Willy Brandt selbst bezeichnete die Geste als spontane Reaktion, die über das protokollarisch vorgesehene Maß hinausging, um Reue und Demut auszudrücken.
Wie reagierte die deutsche Öffentlichkeit auf den Kniefall?
Die Reaktionen waren gespalten: Während viele die Geste als mutiges Zeichen der Versöhnung sahen, kritisierten andere sie als übertriebene Demütigung Deutschlands.
Warum wurde diese Geste zu einer historischen Ikone?
Das Bild symbolisierte den moralischen Neuanfang der deutschen Ostpolitik und wurde zum weltweit bekannten Sinnbild für die deutsch-polnische Versöhnung.
Welche Rolle spielte der Warschauer Vertrag in diesem Kontext?
Der Vertrag beinhaltete die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als Westgrenze Polens und war ein zentraler Bestandteil der neuen Ostpolitik der sozialliberalen Koalition.
- Quote paper
- Christine Kruse (Author), 2006, Der Kniefall von 1970 - Ein symbolischer Durchbruch?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93163