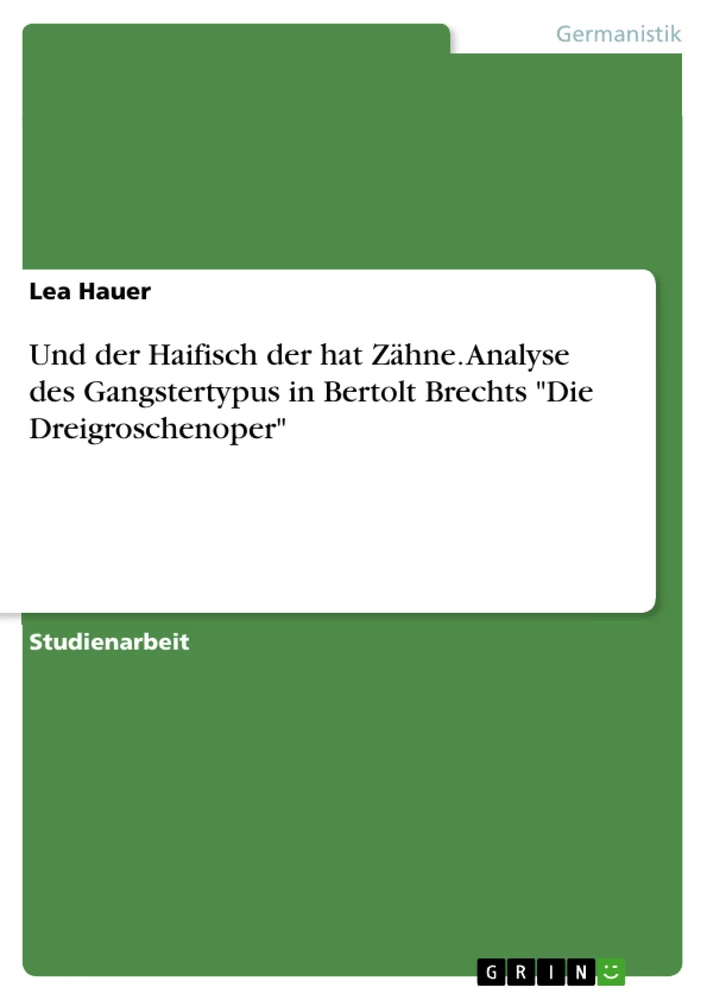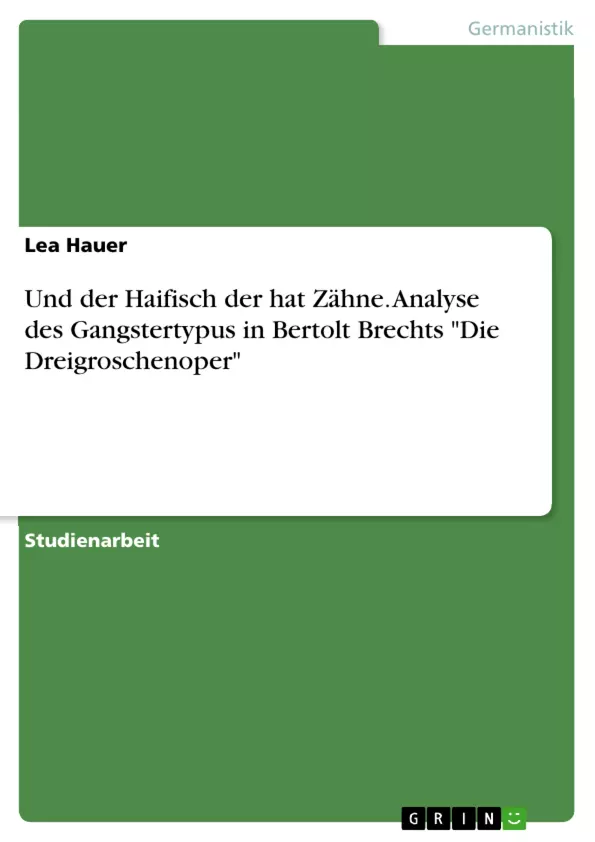Als Untersuchungsgegenstand dieser Seminararbeit dient Bertolt Brechts Protagonist der Dreigroschenoper "Mackie Messer", wobei die Autorin dieser Arbeit das von Brecht skizzierte Bild des Gangsters einer detaillierten Analyse durchziehen wird.
Am Beginn der Arbeit wird ein knapper Überblick der derzeitigen Forschungslage gegeben, welcher in die wesentlichen Studien zum Drama einführt. Danach wird anhand eines Einblicks in Bertolt Brechts Biografie dessen Inspirationen für das Gangsterdrama "Die Dreigroschenoper" aufgezeigt. Anschließend wird der Protagonist einer figuralen Analyse unterzogen.
Den Hauptteil der Arbeit bildet die Erstellung eines Täter- und Opferprofils und schließlich eine genauere Betrachtung der Antagonisten des Dramas unter dem Diskurs "Macht/Geld". Es folgt eine Untersuchung des "großen Kniffs", der unseren Gangster Mackie Messer seinen Zielen, der Integration in die bürgerliche Schicht und die Erlangung von Reichtum, näherbringen soll. Abschließend werden die Ergebnisse in einem Fazit gesammelt präsentiert und analysiert. Um einen Überfluss an Fußnoten im Fließtext zu vermeiden, wird bei der Besprechung des Dramas die entsprechenden Passagen aus dem Primärtext mit Seitenangaben in Klammern angegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Derzeitige Forschungslage
- Biografische Meilensteine
- Der Gangster Berthold Brecht
- Analyse der Opfer
- Machtlose Exekutive - Polizeichef Tiger Brown
- Bürgerliche Mädchen im Bann des Bad Boys
- Spelunken-Jenny – eine Prostituierte als Königin der Unterwelt
- Täterprofil von Mackie Messer
- Der Bürger als Opfer der Gesellschaft
- Protagonist oder Antagonist
- Ein letzter Job
- Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert den Gangstertypus in Berthold Brechts Dreigroschenoper, insbesondere die Figur des „Mackie Messer". Die Arbeit zielt darauf ab, das vom Autor skizzierte Bild des Gangsters zu untersuchen und seine Bedeutung im Kontext der Weimarer Republik zu beleuchten.
- Der Einfluss der Weimarer Republik auf Brechts Werk
- Die Darstellung des Gangsters in der Dreigroschenoper
- Die Rolle des Protagonisten „Mackie Messer“ im Stück
- Die Beziehung zwischen Macht, Geld und Kriminalität
- Die Rezeption der Dreigroschenoper in der Zeit der Uraufführung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Arbeit vor und gibt einen Überblick über die aktuelle Forschungslage und die Biografie des Autors. Anschließend werden die Opfer des Gangsters Mackie Messer, wie der Polizeichef Tiger Brown, bürgerliche Mädchen und Spelunken-Jenny, beleuchtet.
Im nächsten Kapitel wird ein Täterprofil von Mackie Messer erstellt. Hierbei wird untersucht, wie der Protagonist der Gesellschaft entspringt und seine Rolle als Protagonist oder Antagonist im Stück definiert wird.
Schlüsselwörter
Dreigroschenoper, Berthold Brecht, Gangstertypus, Weimarer Republik, Mackie Messer, Kriminalität, Macht, Geld, Opfer, Täterprofil, Gesellschaft, Protagonist, Antagonist, Rezeption
- Citation du texte
- Lea Hauer (Auteur), 2020, Und der Haifisch der hat Zähne. Analyse des Gangstertypus in Bertolt Brechts "Die Dreigroschenoper", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/934606