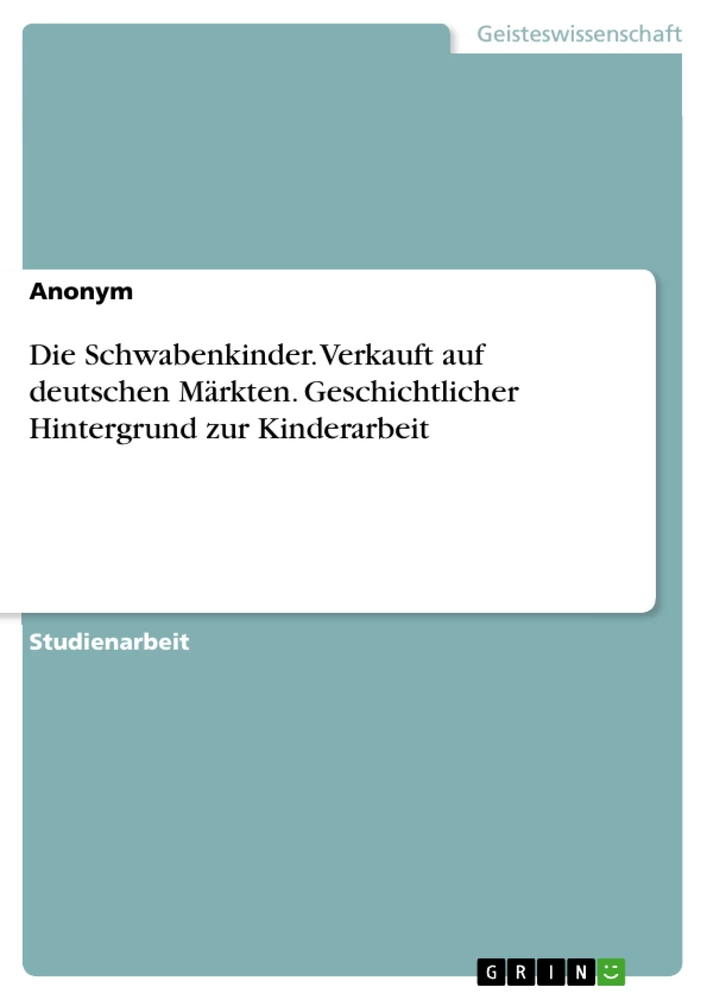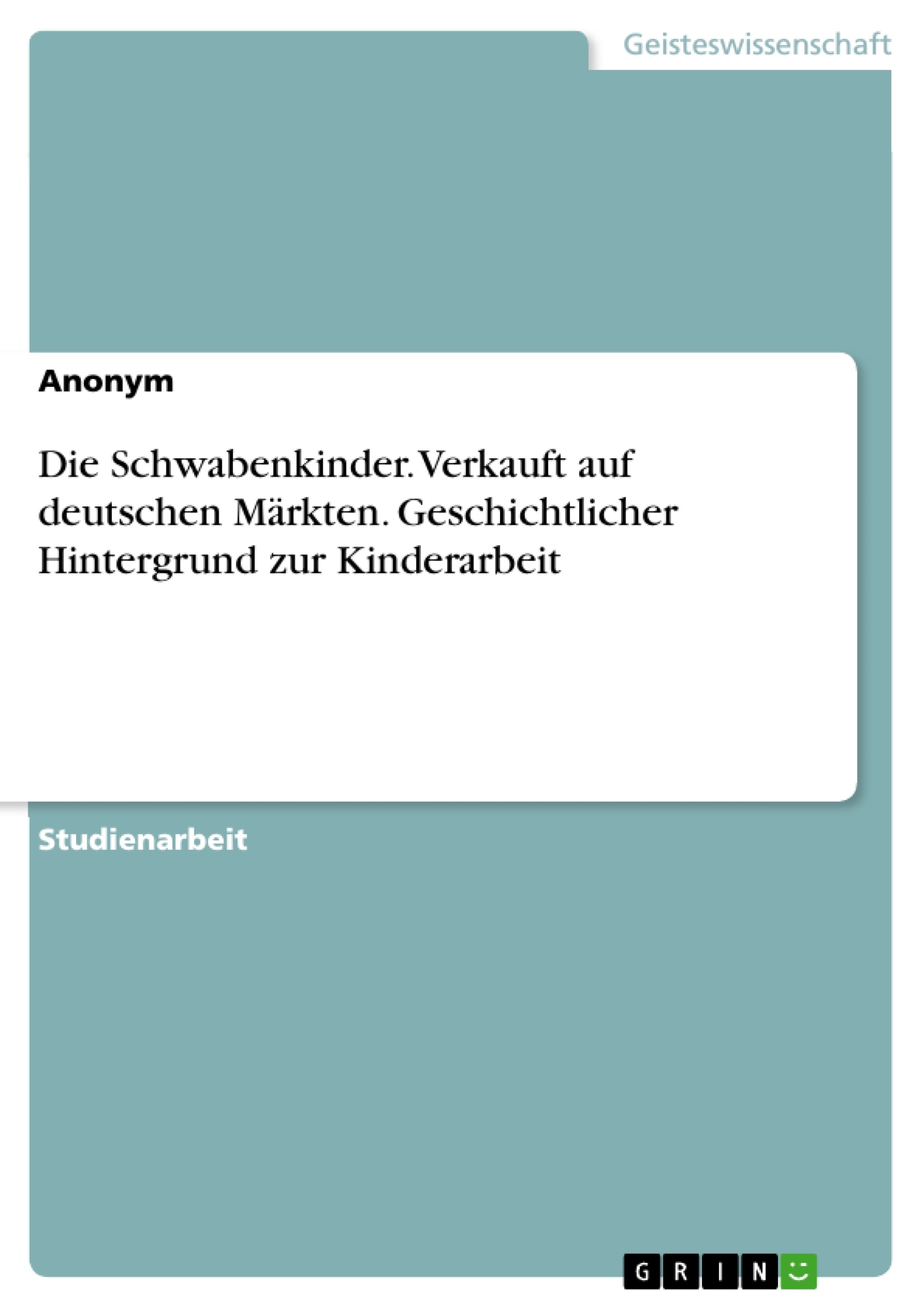Jahrhunderte lang, bis in die Neuzeit schickten Familien aus Tirol, Vorarlberg und der Schweiz ihre Kinder ins schwäbische oder ins bayerische Allgäu. Dort wurden die Kinder auf Wochenmärkten, neben Vieh und Gemüse oder auf gesonderten Kindermärkten an Großbauern verkauft, um auf deren Höfen als Saisonarbeiter tätig zu werden. Die Familien der sieben bis fünfzehnjährigen Kinder lebten in den unwegsamen Bergtälern Tirols und waren meist sehr verarmt, lebten an dem Existenzminimum. Sie verkauften ihre Kinder, um deren und die eigene Existenz zu sichern. In der Hoffnung, die Kinder im Herbst wohlbehalten und neueingekleidet wiederaufnehmen zu können, gab man sie fort, ohne einen anderen Ausweg zu sehen. So hatten sie weniger Kinder zu versorgen und die Gemeinden waren froh, nicht für sie aufkommen zu müssen. Die Kinder selbst wussten, dass sie während der Zeit im Ausland wenigstens ausreichend mit Nahrung verpflegt wurden..
Die Kinder, „Schwabenkinder“ oder „Schwabengänger“ genannt, waren bei Antritt der gefährlichen Reise über die zugeschneiten Alpen schlecht ausgestattet. Sie trugen aufgrund der Armut ihrer Familien miserables Schuhwerk und hatten unzureichende Kleidung bei sich. In den Dörfern in den Bergtälern wurden die Kinder Anfang der Sommersaison von Schwabenkinderführern, meist Pfarrern zusammengetrieben und in Gruppen, auf den langen Fußwegen über die Berge an die Ufer des Bodensees geleitet. Schon der Hinweg in das fremde Ausland bedeutete eine Lebensbedrohung für die Kinder. Diese Strecken wurden zurückgelegt, lange bevor man dort die Eisenbahnlinie baute.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Leben der Schwabenkinder
- Das Ende des Schwabenkinderwesens
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der „Schwabenkinder“, österreichischer Kinder, die bis ins 20. Jahrhundert in Schwaben und dem Allgäu als Saisonarbeiter verkauft wurden. Ziel ist es, Einblicke in das Leben dieser Kinder und die Hintergründe dieses gesellschaftlichen Phänomens zu geben, wobei der Schwerpunkt auf dem Ende dieser Praxis liegt. Aufgrund begrenzter Quellenlage stützt sich die Arbeit hauptsächlich auf den Roman „Die Schwabenkinder“ von Elmar Bereuter und das wissenschaftliche Werk „Die Schwabenkinder aus Tirol und Vorarlberg“ von Otto Uhlig.
- Sozioökonomische Bedingungen in den Herkunftsregionen der Kinder
- Der Ablauf des Kinderhandels und die Bedingungen auf den Märkten
- Die Lebensbedingungen der Schwabenkinder in Schwaben und dem Allgäu
- Der Einfluss von gesellschaftlichen Veränderungen auf das Ende des Schwabenkinderwesens
- Die Rolle von Vereinen und Initiativen zur Verbesserung der Situation der Kinder
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Schwabenkinder ein und beschreibt den historischen Kontext des Kinderhandels. Sie erläutert die begrenzte Quellenlage und die verwendete Literatur. Die Arbeit konzentriert sich auf die Ausarbeitung eines Referats zum Thema und behandelt insbesondere das Ende des Schwabenkinderwesens. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Lebensweise der Familien und der Gründe für den Verkauf der Kinder.
Das Leben der Schwabenkinder: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Lebensumstände der Schwabenkinder. Es schildert die Armut der Familien in den Bergregionen Tirols und Vorarlbergs, die sie zum Verkauf ihrer Kinder zwang. Die Kinder, oft im Alter von sieben bis fünfzehn Jahren, wurden auf Märkten in Schwaben und dem Allgäu an Bauern verkauft, um dort als Saisonarbeiter zu arbeiten. Der gefährliche Weg über die Alpen, die schlechten Arbeitsbedingungen und die oft unzureichende Versorgung der Kinder werden anschaulich dargestellt. Die Kapitel beschreibt auch die Märkte in Städten wie Ravensburg und Friedrichshafen, an denen die Kinder verkauft wurden, sowie die Anzahl der Kinder, die jährlich gehandelt wurden. Die Kapitel beleuchtet das Fehlen einer Schulpflicht und den damit verbundenen Arbeitsdruck auf die Kinder. Die unterschiedlichen Schicksale der Kinder, von der erfolgreichen Integration bis hin zu Misshandlung und Ausbeutung, werden ebenfalls erwähnt.
Das Ende des Schwabenkinderwesens: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Faktoren, die zum Ende des Schwabenkinderwesens beitrugen. Es werden die gesellschaftlichen Veränderungen und die Entwicklungen, wie die Vergrößerung der Höfe und der steigende Bedarf an Arbeitskräften im 18. Jahrhundert, diskutiert. Die Einführung der Schulpflicht in Württemberg 1836 und die daraus resultierende Notwendigkeit, die fehlenden Arbeitskräfte durch die Schwabenkinder zu ersetzen, wird ebenfalls beleuchtet. Das Kapitel beschreibt die Gründung des „Vereins zum Wohle der ausgewanderten Schwabenkinder“ im Jahr 1890 und dessen Bemühungen, die Situation der Kinder zu verbessern. Der Bau der Eisenbahnstrecke 1884 und die verbesserte Infrastruktur werden als entscheidende Faktoren für das allmähliche Verschwinden des Phänomens genannt, da der Transport der Kinder einfacher und sicherer wurde. Die Rolle der Zeitungen bei der Vermittlung von Arbeitskräften und die Berichterstattung über die Märkte werden als zusätzliche Quellen und Beweise herangezogen. Der zunehmende Wettbewerb um die Kinder und die oft unmenschlichen Szenen auf den Märkten werden anhand von Zeitungszitaten verdeutlicht.
Schlüsselwörter
Schwabenkinder, Kinderarbeit, Saisonarbeit, Tirol, Vorarlberg, Allgäu, Armut, Kinderhandel, Märkte, Arbeitsbedingungen, Schulpflicht, Verein zum Wohle der ausgewanderten Schwabenkinder, Eisenbahn, Bodensee, soziale Ungleichheit, historische Sozialforschung.
Häufig gestellte Fragen: Die Schwabenkinder
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das historische Phänomen der „Schwabenkinder“, österreichischer Kinder, die bis ins 20. Jahrhundert in Schwaben und dem Allgäu als Saisonarbeiter verkauft wurden. Der Fokus liegt besonders auf dem Ende dieser Praxis.
Welche Quellen wurden verwendet?
Aufgrund begrenzter Quellenlage stützt sich die Arbeit hauptsächlich auf den Roman „Die Schwabenkinder“ von Elmar Bereuter und das wissenschaftliche Werk „Die Schwabenkinder aus Tirol und Vorarlberg“ von Otto Uhlig.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet sozioökonomische Bedingungen in den Herkunftsregionen der Kinder, den Ablauf des Kinderhandels und die Marktbedingungen, die Lebensbedingungen der Kinder in Schwaben und dem Allgäu, den Einfluss gesellschaftlicher Veränderungen auf das Ende des Schwabenkinderwesens und die Rolle von Vereinen und Initiativen zur Verbesserung der Situation der Kinder.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, Kapitel über das Leben der Schwabenkinder und das Ende des Schwabenkinderwesens, sowie ein Resümee. Jedes Kapitel fasst die wichtigsten Aspekte des Themas zusammen.
Was wird im Kapitel „Das Leben der Schwabenkinder“ beschrieben?
Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Lebensumstände der Schwabenkinder: Armut der Familien, der Verkauf der Kinder auf Märkten, die gefährliche Reise über die Alpen, schlechte Arbeitsbedingungen, unzureichende Versorgung, die Märkte in Ravensburg und Friedrichshafen, die Anzahl der gehandelten Kinder, das Fehlen der Schulpflicht und die unterschiedlichen Schicksale der Kinder (von erfolgreicher Integration bis hin zu Misshandlung und Ausbeutung).
Was sind die zentralen Punkte im Kapitel „Das Ende des Schwabenkinderwesens“?
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Faktoren, die zum Ende des Schwabenkinderwesens beitrugen: gesellschaftliche Veränderungen, die Vergrößerung der Höfe, steigender Bedarf an Arbeitskräften, die Einführung der Schulpflicht in Württemberg 1836, die Gründung des „Vereins zum Wohle der ausgewanderten Schwabenkinder“, der Bau der Eisenbahnstrecke 1884, die Rolle der Zeitungen und der zunehmende Wettbewerb um die Kinder.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Schwabenkinder, Kinderarbeit, Saisonarbeit, Tirol, Vorarlberg, Allgäu, Armut, Kinderhandel, Märkte, Arbeitsbedingungen, Schulpflicht, Verein zum Wohle der ausgewanderten Schwabenkinder, Eisenbahn, Bodensee, soziale Ungleichheit, historische Sozialforschung.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel ist es, Einblicke in das Leben der Schwabenkinder und die Hintergründe dieses gesellschaftlichen Phänomens zu geben, wobei der Schwerpunkt auf dem Ende dieser Praxis liegt.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2004, Die Schwabenkinder. Verkauft auf deutschen Märkten. Geschichtlicher Hintergrund zur Kinderarbeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93628