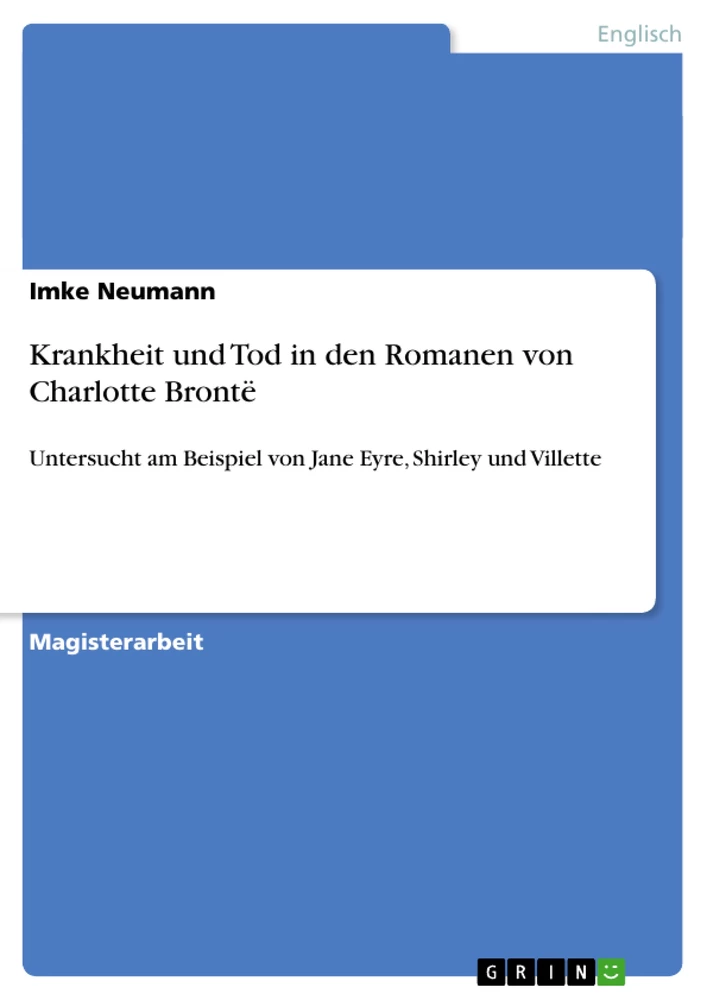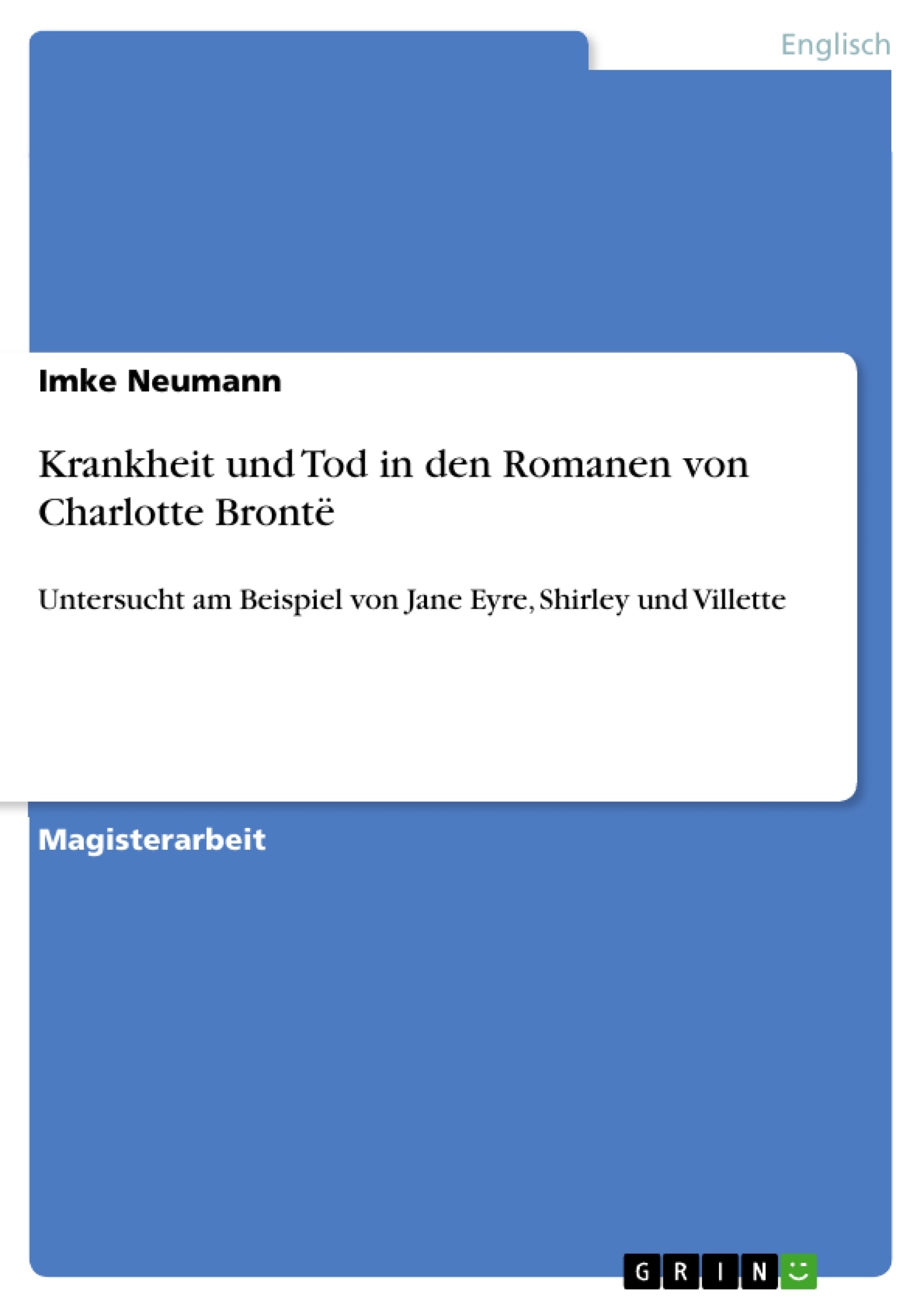Krankheit und Tod haben schon immer eine zentrale Rolle im Denken der Menschen gespielt. In manchen Epochen gewinnen sie jedoch besonders an Bedeutung, so zum Beispiel im Viktorianischen Zeitalter, für das man von einem regelrechten „cult of death“ (Wheeler 1994: 28) sprechen kann. Die Literatur der Zeit ist als Spiegel der Gesellschaft durchsetzt von diesen Motiven, und die Romane Charlotte Brontës stellen keine Ausnahme dar. Tatsächlich kann gerade für ihre Romane von einer „obsessiven Verwendung von Tod und Todessymbolik“ (Rublack 1985: 32) gesprochen werden. Ihre Romane Jane Eyre, Shirley und Villette, die hier im Zentrum der Untersuchung stehen sollen, illustrieren beispielhaft die Durchdringung der Literatur mit einer ausgeprägten Krankheits- und Todesthematik.
Diese Magisterarbeit setzt es sich daher zum Ziel, die große Bedeutung dieser Themen anhand verschiedener Beispiele aufzuzeigen. Dabei soll herausgearbeitet werden, welche Funktionen die Themen Krankheit und Tod im Kontext der Romane haben. Die Figurenanalyse stellt eines der Hauptwerkzeuge der Interpretation dar, da es in der Natur der Sache liegt, dass hauptsächlich Menschen – hier die Figuren der Romanwelt – von Krankheiten und Tod betroffen sind. Dennoch sollen weitere Bereiche, in denen sich diese Aspekte ebenfalls niederschlagen, untersucht werden. Dazu gehört zum einen die Sprachmetaphorik der Romane, zum anderen die Raumgestaltung.
Der Theorieteil dieser Arbeit soll den für die Interpretation nötigen historischen und kulturellen Hintergrund liefern und aufzeigen, welche Rolle Krankheit – dazu zählen sowohl körperliche als auch geistige Erkrankungen – und Tod in der Kultur des Viktorianischen Zeitalters spielten. Zu den körperlichen Krankheiten, die von besonderer Bedeutung für die spätere Analyse sein werden, zählen Tuberkulose – die bedeutendste Krankheit des 19. Jahrhunderts – und Fieberkrankheiten; zu den psychischen Erkrankungen „moral insanity“ und Hysterie. Da diese eine Vorrangstellung innerhalb der Romane einnehmen, wird ihnen dementsprechend viel Raum zukommen. Um die Relevanz und die Hintergründe der psychischen Leiden zu erschließen wird ausführlich auf das in diesem Zusammenhang besonders bedeutsame Thema der weiblichen Sexualität im Viktorianischen Zeitalter eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Krankheit und Tod im Viktorianischen Zeitalter
- 2.1 Der kranke Geist: Wahnsinn im Viktorianischen Zeitalter
- 2.1.1 „Krankheit Frau“: Sexualität und Wahnsinn
- 2.1.2 Formen geistiger Erkrankungen
- 2.1.2.1 Der verlorene Anstand: „moral insanity“
- 2.1.2.2 Der nervöse Körper: Hysterie
- 2.2 Körperliche Krankheiten
- 2.2.1 Tuberkulose
- 2.2.2 Fieberkrankheiten
- 2.3 Das „richtige“ und das „falsche“ Sterben: Tod im Viktorianischen Zeitalter
- 2.3.1 Der „gute Tod“
- 2.3.2 Der „schlechte Tod“
- 2.3.3 Der Tod von Kindern
- 2.4 Die viktorianischen Ärzte
- 2.1 Der kranke Geist: Wahnsinn im Viktorianischen Zeitalter
- 3 Romananalyse: Jane Eyre
- 3.1 Tod und Religion
- 3.1.1 Die Befreiung des Geistes: Helen Burns
- 3.1.2 Der glorreiche Tod: St. John Rivers
- 3.2 Die Herrschaft des Geistes über den Körper: Bertha Mason
- 3.3 Die poetische Gerechtigkeit
- 3.3.1 Krankheit und Tod als Strafe: Mrs. Reed
- 3.3.2 Aus dem Leiden lernen: Mr. Rochester
- 3.4 Der unbeugsame Lebenswille: Jane Eyre
- 3.5 Orte und Krankheit
- 3.5.1 Ein Ort der Krankheit: Lowood School
- 3.5.2 Ein ungesunder Ort der Fruchtbarkeit: Ferndean
- 3.1 Tod und Religion
- 4 Romananalyse: Shirley
- 4.1 Weiblich und krank: drei Schicksale
- 4.1.1 Leiden und Leidenschaft: Caroline Helstone
- 4.1.2 Die erweckte Weiblichkeit: Shirley Keeldar
- 4.1.3 Der „weibliche“ Tod: Mary Cave
- 4.2 Männlich und krank: zwei Schicksale
- 4.2.1 Täter oder Opfer? Robert Moore
- 4.2.2 Die männliche Leidenschaft: Louis Moore
- 4.3 Die Yorkes: ein Spiegel der viktorianischen Familie?
- 4.3.1 Hysterie und Häuslichkeit: Mrs. Yorke
- 4.4 Sprache und Tod
- 4.1 Weiblich und krank: drei Schicksale
- 5 Romananalyse: Villette
- 5.1 Gelähmte Gefühle – gelähmte Körper: die weiblichen Figuren
- 5.1.1 Der Kampf mit den Gefühlen: Lucy Snowe
- 5.1.2 Liebe und Tod: Miss Marchmont
- 5.2 Hilfe oder Kontrolle: die männlichen Figuren
- 5.2.1 Der Arzt: Dr. John Graham Bretton
- 5.2.2 Der Lehrer: Monsieur Paul Emanuel
- 5.3 Ein Ort der Gesundheit? Madame Becks Pensionat
- 5.1 Gelähmte Gefühle – gelähmte Körper: die weiblichen Figuren
- 6 Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die bedeutende Rolle von Krankheit und Tod in den Romanen Charlotte Brontës, insbesondere in Jane Eyre, Shirley und Villette. Ziel ist es, die Funktionen dieser Themen im Kontext der Romane aufzuzeigen und deren Bedeutung im viktorianischen Zeitalter zu beleuchten.
- Die Darstellung von Krankheit und Tod als Spiegel der viktorianischen Gesellschaft.
- Die unterschiedlichen Funktionen von Krankheit und Tod in den einzelnen Romanen.
- Die Rolle der Geschlechter (Gender) im Umgang mit Krankheit und Tod.
- Die sprachliche und räumliche Gestaltung der Krankheit- und Todesthemen.
- Der Vergleich der Darstellung von Krankheit und Tod in den drei Romanen und die Entwicklung der Autorin im Umgang damit.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Magisterarbeit ein und beschreibt die zentrale Rolle von Krankheit und Tod in den Romanen Charlotte Brontës, insbesondere im Kontext des viktorianischen Zeitalters. Sie benennt die drei Romane – Jane Eyre, Shirley und Villette – als Untersuchungsgegenstand und skizziert die Zielsetzung der Arbeit, nämlich die Funktionen der Themen Krankheit und Tod in diesen Romanen herauszuarbeiten. Die methodische Vorgehensweise, die Figurenanalyse, die Sprachmetaphorik und die Raumgestaltung, wird ebenfalls kurz erläutert.
2 Krankheit und Tod im Viktorianischen Zeitalter: Dieses Kapitel liefert den historischen und kulturellen Kontext für die spätere Romananalyse. Es beschreibt die Bedeutung von Krankheit und Tod im viktorianischen Zeitalter, indem es sowohl körperliche als auch geistige Erkrankungen beleuchtet. Im Fokus stehen Tuberkulose und Fieberkrankheiten als körperliche Leiden sowie „moral insanity“ und Hysterie als psychische Erkrankungen. Besondere Aufmerksamkeit wird dem Einfluss der weiblichen Sexualität auf das Verständnis von psychischen Krankheiten gewidmet. Die Unterscheidung zwischen „gutem“ und „schlechtem“ Tod und die Sonderstellung des Kindstodes werden ebenfalls behandelt. Die Rolle des viktorianischen Arztes als Bindeglied zwischen Mensch und Krankheit wird ebenfalls betrachtet.
3 Romananalyse: Jane Eyre: Diese Romananalyse untersucht die Themen Krankheit und Tod in Jane Eyre. Sie analysiert die verschiedenen Todesfälle im Roman unter Aspekten der Spiritualität, der poetischen Gerechtigkeit und der Darstellung von Weiblichkeit und Wahnsinn. Der Fokus liegt dabei auf der besonderen Bedeutung dieser Themen für die Protagonistin Jane Eyre, die im Gegensatz zu vielen anderen Figuren nicht ernsthaft erkrankt. Der unbeugsame Lebenswille Janes wird als Gegenpol zu den anderen Schicksalen interpretiert. Die Bedeutung von Ort und Raum (Lowood School und Ferndean) im Kontext von Krankheit wird ebenfalls untersucht.
4 Romananalyse: Shirley: Die Analyse von Shirley konzentriert sich auf die unterschiedliche Darstellung von Krankheit und Tod bei weiblichen und männlichen Figuren. Die Schicksale von Caroline Helstone, Shirley Keeldar und Mary Cave werden als Beispiele für den weiblichen Umgang mit Krankheit und Tod interpretiert. Ähnlich werden die männlichen Figuren Robert und Louis Moore analysiert. Die Rolle der Familie Yorke und speziell von Mrs. Yorke als Spiegelbild der viktorianischen Familie wird ebenfalls untersucht. Der Einfluss von Sprache und Tod als wichtige Aspekte des Romans wird ebenfalls behandelt.
5 Romananalyse: Villette: In der Analyse von Villette wird der Fokus auf die gelähmten Gefühle und Körper der weiblichen Figuren, insbesondere Lucy Snowe, gelegt. Der Einfluss der männlichen Figuren, Dr. John Graham Bretton und Monsieur Paul Emanuel, auf Lucy wird untersucht. Die Rolle von Madame Becks Pensionat als Ort, der Gesundheit oder Krankheit repräsentieren könnte, wird ebenfalls erörtert.
Schlüsselwörter
Charlotte Brontë, Viktorianisches Zeitalter, Krankheit, Tod, Jane Eyre, Shirley, Villette, Romananalyse, „moral insanity“, Hysterie, Tuberkulose, poetische Gerechtigkeit, Weiblichkeit, Männlichkeit, Gender, Sprachmetaphorik, Raumgestaltung, Religion, Sterben, Todessymbolik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Krankheit und Tod in den Romanen Charlotte Brontës
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Magisterarbeit untersucht die Rolle von Krankheit und Tod in den Romanen Jane Eyre, Shirley und Villette von Charlotte Brontë im Kontext des viktorianischen Zeitalters. Der Fokus liegt auf der Funktion dieser Themen in den Romanen und ihrer Bedeutung für die viktorianische Gesellschaft.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Darstellung von Krankheit und Tod als Spiegelbild der viktorianischen Gesellschaft, die unterschiedlichen Funktionen von Krankheit und Tod in den einzelnen Romanen, die Rolle der Geschlechter (Gender) im Umgang mit Krankheit und Tod, die sprachliche und räumliche Gestaltung der Krankheit- und Todesthemen und einen Vergleich der Darstellung in den drei Romanen, um die Entwicklung der Autorin im Umgang mit diesen Themen aufzuzeigen.
Welche Romane werden analysiert?
Die Arbeit analysiert drei Romane von Charlotte Brontë: Jane Eyre, Shirley und Villette. Jede Romananalyse untersucht die spezifische Darstellung von Krankheit und Tod in dem jeweiligen Werk.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Kapitel zum historischen Kontext von Krankheit und Tod im viktorianischen Zeitalter, drei Kapiteln mit Romananalysen (Jane Eyre, Shirley, Villette) und einer Schlussbetrachtung. Die methodische Vorgehensweise beinhaltet Figurenanalyse, Sprachmetaphorik und Raumgestaltung.
Welche Arten von Krankheiten werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet sowohl körperliche Krankheiten wie Tuberkulose und Fieberkrankheiten als auch psychische Erkrankungen wie „moral insanity“ und Hysterie. Besonderes Augenmerk wird auf den Zusammenhang zwischen weiblicher Sexualität und Wahnsinn gelegt.
Wie wird der Tod dargestellt?
Die Arbeit unterscheidet zwischen dem „guten“ und „schlechten“ Tod im viktorianischen Kontext und behandelt auch den Tod von Kindern als besonderes Thema. Die Analyse der Romane untersucht, wie der Tod als literarisches Mittel eingesetzt wird (z.B. poetische Gerechtigkeit).
Welche Rolle spielen die Geschlechter?
Die Arbeit analysiert die unterschiedlichen Darstellungen von Krankheit und Tod bei weiblichen und männlichen Figuren in den Romanen. Die Geschlechterrollen und der Umgang mit Krankheit und Tod im viktorianischen Zeitalter werden kritisch beleuchtet.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse der Romananalysen zusammen und diskutiert die Bedeutung der Erkenntnisse für das Verständnis von Charlotte Brontës Werk und der viktorianischen Gesellschaft. Die Entwicklung der Autorin im Umgang mit den Themen Krankheit und Tod wird ebenfalls hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Charlotte Brontë, Viktorianisches Zeitalter, Krankheit, Tod, Jane Eyre, Shirley, Villette, Romananalyse, „moral insanity“, Hysterie, Tuberkulose, poetische Gerechtigkeit, Weiblichkeit, Männlichkeit, Gender, Sprachmetaphorik, Raumgestaltung, Religion, Sterben, Todessymbolik.
- Arbeit zitieren
- Dr. des. Imke Neumann (Autor:in), 2003, Krankheit und Tod in den Romanen von Charlotte Brontë , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93754