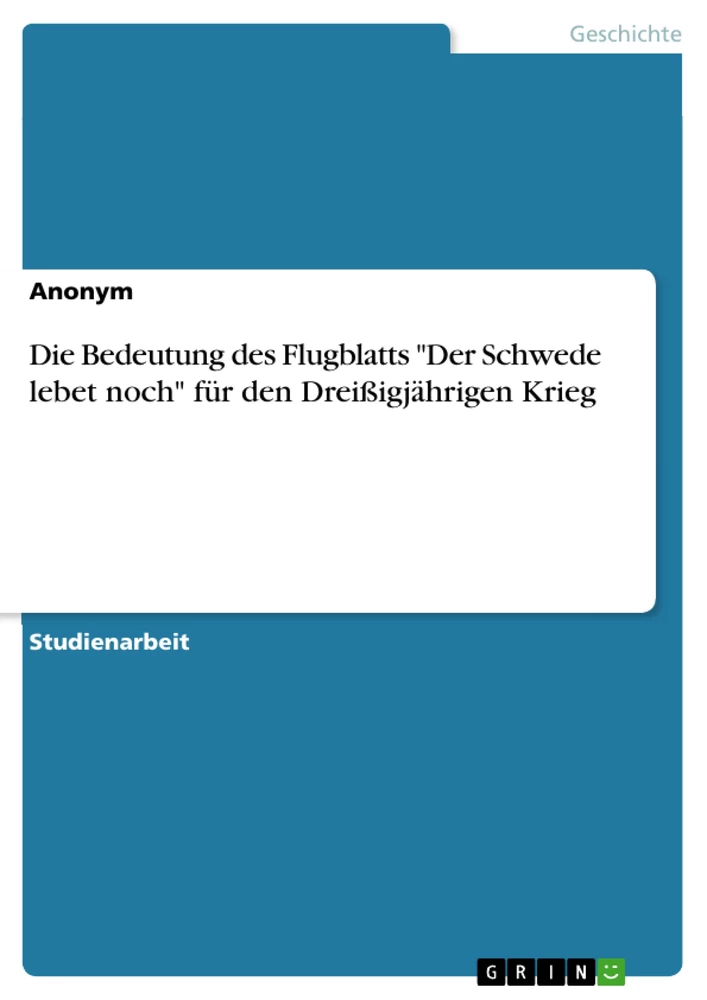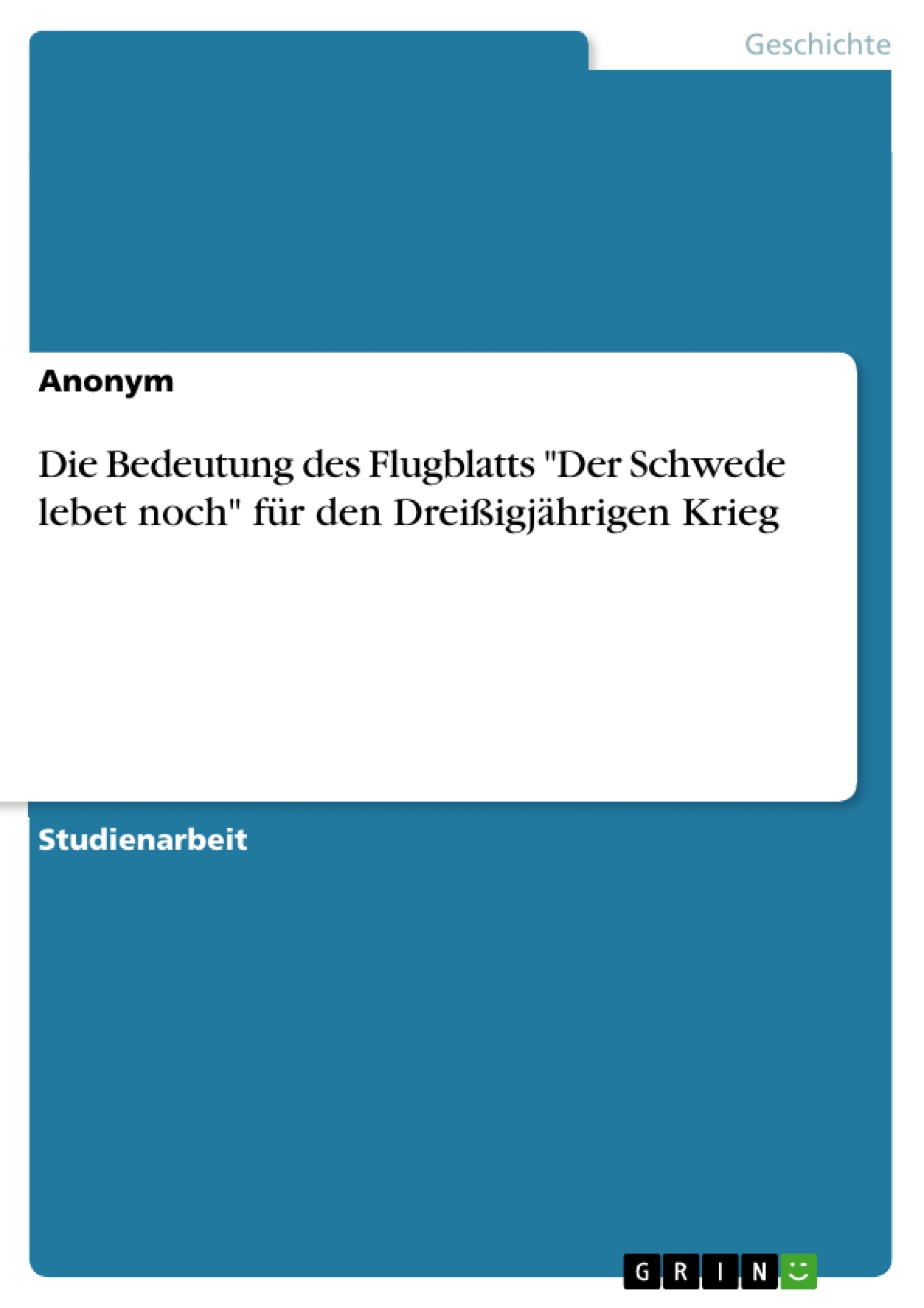Teil dieser Arbeit soll sein, das Flugblatt quellenkritisch zu untersuchen, das heißt es zu beschreiben und daraufhin zu analysieren und zu interpretieren. Wichtig ist, es in einen größeren Rahmen einzuordnen, es also nach seiner Bedeutung für Gustav Adolf und den Dreißigjährigen Krieg zu hinterfragen. Ganz konkret ausgedrückt, soll der Frage nachgegangen werden, was mit dem Flugblatt ausgedrückt werden sollte und welche Bedeutung es für den weiteren Verlauf des Dreißigjährigen Krieg hatte. In diesem Zusammenhang ist auch die Frage, aus welchen Gründen Gustav Adolf überhaupt in den Dreißigjährigen Krieg eintrat, von Bedeutung, wie sich im Laufe der Arbeit zeigen wird.
Was für uns heute Tageszeitungen wie Die Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt oder auch einfach die Bild-Zeitung sind, war im 17. Jahrhundert das Flugblatt. Auf diese Weise wurde zu jener Zeit Neues und Aktuelles präsentiert. Dazu gehörte neben Politik und Religion auch Veröffentlichung naturkundlicher Entdeckungen sowie Kuriositäten aller Art. Durch ihre illustrierte Form waren sie nicht nur dem gebildeten Volk zugänglich, sondern auch der leseunfähige Betrachter konnte die Botschaft verstehen. Dabei ist auch wichtig zu beachten, dass durch das beschränkte Raumangebot von einer Seite kein Platz für eine ausschweifende Argumentation war. Der Kern der Sache musste deutlich auf den Punkt gebracht werden.1
Auch Gustav II. Adolf von Schweden stand lange Zeit im Fokus von Flugblättern und Flugschriften. Besonders die Nachricht vom Tod des „Löwen aus Mitternacht“ in der Schlacht bei Lützen vom 6. Novemberjul. bzw. 16. Novembergreg. 1632 löste eine Flut von Druckerzeugnissen aus. Sowohl in Zeitungen als auch in Flugblättern und Flugschriften wurde sein Tod zum Thema gemacht. Das hier vorliegende Flugblatt „Der Schwede lebet noch“ aus dem Jahr 1633 ist eines von diesen. Doch wenn das Flugblatt vom Tod des Königs handelt, wieso trägt es dann einen solchen Titel? Versucht das Flugblatt gar den Tod des Königs zu leugnen? Oder basiert es einfach auf falschen Informationen? Solche Fragen dürften auch den Betrachtern des Flugblattes als erstes in den Sinn gekommen sein. Nach näherer Betrachtung sollten sich ihre Bedenken und Zweifel allerdings schnell aufgelöst haben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsstand
- Historischer Kontext
- Beschreibung des Flugblatts
- Illustration
- Text
- Analyse und Interpretation
- Illustration
- Text
- Das Flugblatt insgesamt
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Flugblatt „Der Schwede lebet noch“ aus dem Jahr 1633 und analysiert dessen Bedeutung im Kontext des Dreißigjährigen Krieges und der Gestalt des schwedischen Königs Gustav II. Adolf. Ziel ist es, die Botschaft des Flugblattes zu entschlüsseln und seine Rolle im Verlauf des Krieges zu beleuchten.
- Das Flugblatt als Medium der politischen und gesellschaftlichen Kommunikation im 17. Jahrhundert
- Die Rolle und Bedeutung von Gustav Adolf im Dreißigjährigen Krieg
- Die Deutung des Todes des schwedischen Königs in zeitgenössischen Druckerzeugnissen
- Die Analyse der Illustration und des Textes des Flugblattes "Der Schwede lebet noch"
- Die Bedeutung des Flugblattes für den weiteren Verlauf des Dreißigjährigen Krieges
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Flugblatt "Der Schwede lebet noch" in den Kontext der Flugblatt-Kultur des 17. Jahrhunderts und skizziert die Forschungsfrage, die im weiteren Verlauf der Arbeit behandelt wird.
Das Kapitel "Forschungsstand" beleuchtet die verschiedenen Deutungen der Person Gustav Adolfs in der historischen Forschung. Es werden die unterschiedlichen Perspektiven auf seine Rolle im Dreißigjährigen Krieg und die Entwicklung der Mythosbildung um seine Person betrachtet.
Im Kapitel "Historischer Kontext" wird der Dreißigjährige Krieg und dessen Entstehung beschrieben. Dabei wird die Rolle der Konflikte zwischen den Konfessionen, der europäischen Krisenherde und der politischen Situation im Heiligen Römischen Reich beleuchtet.
Das Kapitel "Beschreibung des Flugblattes" beschäftigt sich mit der Illustration und dem Text des Flugblattes "Der Schwede lebet noch". Die einzelnen Elemente werden beschrieben und auf ihren Inhalt und ihre Funktion hingewiesen.
Das Kapitel "Analyse und Interpretation" widmet sich der Deutung des Flugblattes. Es werden die Illustration und der Text in ihren historischen Kontext eingebettet und analysiert.
Das Kapitel "Fazit" fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und zieht Schlussfolgerungen über die Bedeutung des Flugblattes "Der Schwede lebet noch" für den Dreißigjährigen Krieg und das Bild von Gustav Adolf.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind: Flugblatt, Dreißigjähriger Krieg, Gustav II. Adolf, Schweden, Propaganda, Mythos, Illustration, Textanalyse, Interpretation, Historischer Kontext, Forschungsstand, Quellenkritik.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Bedeutung von Flugblättern im 17. Jahrhundert?
Flugblätter waren die Massenmedien ihrer Zeit. Sie verbreiteten Nachrichten über Politik, Krieg und Religion und erreichten durch Illustrationen auch die leseunfähige Bevölkerung.
Warum trägt das Flugblatt den Titel „Der Schwede lebet noch“?
Trotz des Todes von König Gustav II. Adolf im Jahr 1632 sollte der Titel symbolisieren, dass seine Sache, sein Geist und sein Heer weiterhin im Dreißigjährigen Krieg präsent waren.
Wer war Gustav II. Adolf von Schweden?
Er war der schwedische König, der als „Löwe aus Mitternacht“ bekannt wurde und als Retter des Protestantismus in den Dreißigjährigen Krieg eintrat.
Wie wurde der Tod des Königs medial verarbeitet?
Sein Tod löste eine Flut von Druckerzeugnissen aus, die ihn entweder als Märtyrer verklärten oder (auf katholischer Seite) seinen Untergang feierten.
Was ist Quellenkritik bei einem historischen Flugblatt?
Quellenkritik umfasst die Beschreibung, Analyse der Intention des Autors und die Einordnung des Dokuments in den größeren historischen Kontext des Krieges.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2020, Die Bedeutung des Flugblatts "Der Schwede lebet noch" für den Dreißigjährigen Krieg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/937942