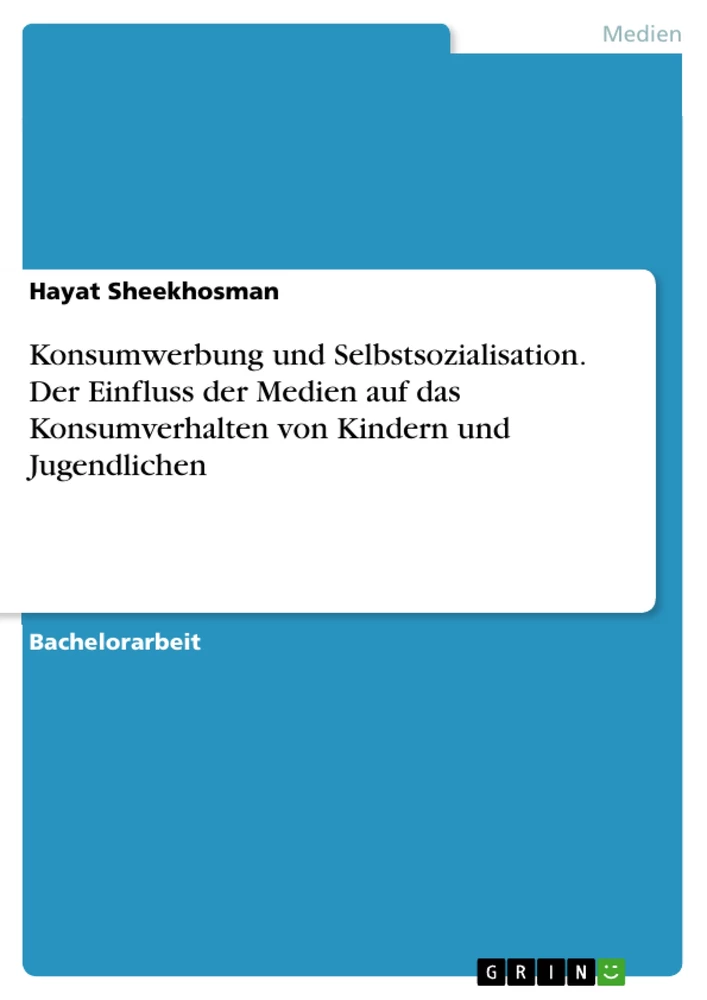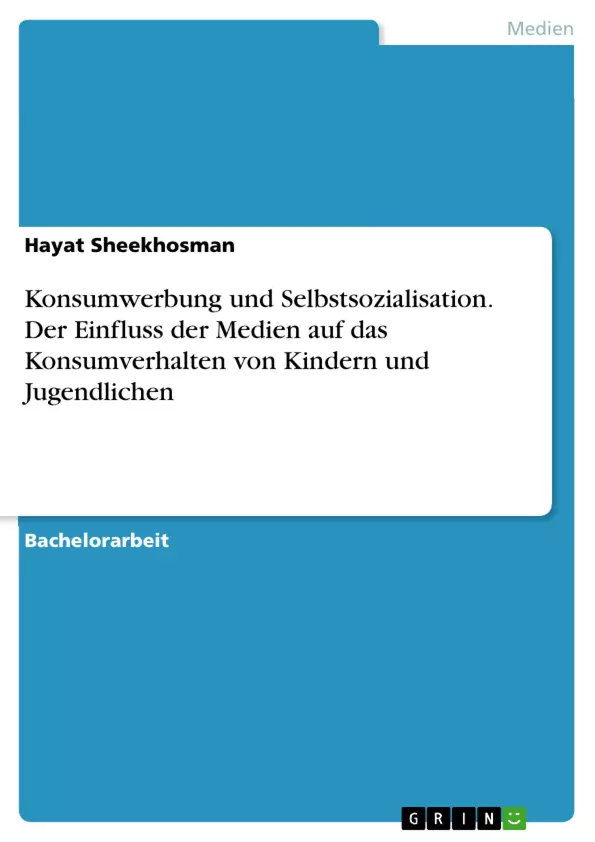Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Einfluss der Medien auf die soziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Anhand relevanter Literatur wird die Auswirkung der intensiven Mediennutzung auf die Selbstsozialisation von Kindern und Jugendlichen untersucht und in Kontext des Konsumverhaltens gesetzt. Die aus der Untersuchung gewonnenen Erkenntnisse könnten sowohl Kindertagestätten als auch Schulen dabei helfen, betroffene Familien im Umgang mit Medien zu schulen und sie über die Auswirkungen auf das Konsumverhalten zu informieren, sodass Kinder und Jugendliche die eigene Mediennutzung bewusster reflektieren, hinterfragen und diskutieren können.
Um ein grundlegendes Verständnis bezüglich des Einflusses der Medien auf die soziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu schaffen, werden im zweiten Kapitel zunächst die theoretischen Grundlagen der Arbeit dargestellt. Dabei werden die Begriffe Konsumwerbung, Selbstsozialisation und Medien definiert. Im dritten Kapitel werden die Forschungsergebnisse des Medienpädagogischen Forschungsbundes Südwest der KIM- und JIMStudien vorgestellt. Hierbei soll dargestellt werden, wie stark der Alltag von Kindern und Jugendlichen von Medien bestimmt wird und welche Veränderungen im Vergleich zu den Vorgängerstudien im Jahre 2006 zu beobachten sind. Der Fokus wird dabei auf die Medien Fernsehen, Internet und Smartphone gelegt. Das vierte Kapitel widmet sich dem Einfluss der Digitalisierung auf die soziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Es wird aufgezeigt, dass die zunehmende Digitalisierung und der wachsende Medienkonsum tiefgreifend in die Gesellschaft einwirken und Einfluss auf die soziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen nehmen.
Im fünften Kapitel wird die Werbung als geeignetes Instrument zur Konditionierung der Kinder und Jugendlichen zum Konsum vorgestellt. Hierfür werden zunächst entwicklungspsychologische Aspekte der Werbewirkung erläutert. Darauf aufbauend wird der Frage nachgegangen, warum Kinder und Jugendliche gerade für Unternehmer ein hohes Attraktivitätspotenzial darstellen und wie sich das Markenbewusstsein bereits im Kindesalter etabliert. Abschließend werden im sechsten Kapitel die zentralen Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und ein Ausblick auf künftige Herausforderungen auf Seiten der Bildungsinstitutionen hinsichtlich Werbe- und Medienkompetenz gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemdarstellung und Zielsetzung
- Aufbau der Arbeit
- Definitionen zentraler Begriffe
- Konsumwerbung
- Medien
- Selbstsozialisation
- Medienrezeption von Kindern und Jugendlichen anhand der KIM-, und JIM-Studie
- Medienausstattung und Mediennutzung
- Fernsehen
- Internet/Smartphone
- Einfluss der Digitalisierung auf die soziale Entwicklung
- Mögliche Auswirkungen des Medienkonsums auf die Identitätsbildung
- Risiken der Selbstsozialisation von Kindern und Jugendlichen durch digitale Medien
- Einfluss der Werbung auf das Konsumverhalten
- Entwicklungspsychologische Aspekte der Werbewirkung
- Werbung im Internet
- Kinder und Jugendliche als Zielgruppe
- Markenbewusstsein von Kindern und Jugendlichen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von Medien auf die soziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, insbesondere im Hinblick auf das Konsumverhalten. Der Fokus liegt auf der Erforschung des Zusammenspiels von Konsumwerbung, Selbstsozialisation und digitaler Medien im Kontext der Konsumgewohnheiten von jungen Menschen.
- Die Auswirkungen der Mediatisierung auf die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen
- Die Rolle der Selbstsozialisation in der digitalen Welt
- Der Einfluss von Konsumwerbung auf das Konsumverhalten von Kindern und Jugendlichen
- Die Bedeutung von Medienkompetenz im digitalen Zeitalter
- Mögliche Risiken und Chancen des Medienkonsums für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik der Mediennutzung und deren Einfluss auf die soziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen dar. Sie skizziert die Zielsetzung der Arbeit und gibt einen Überblick über die Struktur der Arbeit. Im Anschluss werden zentrale Begriffe wie Konsumwerbung, Medien und Selbstsozialisation definiert. Anschließend werden Ergebnisse der KIM- und JIM-Studie präsentiert, die Einblicke in die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen in Deutschland liefern. Das Kapitel "Einfluss der Digitalisierung auf die soziale Entwicklung" befasst sich mit den möglichen Auswirkungen des Medienkonsums auf die Identitätsbildung und analysiert die Risiken der Selbstsozialisation durch digitale Medien. Im letzten Kapitel wird der Einfluss der Werbung auf das Konsumverhalten von Kindern und Jugendlichen beleuchtet. Die Entwicklungspsychologie der Werbewirkung wird diskutiert, die Besonderheiten von Online-Werbung werden betrachtet und die gezielte Ansprache von Kindern und Jugendlichen als Zielgruppe analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Medien, Selbstsozialisation, Konsumverhalten, Konsumwerbung, Digitalisierung, Kinder und Jugendliche, KIM-Studie, JIM-Studie, Medienkompetenz, Identitätsbildung und Werbewirkung.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflussen Medien das Konsumverhalten von Kindern?
Medien dienen als Plattform für Konsumwerbung, die Kinder bereits früh auf Marken konditioniert und deren Wünsche steuert.
Was bedeutet "Selbstsozialisation" in der digitalen Welt?
Es beschreibt den Prozess, in dem Kinder und Jugendliche ihre Identität und sozialen Werte maßgeblich durch die eigene Nutzung digitaler Medien formen.
Was zeigen die KIM- und JIM-Studien?
Diese Studien belegen, wie stark der Alltag von Kindern durch Fernsehen, Internet und Smartphones bestimmt wird und wie sich dies seit 2006 verändert hat.
Warum sind Kinder eine attraktive Zielgruppe für Unternehmer?
Aufgrund ihres hohen Einflusses auf Familienentscheidungen und der Möglichkeit, sie bereits im Kindesalter langfristig an Marken zu binden.
Welche Risiken birgt die zunehmende Digitalisierung?
Die Arbeit analysiert Risiken für die Identitätsbildung und die Gefahr einer unreflektierten Übernahme von Konsumwerten durch ständige Werbepräsenz.
Wie können Schulen zur Medienkompetenz beitragen?
Bildungsinstitutionen sollten Familien schulen, damit Kinder ihre Mediennutzung und die Wirkung von Werbung bewusster hinterfragen können.
- Quote paper
- Hayat Sheekhosman (Author), 2020, Konsumwerbung und Selbstsozialisation. Der Einfluss der Medien auf das Konsumverhalten von Kindern und Jugendlichen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/940972