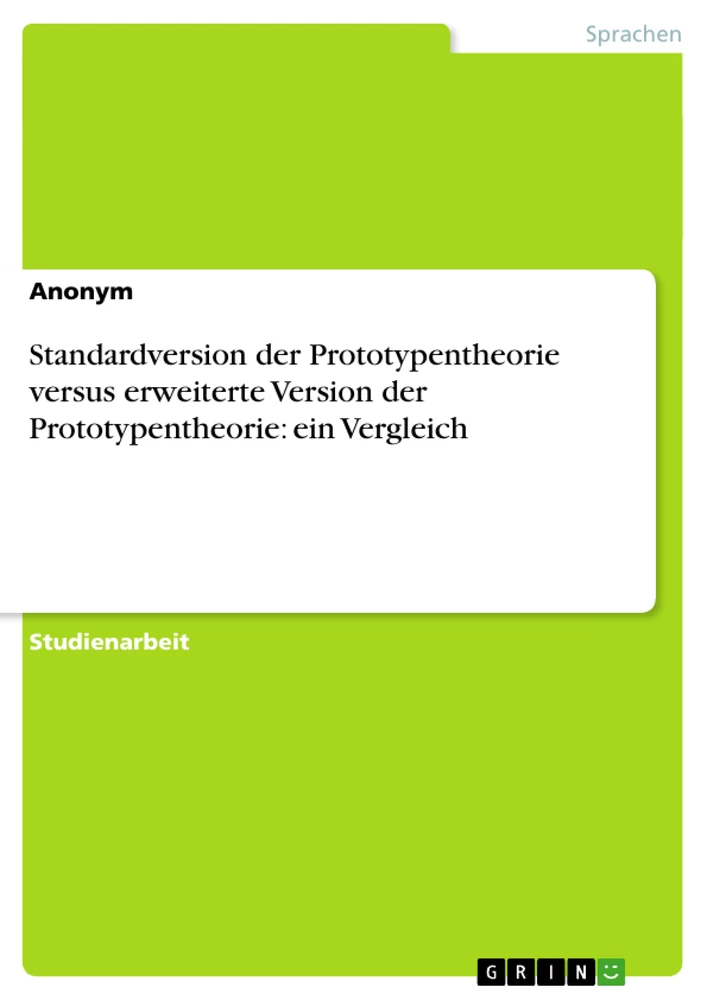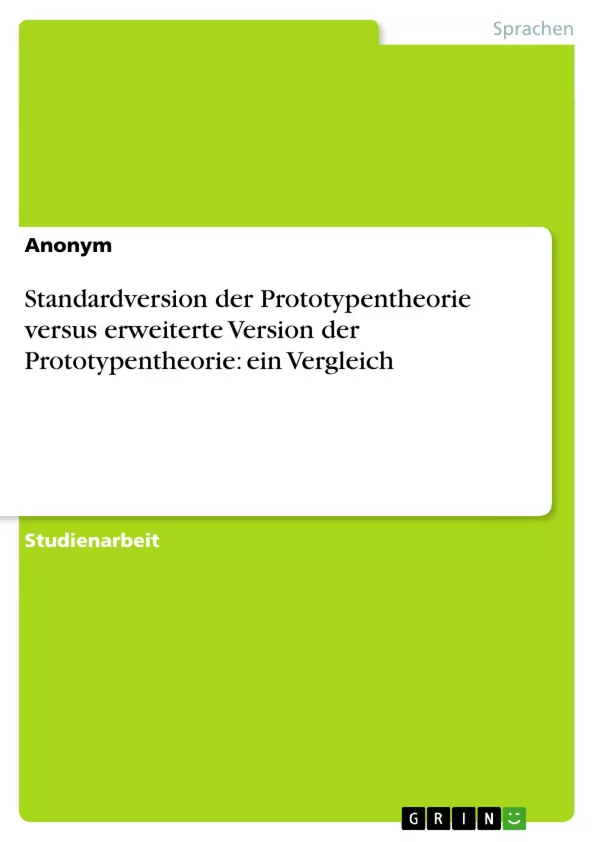Augusta: Was meinst du, welche Farbe die Marsmenschen haben?
Freundin: Grün.
Augusta: Was für ein Grün? Ich meine, sind sie smaragdgrün oder erbsengrün oder apfelgrün oder flaschengrün oder meergrün oder wie?
Freundin: Also, ich finde, sie haben so ein grünes Grün.
(Aitchison 1997: 65)
Wie dieser kleine Dialog zwischen Augusta und ihrer Freundin zeigen soll, gehen Sprecher anscheinend davon aus, dass manche Wortreferenten grundlegender und einige Objekte bessere Vertreter für die Bedeutung eines Wortes sind als andere. So ist für Augustas Freundin das Grün der Marsmenschen nicht irgendeines, sondern ein besonders grünes Grün. Dies wird auch deutlich, wenn man z.B. einen Pinguin mit einem Vogel, der alle typischen Merkmale eines idealen Vogels trägt, vergleicht. Einige Merkmale des Pinguins stimmen mit diesem idealen Vogel überein, so dass man den Pinguin als Vogel bezeichnen kann. Der Pinguin muss keine feste Anzahl an Vogelmerkmalen haben, um als Vogel charakterisiert zu werden, seine Merkmale müssen nur einigermaßen mit denen des idealen, prototypischen Vogels übereinstimmen. Für Aitchison ist dies eine faszinierende Idee, die jedoch noch überprüft werden muss (vgl. Aitchison 1997: 65f). Dies tat Eleanor Rosch in den 70er Jahren in verschiedenen Experimenten. Aus der Analyse der Ergebnisse dieser Experimente entwickelte sie mit ihren Mitarbeitern die Standardversion der Prototypensemantik. Ziel dieser Prototypensemantik ist es, „die Zonen der gemeinsamen Prototypenkenntnisse zu beschreiben (Kleiber 1998: 31).“ Inzwischen haben Rosch und ihre Mitarbeiter ihre Meinung zu einigen Punkten der Theorie geändert und eine neue Version, die erweiterte Version der Prototypensemantik, erarbeitet.
In dieser Arbeit werde ich zunächst die Standardversion beschreiben, wobei das Hauptaugenmerk auf dem Begriff des Prototyps und der Kategorisierung liegt. Anschließend werde ich die Probleme der Standardversion darlegen, die zum nächsten Abschnitt, der erweiterten Version der Prototypensemantik, führen. Betrachtet man beide Theorien, stellt sich die Frage, ob die Theorien aufeinander aufbauen und ob die erweiterte Version, wie es ihr Name sagt, eine Erweiterung, Weiterführung und Weiterentwicklung der Standardversion ist. Dies wird im Vergleich beider Theorien im vierten Abschnitt deutlich, auf den abschließend eine kurze Zusammenfassung folgt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Standardversion der Prototypensemantik
- Die horizontale Ebene
- Die vertikale Ebene
- Probleme mit der Standardversion
- Die erweiterte Theorie der Prototypensemantik
- Vorläufige Lösung
- Die neue, erweiterte Version
- Vergleich der Versionen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Prototypensemantik und analysiert die Unterschiede zwischen der Standardversion und der erweiterten Version der Theorie. Ziel ist es, die beiden Versionen zu vergleichen und die Entwicklung der Prototypensemantik aufzuzeigen.
- Der Prototyp als bestes Beispiel einer Kategorie
- Die horizontale und vertikale Ebene der Kategorisierung
- Kritik an der Standardversion der Prototypensemantik
- Die Erweiterung der Prototypensemantik
- Vergleich der beiden Versionen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt das Thema und den Forschungsgegenstand ein und erläutert die Bedeutung von Prototypen in der Sprachwissenschaft. Kapitel 2 behandelt die Standardversion der Prototypensemantik, indem es die horizontale und vertikale Ebene der Kategorisierung detailliert beschreibt. Anschließend werden in Kapitel 3 die Probleme der Standardversion und die daraus resultierende Erweiterung der Theorie aufgezeigt. Im vierten Kapitel erfolgt ein detaillierter Vergleich der beiden Versionen der Prototypensemantik.
Schlüsselwörter
Prototypensemantik, Standardversion, erweiterte Version, Kategorisierung, horizontale Ebene, vertikale Ebene, Prototyp, bestes Beispiel, sprachliche Repräsentation, kognitive Semantik.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2007, Standardversion der Prototypentheorie versus erweiterte Version der Prototypentheorie: ein Vergleich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94169