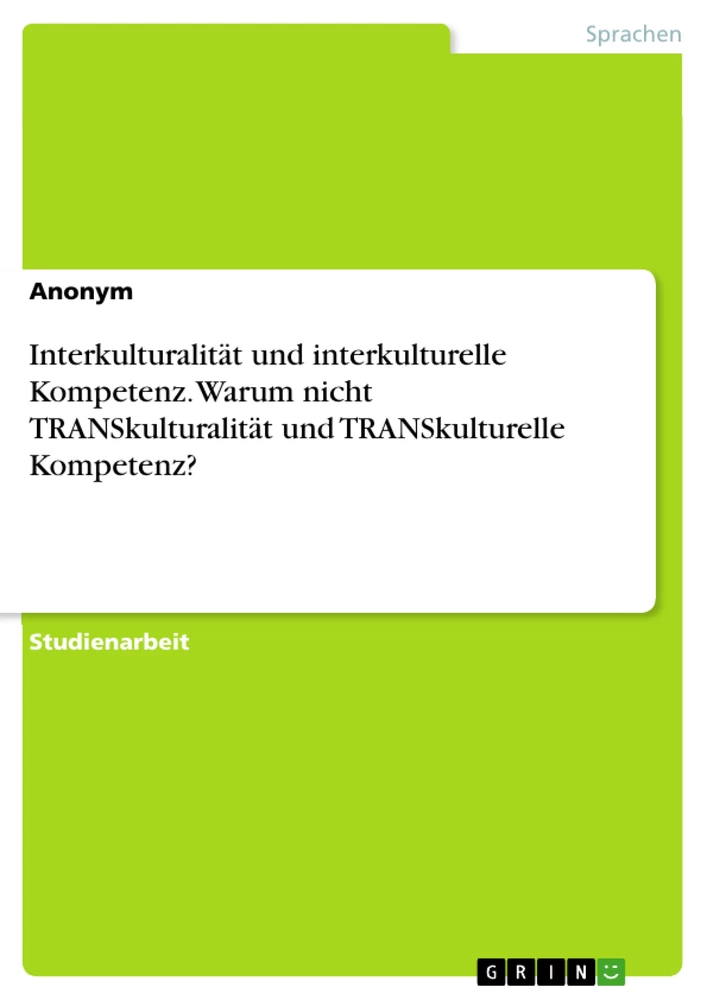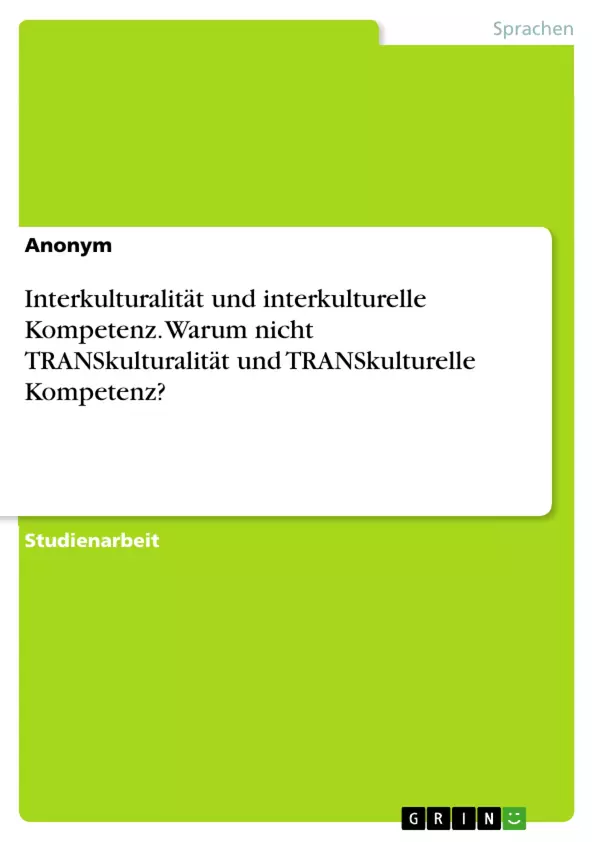In der folgenden Arbeit werden zusätzliche Begriffe wie "Transkulturalität" und "Multikulturalität" betrachtet. Im Laufe der Argumentation werden Gemeinsamkeiten, Unterschiede, Vorteile und Nachteile herausgearbeitet. Die zu bearbeitende Fragestellung lautet: "Interkulturalität und interkulturelle Kompetenz – Warum nicht TRANSkulturalität und TRANSkulturelle Kompetenz?"
Das Thema des Aufeinandertreffens unterschiedlicher Kulturen ist in der heutigen Gesellschaft ein allgegenwärtiges Thema geworden. Heutzutage ist ein Restaurant- oder ein Barbesuch, ohne Menschen anderer Religionen zu treffen, nicht mehr möglich. Und warum sollte es das auch? In Deutschland leben dutzende verschiedenartige Kulturen meist friedlich zusammen. Auch in der Schule ist eine rein deutsche Klasse zur absoluten Seltenheit geworden. Dieser Aspekt darf auf keinen Fall negativ betrachtet werden. Das Zusammenlernen in der Klasse mit Kindern mit Migrationshintergrund ist positiv konnotiert. Der Grundstein für ein friedliches Zusammenleben in einer Gemeinschaft mit verschiedensten Kulturen muss bereits in der Grundschule gelegt werden. Wird dieser Aspekt bereits in der frühen Kindheit gelehrt, fallen den Schülerinnen und Schülern meist kulturelle Unterschiede überhaupt nicht auf. Kinder werden als gut geboren und erst durch di e Interaktion mit der Gesellschaft verändern sich ihre Werte und Anschauungen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINLEITUNG
- 2 BEGRIFFLICHKEITEN
- 2.1 KULTUR
- 2.2 STEREOTYPEN
- 2.3 VORURTEILE
- 2.4 INTERKULTURALITÄT
- 2.5 INTERKULTURELLE KOMPETENZ
- 2.5.1 Interkulturelles Wissen (kognitiv)
- 2.5.2 Interkulturelle Sensibilität (affektiv)
- 2.5.3 Interkulturelle Handlungskompetenz (verhaltensorientiert)
- 2.6 TRANSKULTURALITÄT
- 2.7 MULTIKULTURALITÄT
- 3 DIE BEGRIFFE DER INTER- UND TRANSKULTURELLEN KOMPETENZ IM VERGLEICH
- 3.1 WAS IST DER UNTERSCHIED ZWISCHEN DEN VORSILBEN „TRANS“- UND „INTER“-?
- 3.2 WAS GIBT ES FÜR VOR- UND NACHTEILE BEI DER BENUTZUNG DIESER BEGRIFFE?
- 4 BEZUG ZU DEUTSCH ALS ZWEITSPRACHE
- 5 FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Begriffe Interkulturalität und interkulturelle Kompetenz im Vergleich zu Transkulturalität und transkultureller Kompetenz. Ziel ist es, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten dieser Konzepte herauszuarbeiten und die Vor- und Nachteile ihrer Verwendung zu diskutieren. Der Bezug zu Deutsch als Zweitsprache wird ebenfalls beleuchtet.
- Definition und Abgrenzung von Kultur, Stereotypen und Vorurteilen
- Analyse des Begriffs Interkulturalität und seine verschiedenen Facetten
- Untersuchung des Konzepts der interkulturellen Kompetenz und seiner Komponenten
- Vergleich der Begriffe Interkulturalität/interkulturelle Kompetenz mit Transkulturalität/transkulturelle Kompetenz
- Relevanz der Thematik im Kontext von Deutsch als Zweitsprache
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema des Aufeinandertreffens verschiedener Kulturen in der modernen Gesellschaft ein und betont die Bedeutung interkultureller Kompetenz, insbesondere im Bildungssystem. Sie begründet die Erweiterung der Betrachtung auf die Begriffe Transkulturalität und Multikulturalität und formuliert die zentrale Forschungsfrage: Warum nicht Transkulturalität und transkulturelle Kompetenz statt Interkulturalität und interkulturelle Kompetenz?
2 Begrifflichkeiten: Dieses Kapitel liefert detaillierte Definitionen und Erläuterungen zu zentralen Begriffen wie Kultur, Stereotypen, Vorurteile, Interkulturalität und Transkulturalität. Es hebt die Vieldeutigkeit des Begriffs „Kultur“ hervor und diskutiert verschiedene Definitionen aus der Kulturanthropologie. Die Kapitelteile zu Stereotypen und Vorurteilen beleuchten deren Entstehung und Auswirkungen auf interkulturelle Beziehungen. Der Abschnitt zu Interkulturalität verdeutlicht das reine Aufeinandertreffen unterschiedlicher Kulturen, während Transkulturalität und Multikulturalität als verwandte, aber distinkte Konzepte vorgestellt werden.
3 Die Begriffe der Inter- und Transkulturellen Kompetenz im Vergleich: Dieses Kapitel vergleicht die Konzepte der Inter- und Transkulturellen Kompetenz. Es analysiert die Unterschiede in den Vorsilben „Inter-“ und „Trans-“ und diskutiert die Vor- und Nachteile der Verwendung beider Begriffe in verschiedenen Kontexten. Die Analyse fokussiert auf die unterschiedlichen Perspektiven und Implikationen der beiden Konzepte für das Verständnis und den Umgang mit kultureller Vielfalt.
4 Bezug zu Deutsch als Zweitsprache: Dieses Kapitel (hier nur angedeutet, da der Text unvollständig ist) untersucht vermutlich die Relevanz der Konzepte der Inter- und Transkulturalität im Kontext des Erlernens von Deutsch als Zweitsprache und die Implikationen für den Sprachunterricht und die interkulturelle Kommunikation.
Schlüsselwörter
Interkulturalität, Transkulturalität, Multikulturalität, interkulturelle Kompetenz, transkulturelle Kompetenz, Kultur, Stereotypen, Vorurteile, Deutsch als Zweitsprache, kulturelle Vielfalt, kulturelle Begegnung.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur Arbeit: Interkulturalität vs. Transkulturalität
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die Konzepte der Interkulturalität und interkulturellen Kompetenz mit denen der Transkulturalität und transkulturellen Kompetenz. Sie untersucht die Unterschiede und Gemeinsamkeiten dieser Konzepte und diskutiert die Vor- und Nachteile ihrer Anwendung. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Bezug zum Kontext „Deutsch als Zweitsprache“.
Welche Begriffe werden in der Arbeit definiert und abgegrenzt?
Die Arbeit definiert und grenzt zentrale Begriffe ab, darunter Kultur, Stereotype, Vorurteile, Interkulturalität, Transkulturalität und Multikulturalität. Sie beleuchtet die Vielschichtigkeit des Kulturbegriffs und analysiert die Entstehung und Wirkung von Stereotypen und Vorurteilen auf interkulturelle Beziehungen.
Wie werden Interkulturalität und Transkulturalität unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen Interkulturalität (reines Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen) und Transkulturalität (ein dynamischer Prozess der Vermischung und Transformation von Kulturen). Sie analysiert die Unterschiede in den Vorsilben „Inter-“ und „Trans-“ und die daraus resultierenden unterschiedlichen Perspektiven und Implikationen für den Umgang mit kultureller Vielfalt.
Was ist der Fokus auf interkulturelle und transkulturelle Kompetenz?
Die Arbeit untersucht die Komponenten der interkulturellen Kompetenz (Wissen, Sensibilität, Handlungskompetenz) und vergleicht sie mit den entsprechenden Aspekten der transkulturellen Kompetenz. Sie analysiert die Vor- und Nachteile der Verwendung beider Begriffe in verschiedenen Kontexten.
Welche Rolle spielt „Deutsch als Zweitsprache“ in dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Relevanz der Konzepte der Inter- und Transkulturalität für das Erlernen von Deutsch als Zweitsprache und deren Implikationen für den Sprachunterricht und die interkulturelle Kommunikation. (Dieser Abschnitt ist im vorliegenden Auszug nur angedeutet).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Begrifflichkeiten (inkl. Kultur, Stereotype, Vorurteile, Inter-/Transkulturalität und Inter-/Transkulturelle Kompetenz), Vergleich von Inter- und Transkultureller Kompetenz, Bezug zu Deutsch als Zweitsprache und Fazit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Interkulturalität, Transkulturalität, Multikulturalität, interkulturelle Kompetenz, transkulturelle Kompetenz, Kultur, Stereotypen, Vorurteile, Deutsch als Zweitsprache, kulturelle Vielfalt, kulturelle Begegnung.
Was ist die zentrale Forschungsfrage der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Warum nicht Transkulturalität und transkulturelle Kompetenz statt Interkulturalität und interkulturelle Kompetenz?
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2020, Interkulturalität und interkulturelle Kompetenz. Warum nicht TRANSkulturalität und TRANSkulturelle Kompetenz?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/941742