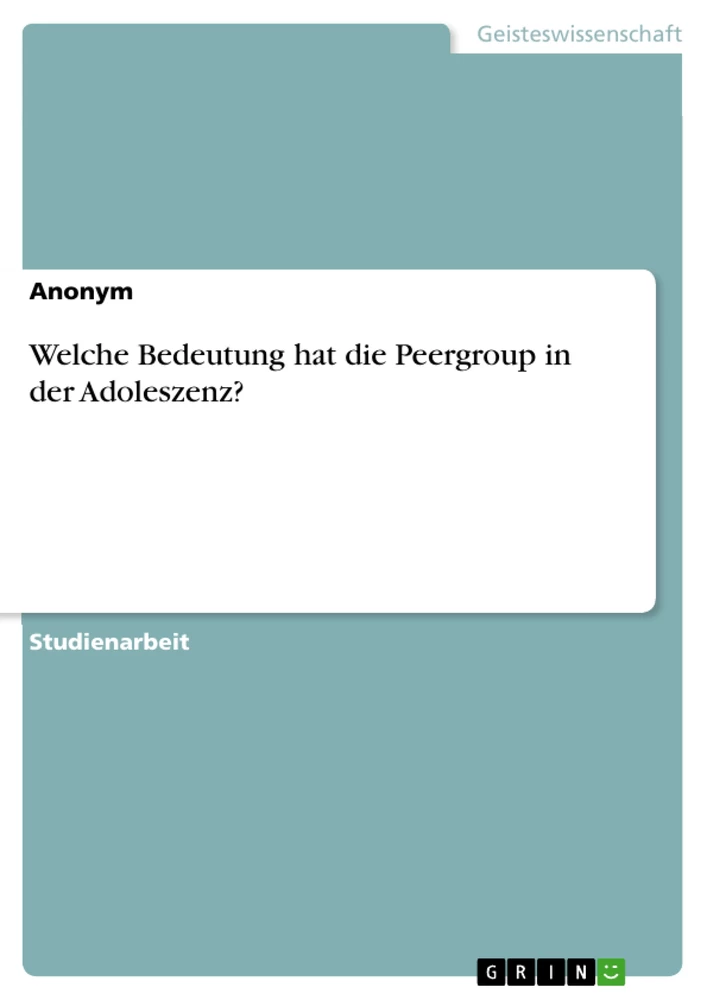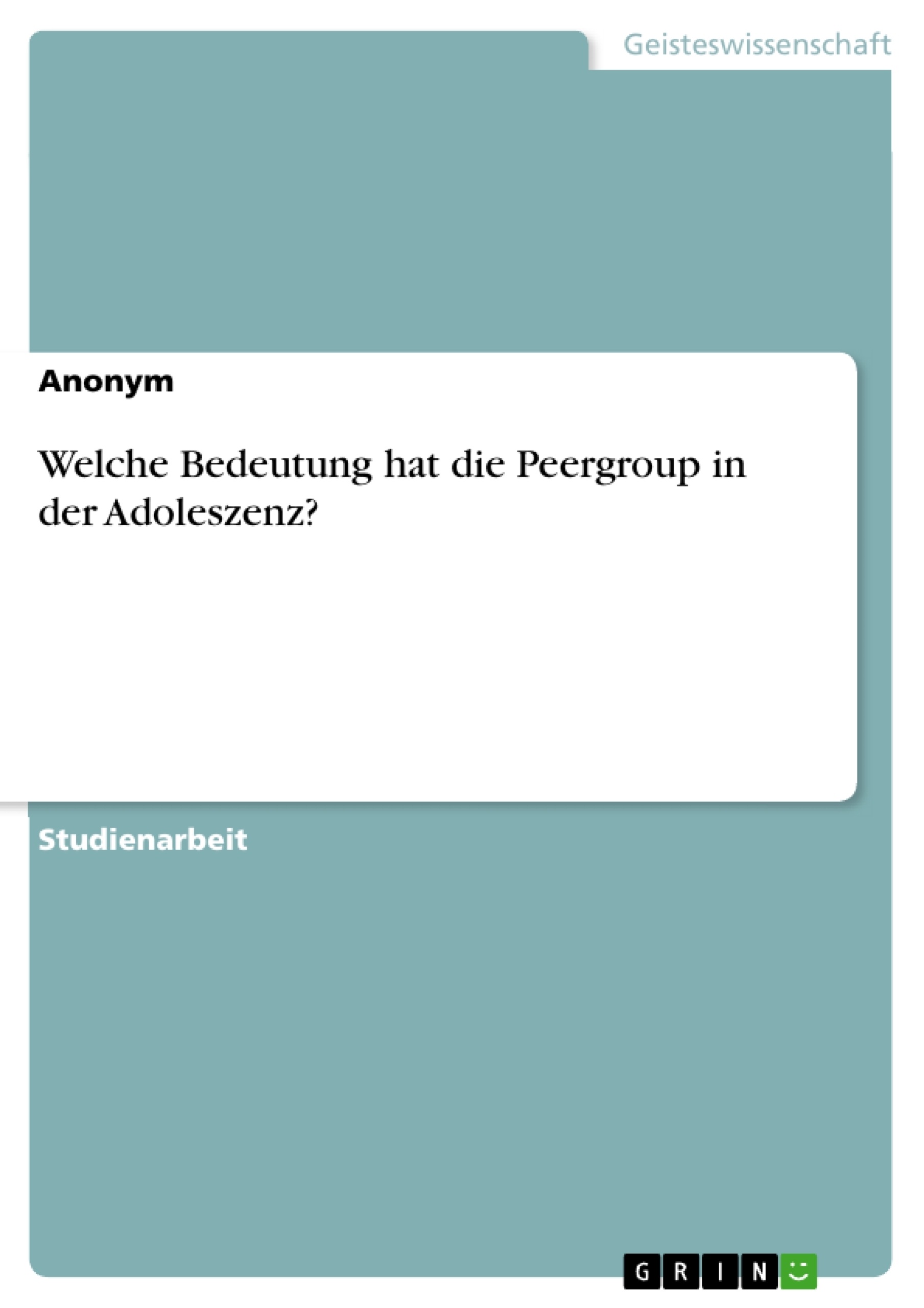In dieser wissenschaftlichen Arbeit wird die Bedeutung der Peergroup in der Adoleszenz thematisiert. Peergroup bedeutet Gleichaltrigengruppe. Jugendliche erleben in der Pubertät viele geistige und körperliche Veränderungen. Sie verbringen zunehmend Zeit mit ihren Freunden und erleben die ersten romantischen Beziehungen. Gegenüber ihren Eltern haben sie kleinere Meinungsverschiedenheiten und haben Geheimnisse vor ihnen.
Der Status in der Gleichaltrigengruppe sowie deren Messung ist ein Themenpunkt dieser wissenschaftlichen Arbeit. Des Weiteren wird die Auswirkung des Peerstatus auf die Entwicklung der Jugendlichen betrachtet. Die Eltern-Kind-Beziehung prägt den Jugendlichen bezüglich des Verhaltens gegenüber den Gleichaltrigen und hat Auswirkung auf den Status des Kindes in der Gruppe. Im Bezug auf die Problemfrage werden romantische Beziehungen und deren Wirkung auf die Peergroup analysiert. Vorab werden die drei Phasen in der Adoleszenz thematisiert, da die Bedeutung der Peergroup sich mit den Phasen ändert. Havighurst stellt den Kontakt zu Gleichaltrigen in seinem Konzept der Entwicklungsaufgaben dar. Daher ist dies neben dem Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung des Menschen von Erikson ein weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit, um anschließend die Bedeutung der Peergroup für die Jugendlichen zu analysieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Adoleszenz
- Soziale und Psychosoziale Entwicklung
- Peergroup
- Bedeutung der Peergroup
- Bedeutung des sozialen Status und deren Messung
- Peerstatus als Verursacher von Entwicklungsrisiken
- Aufnahme romantischer Beziehungen
- Einfluss der Eltern auf die Peerbeziehungen
- Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung der Peergroup während der Adoleszenz. Ziel ist es, den Einfluss der Gleichaltrigengruppe auf die Identitätsfindung, die soziale und psychosoziale Entwicklung Jugendlicher zu beleuchten. Dabei werden verschiedene Aspekte betrachtet, die die Rolle der Peergroup prägen.
- Identitätsfindung in der Adoleszenz
- Der Einfluss des sozialen Status innerhalb der Peergroup
- Die Rolle romantischer Beziehungen im Kontext der Peergroup
- Der Einfluss der Eltern-Kind-Beziehung auf die Peerbeziehungen
- Entwicklungsaufgaben im Jugendalter nach Havighurst
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Bedeutung der Peergroup in der Adoleszenz ein. Sie beschreibt die Veränderungen, die Jugendliche in der Pubertät durchmachen, den zunehmenden Einfluss der Gleichaltrigen und das Streben nach Selbstständigkeit. Es wird auf die zentrale Frage nach dem Einfluss des Status in der Peergroup und die Rolle der Eltern-Kind-Beziehung hingewiesen. Die Arbeit benennt Eriksons Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung und Havighursts Konzept der Entwicklungsaufgaben als wichtige theoretische Bezugspunkte für die Analyse.
Adoleszenz: Dieses Kapitel definiert den Begriff Adoleszenz als Entwicklungsphase zwischen Kindheit und Erwachsensein. Es beschreibt die Abgrenzung zur Pubertät und gliedert die Adoleszenz in frühe, mittlere und späte Phase, wobei die jeweiligen Altersbereiche und Entwicklungsschwerpunkte erläutert werden. Der Einfluss sozioökonomischer und kultureller Faktoren auf die Länge der Adoleszenzphase wird ebenfalls angesprochen.
Soziale und Psychosoziale Entwicklung: Dieses Kapitel beleuchtet die soziale Entwicklung als Veränderung im Umgang mit anderen Menschen und Gruppen. Es werden die Aspekte sozialkognitiver Prozesse und das Verhalten gegenüber Peers thematisiert. Das Kapitel führt Eriksons Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung ein, welches die Entwicklung des Menschen über acht Krisen hinweg beschreibt, und hebt die Bedeutung der Identitätssuche in der Adoleszenz hervor.
Schlüsselwörter
Adoleszenz, Peergroup, Gleichaltrigengruppe, sozialer Status, Identitätsfindung, Pubertät, Entwicklungsaufgaben, Havighurst, Erikson, Eltern-Kind-Beziehung, romantische Beziehungen.
Häufig gestellte Fragen zu: Bedeutung der Peergroup in der Adoleszenz
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung der Peergroup während der Adoleszenz und beleuchtet den Einfluss der Gleichaltrigengruppe auf die Identitätsfindung und die soziale sowie psychosoziale Entwicklung Jugendlicher. Dabei werden verschiedene Aspekte wie sozialer Status, romantische Beziehungen und der Einfluss der Eltern-Kind-Beziehung betrachtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel Einleitung, Adoleszenz, Soziale und Psychosoziale Entwicklung, Peergroup (inkl. Unterkapitel zu Bedeutung der Peergroup, sozialem Status, Entwicklungsrisiken, romantischen Beziehungen und elterlichem Einfluss) und Diskussion.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, den Einfluss der Peergroup auf die Identitätsfindung und die soziale und psychosoziale Entwicklung Jugendlicher zu analysieren. Es sollen verschiedene Aspekte der Rolle der Peergroup in der Adoleszenz beleuchtet werden.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Identitätsfindung in der Adoleszenz, den Einfluss des sozialen Status innerhalb der Peergroup, die Rolle romantischer Beziehungen, den Einfluss der Eltern-Kind-Beziehung auf Peerbeziehungen und Entwicklungsaufgaben im Jugendalter nach Havighurst.
Wie wird die Adoleszenz definiert?
Die Adoleszenz wird als Entwicklungsphase zwischen Kindheit und Erwachsensein definiert und in frühe, mittlere und späte Phase unterteilt, wobei die jeweiligen Altersbereiche und Entwicklungsschwerpunkte erläutert werden. Sozioökonomische und kulturelle Einflüsse auf die Dauer der Adoleszenz werden ebenfalls berücksichtigt.
Welche theoretischen Modelle werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf Eriksons Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung und Havighursts Konzept der Entwicklungsaufgaben als wichtige theoretische Bezugspunkte für die Analyse.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in das Thema ein, beschreibt die Veränderungen in der Pubertät, den zunehmenden Einfluss der Gleichaltrigen und das Streben nach Selbstständigkeit. Sie benennt die zentrale Fragestellung nach dem Einfluss des Status in der Peergroup und der Rolle der Eltern-Kind-Beziehung und nennt Eriksons Stufenmodell und Havighursts Konzept als theoretische Bezugspunkte.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Adoleszenz, Peergroup, Gleichaltrigengruppe, sozialer Status, Identitätsfindung, Pubertät, Entwicklungsaufgaben, Havighurst, Erikson, Eltern-Kind-Beziehung, romantische Beziehungen.
Was wird im Kapitel "Soziale und Psychosoziale Entwicklung" behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet die soziale Entwicklung als Veränderung im Umgang mit anderen Menschen und Gruppen. Es thematisiert sozialkognitive Prozesse und das Verhalten gegenüber Peers und führt Eriksons Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung ein, welches die Entwicklung des Menschen über acht Krisen hinweg beschreibt und die Bedeutung der Identitätssuche in der Adoleszenz hervorhebt.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Welche Bedeutung hat die Peergroup in der Adoleszenz?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/945342