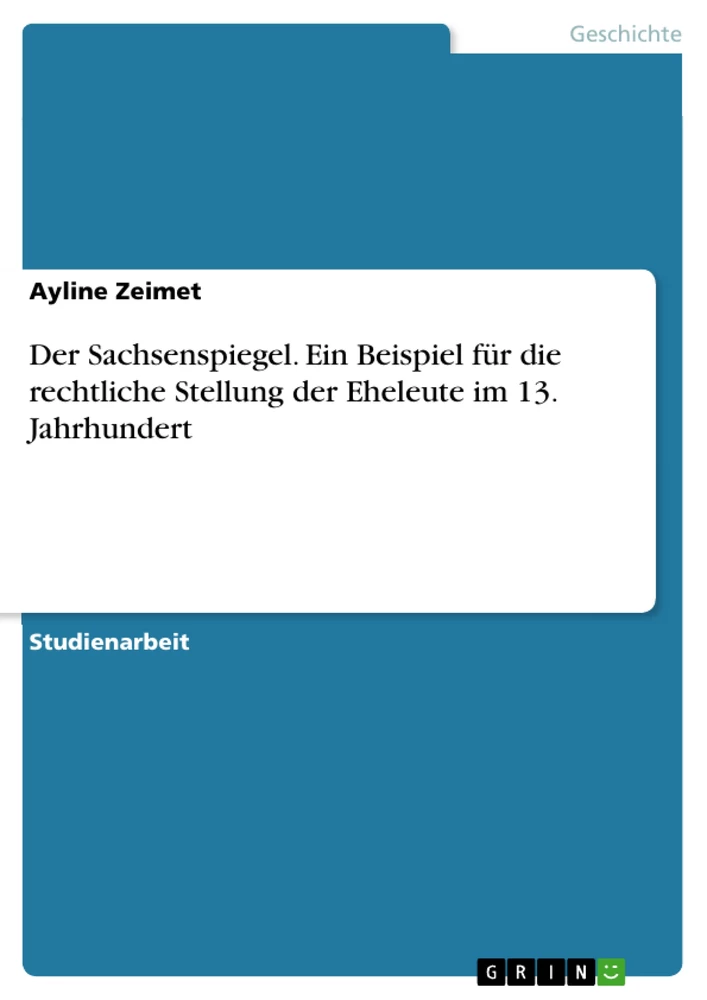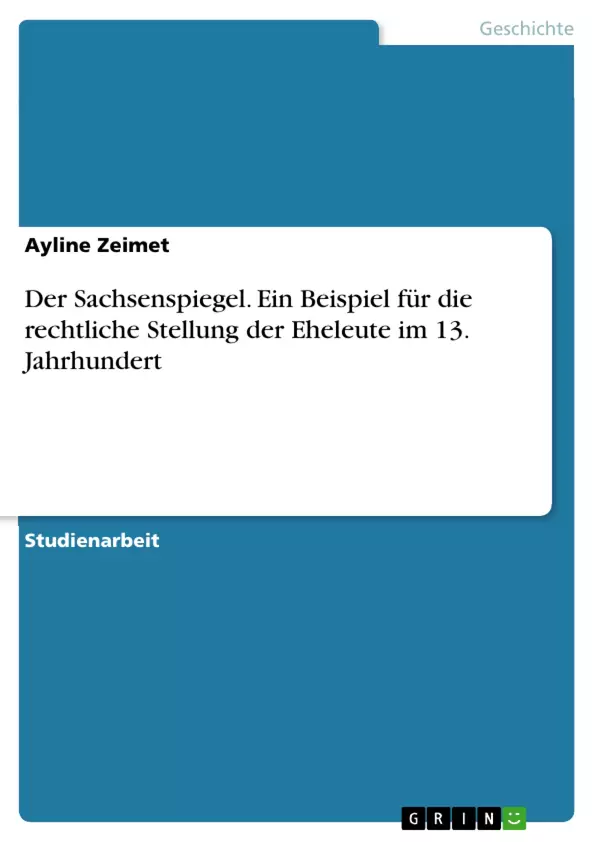Die Arbeit geht folgenden Fragen nach: Welche Formen der mittelalterlichen Ehe gab es? Welche Rechte hatten die Eheleute? Wie wird das Eherecht im Sachsenspiegel aufgeführt und welche Rechte hatten die Eheleute?
Um diese Fragestellungen beantworten zu können, ist die vorliegende Arbeit in zwei Kapitel eingeteilt. Im ersten Kapitel wird zunächst auf die unterschiedlichen Eheformen des Mittelalters eingegangen, um den Begriff der mittelalterlichen Ehe näher zu erläutern. Im Einzelnen werden die Muntehe, die Friedelehe, die Kebsehe so-wie die Raub- und Entführungsehe betrachtet. In dem zweiten Kapitel liegt der Fokus auf dem Sachsenspiegel, welcher für diese Arbeit relevante Quellenpassagen darlegt. Nachdem auf den Inhalt und die Kontextualisierung des Sachsenspiegels eingegangen wurde, wird das Recht der Eheschließung, die Ehevormundschaft, das Ehegüterrecht, sowie das Scheidungs- und Erbrecht bearbeitet. Am Ende dieser Arbeit werden die Fragestellungen im Rückblick auf das Erarbeitete beantwortet.
Die rechtliche Stellung des Einzelnen ist heute, wie auch im Mittelalter, von großer Bedeutung. Die mittelalterliche Auffassung von Recht unterschied sich jedoch von der heutigen. Recht bedeutete sowohl Recht, als auch Pflicht, im Sinne von Gerechtigkeit, Treue und Wahrhaftigkeit. Des Weiteren war die mittelalterliche Rechtsordnung weitgehend eine mündliche. Die einzuhaltenden Normen waren ein ungeschriebenes Gewohnheitsrecht, welches von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Erst im 12. Jahrhundert drang aus Oberitalien das wiederentdeckte römische Recht in die europäische Rechtsordnung des Mittelalters ein. Dieses war im Gegensatz zum heimischen Recht umfangreich und schriftlich festgehalten. Im 13. Jahrhundert begann daraufhin in Europa die Zeit der Rechtsspiegel, welche keine offiziellen Gesetzesbücher, sondern Privataufzeichnungen des Gewohnheitsrechts waren. Besonders nennenswert ist daher der Sachsenspiegel, das erste deutschsprachige Prosawerk und, neben dem Mühlhäuser Reichsrechtsbuch, ebenfalls das älteste deutschsprachige Rechtsbuch. Typisch für unsere Rezeption der Gesellschaftsordnung und der Rechtskultur des Mittelalters scheint die ungleiche Stellung von Mann und Frau: Frauen sind den Männern unterlegen, haben weder Rechte noch Freiheiten. Besonders die mittelalterliche Ehe wird als ein Repressionsmittel der damaligen Zeit rezipiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die mittelalterliche Ehe
- Allgemeines zur mittelalterlichen Ehe
- Die mittelalterlichen Eheformen
- Die Muntehe
- Die Friedelehe
- Die Kebsehe sowie die Raub- und Entführungsehe
- Das mittelalterliche Eherecht
- Der Sachsenspiegel
- Das Recht der Eheschließung
- Die Ehevormundschaft
- Das Ehegüterrecht
- Das Recht der Ehescheidung
- Das Erbrecht
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der rechtlichen Stellung der Eheleute im 13. Jahrhundert am Beispiel des Sachsenspiegels. Sie untersucht die verschiedenen Eheformen des Mittelalters, insbesondere die Muntehe, Friedelehe und Kebsehe, sowie die rechtlichen Aspekte der Ehe im Sachsenspiegel, einschließlich der Eheschließung, Ehefrauenvormundschaft, des Ehegüterrechts, der Ehescheidung und des Erbrechts.
- Untersuchung der verschiedenen Eheformen des Mittelalters
- Analyse des Eherechts im Sachsenspiegel
- Besondere Berücksichtigung des Rechts der Eheschließung, Ehefrauenvormundschaft, des Ehegüterrechts und der Ehescheidung
- Rekonstruktion der rechtlichen Stellung der Eheleute im 13. Jahrhundert
- Vergleich des mittelalterlichen Eheverständnisses mit dem heutigen Verständnis
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung der rechtlichen Stellung des Einzelnen im Mittelalter und vergleicht sie mit der heutigen Zeit. Sie betont die Besonderheiten des mittelalterlichen Rechtsverständnisses und die Entstehung des Sachsenspiegels als bedeutendes Rechtsbuch.
2. Die mittelalterliche Ehe
2.1. Allgemeines zur mittelalterlichen Ehe
Dieser Abschnitt erläutert die Bedeutung der Eheschließung als Grundlage der mittelalterlichen Familie und die zentrale Rolle des Erbes in der Ehe. Er beschreibt den Übergang der Frau von der Munt der Eltern in die Munt des Ehemannes und die fehlende Präsenz von Liebesheiraten.
2.2. Die mittelalterlichen Eheformen
2.2.1. Die Muntehe
Die Muntehe, oft als Kaufehe bezeichnet, wird als eine vertraglich geregelte Eheform beschrieben, die durch eine bestimmte Reihenfolge von Schritten, wie der Petitio, Desponsatio und Nuptiae, gekennzeichnet ist. Der Abschnitt erläutert die Bedeutung des Muntschatzes, der von dem Bräutigam an die Eltern der Braut bezahlt wird, und der Traditio als feierlichen, weltlichen und öffentlichen Rechtsakt.
2.2.2. Die Friedelehe
Die Friedelehe wird als eine weniger politisch motivierte Form der Ehe beschrieben, die auf dem Willen von Mann und Frau beruht. Im Gegensatz zur Muntehe erhält der Mann in der Friedelehe nicht die Munt über die Frau.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den folgenden Schlüsselbegriffen: Mittelalterliche Ehe, Sachsenspiegel, Eherecht, Muntehe, Friedelehe, Kebsehe, Raub- und Entführungsehe, Eheschließung, Ehevormundschaft, Ehegüterrecht, Ehescheidung, Erbrecht, Rechtliche Stellung, Gesellschaftsordnung, Rechtskultur.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Sachsenspiegel?
Der Sachsenspiegel ist das älteste und bedeutendste deutschsprachige Rechtsbuch des 13. Jahrhunderts, das das geltende Gewohnheitsrecht schriftlich festhielt.
Welche Formen der mittelalterlichen Ehe gab es?
Die Arbeit unterscheidet zwischen der Muntehe (Kaufehe), der Friedelehe (auf Konsens basierend), der Kebsehe sowie der Raub- und Entführungsehe.
Was versteht man unter „Muntehe“?
Die Muntehe war eine vertraglich geregelte Eheform, bei der die rechtliche Schutzgewalt (Munt) über die Frau gegen einen „Muntschatz“ vom Vater auf den Ehemann überging.
Welche rechtliche Stellung hatten Frauen in der mittelalterlichen Ehe?
Frauen unterstanden der Ehevormundschaft ihres Mannes, besaßen jedoch im Rahmen des Ehegüterrechts und Erbrechts spezifische, im Sachsenspiegel festgehaltene Ansprüche.
Gab es im 13. Jahrhundert bereits ein Scheidungsrecht?
Ja, der Sachsenspiegel enthält Regelungen zur Ehescheidung, wobei die rechtlichen und finanziellen Konsequenzen für beide Partner detailliert aufgeführt werden.
- Arbeit zitieren
- Ayline Zeimet (Autor:in), 2019, Der Sachsenspiegel. Ein Beispiel für die rechtliche Stellung der Eheleute im 13. Jahrhundert, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/945372