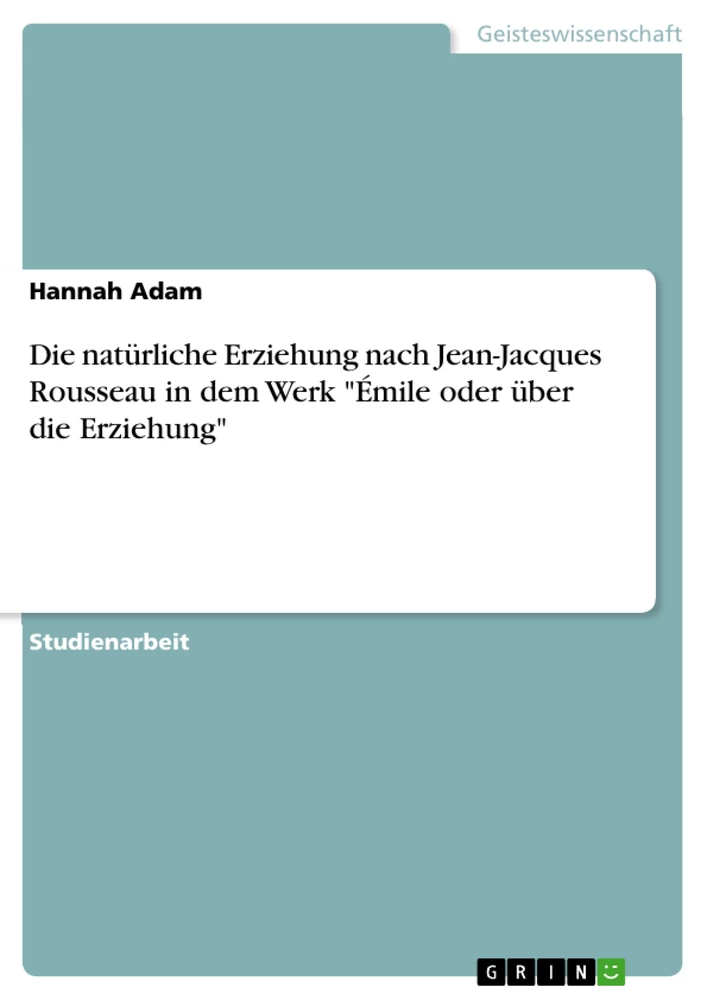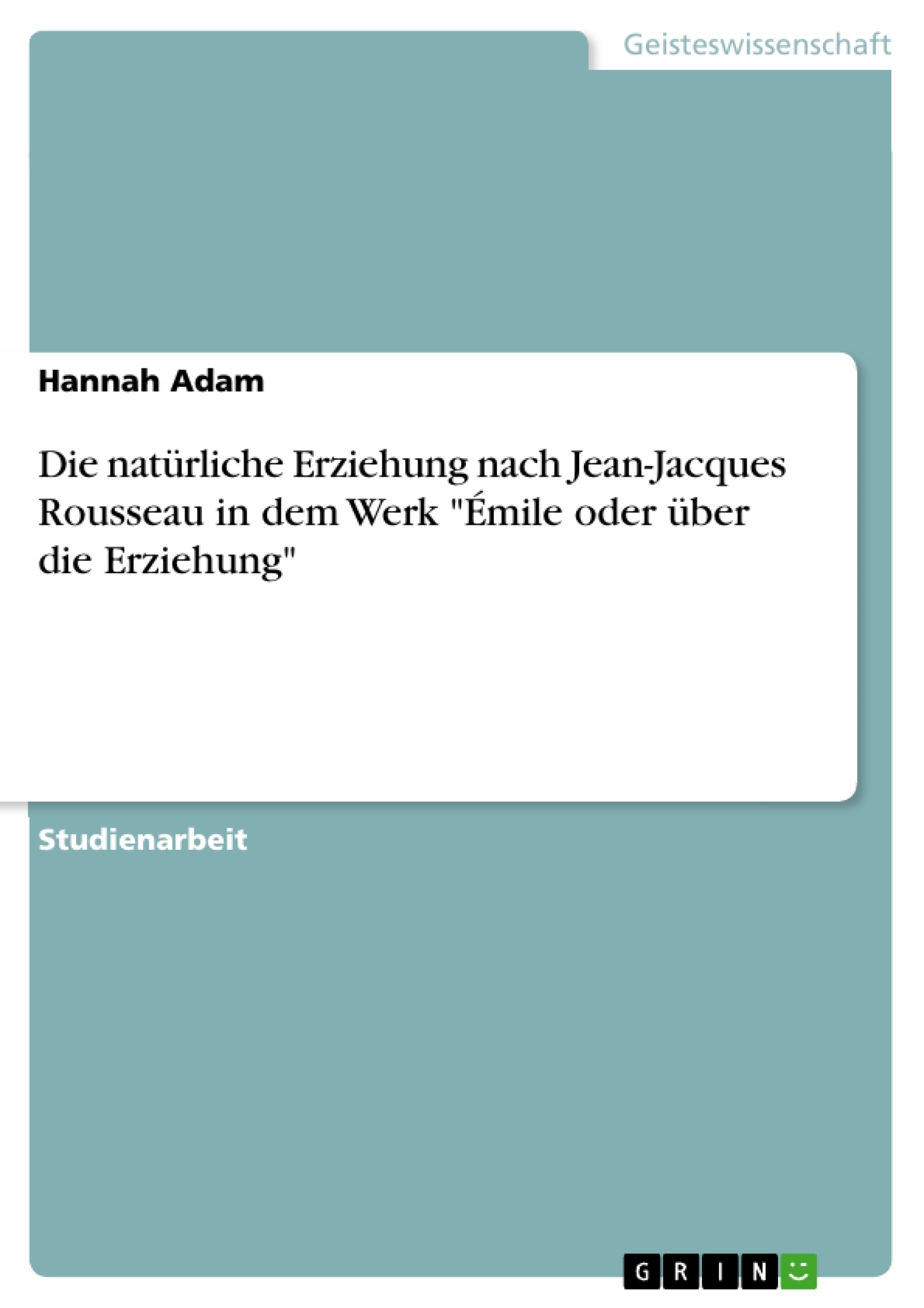Die Arbeit beschäftigt sich damit, welche Rolle der Philosoph Jean-Jacques Rousseau, welcher in der Zeit der Aufklärung wirkte, in Fragen der Kindeserziehung spielt. Aus seiner Kritik an dem damaligen Erziehungsverständnis heraus entstand sein pädagogisches Hauptwerk "Émile oder über die Erziehung". Es stellt die Fiktion einer von der Natur ausgehenden, geglückten Erziehung dar. Von diesem Traum einer gelungenen, natürlichen Erziehung und seinem Beitrag zu einem neuen Erziehungs- und Kindheitsverständnis soll diese Arbeit handeln.
Zum exakten Verständnis der Arbeit müssen vorerst die Begriffe der Kindheit und Erziehung erläutert werden. Im weiteren Verlauf wird die Entwicklung des Kindheits- und Erziehungsverständnisses in zwei Abschnitten thematisiert. Der erste Abschnitt stellt diese Entstehung skizzenhaft dar, während im zweiten Abschnitt deren konkretere Entwicklungen zur Zeit der Aufklärung erläutert werden. Es folgt eine kurze Betrachtung der Biografie Rousseaus, um seine Gedanken besser einordnen zu können. Gegenstand der darauffolgenden Analyse wird eine Konkretisierung des Verständnisses der natürlichen Erziehung nach Rousseau sein. Diese wird größtenteils im Kontext des Werkes Émile stattfinden, weshalb das Hauptwerk zuvor noch grob in Form und Inhalt gesondert beleuchtet wird.
Auf diesem Vorverständnis aufbauend wird dann die natürliche Erziehung in vier Teilaspekten genauer betrachtet. Zuerst der Begriff des Naturzustandes, auf welchen dann eine Betrachtung des konkreteren Naturverständnisses Rousseaus folgt. Aus dem Verständnis der Natur ergibt sich dann Rousseaus Verständnis der Erziehung, welches im nächsten Teilpunkt beleuchtet wird. Der Autor schildert in seinem Werk Émile ein konkretes Erziehungskonzept, welches zusätzlich noch separat betrachtet wird. Um Rousseaus Beitrag zu unserem heutigen Verständnis von Kindheit und Erziehung zu verdeutlichen, wird zusätzlich die Wirkungsgeschichte Rousseaus beleuchtet. Durch die Betrachtung der genannten Teilpunkte wird deutlich, ob Rousseau einen revolutionären Beitrag zur Entwicklung der Erziehung geleistet hat. Die wissenschaftliche Arbeit fasst abschließend die erarbeiteten Erkenntnisse zusammen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begrifflichkeiten
- Kindheit
- Erziehung
- Die Geschichte von Kindheit und Erziehung
- Sonderstellung der Kinder
- ,,Entdeckung“ der Kindheit und Erziehung...
- Konkretisierung des Kindheitskonzepts und der Erziehung...
- Jean-Jacques Rousseau
- Leben...
- ,,Émile oder über die Erziehung".
- Die natürliche Erziehung
- Naturzustand
- Naturverständnis..
- Erziehungsverständnis..
- Erziehungskonzept
- Wirkungsgeschichte Rousseaus
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit Jean-Jacques Rousseau und dessen Konzept der natürlichen Erziehung. Ziel ist es, die Entstehung und Entwicklung des Kindheits- und Erziehungsverständnisses bis hin zur Zeit Rousseaus zu beleuchten und dessen Einfluss auf die pädagogische Diskussion zu analysieren.
- Entwicklung des Kindheits- und Erziehungsverständnisses
- Rousseaus Biografie und seine Kritik an der damaligen Erziehung
- Das Werk „Émile oder über die Erziehung“ als zentrale Quelle für das Verständnis der natürlichen Erziehung
- Die zentralen Elemente der natürlichen Erziehung: Naturzustand, Naturverständnis, Erziehungsverständnis und Erziehungskonzept
- Wirkung von Rousseaus Ideen auf die Entwicklung der Pädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beleuchtet die Bedeutung der Kindheit und Erziehung in der Gesellschaft. Sie verdeutlicht, dass die Kindheit und Erziehung einen historischen Wandel durchlaufen haben, der bis heute anhält. Als zentrale Figur dieser Entwicklung wird Jean-Jacques Rousseau vorgestellt.
- Begrifflichkeiten: In diesem Kapitel werden die Begriffe „Kindheit“ und „Erziehung“ genauer definiert und in ihren historischen Kontext eingeordnet. Die Vielschichtigkeit der beiden Begriffe wird anhand von unterschiedlichen Definitionen und Perspektiven aufgezeigt.
- Die Geschichte von Kindheit und Erziehung: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Kindheits- und Erziehungsverständnisses, beginnend mit der antiken Zeit. Es wird deutlich, dass die Vorstellung von Kindheit nicht immer den heutigen Wert und Stellenwert hatte.
- Jean-Jacques Rousseau: Dieses Kapitel widmet sich der Biografie von Jean-Jacques Rousseau und stellt sein Hauptwerk „Émile oder über die Erziehung“ vor. Es wird seine Kritik an der damaligen Erziehung und seine Vision einer natürlichen Erziehung deutlich.
- Die natürliche Erziehung: Dieses Kapitel analysiert die zentralen Elemente der natürlichen Erziehung nach Rousseau. Es werden der Naturzustand, Rousseaus Naturverständnis, sein Erziehungsverständnis und sein konkretes Erziehungskonzept im Detail untersucht.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: natürliche Erziehung, Jean-Jacques Rousseau, Kindheit, Erziehung, Naturzustand, Naturverständnis, Émile oder über die Erziehung, Aufklärung, Pädagogik, historische Entwicklung, Kindheitsverständnis, Erziehungsverständnis.
- Arbeit zitieren
- Hannah Adam (Autor:in), 2020, Die natürliche Erziehung nach Jean-Jacques Rousseau in dem Werk "Émile oder über die Erziehung", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/947442