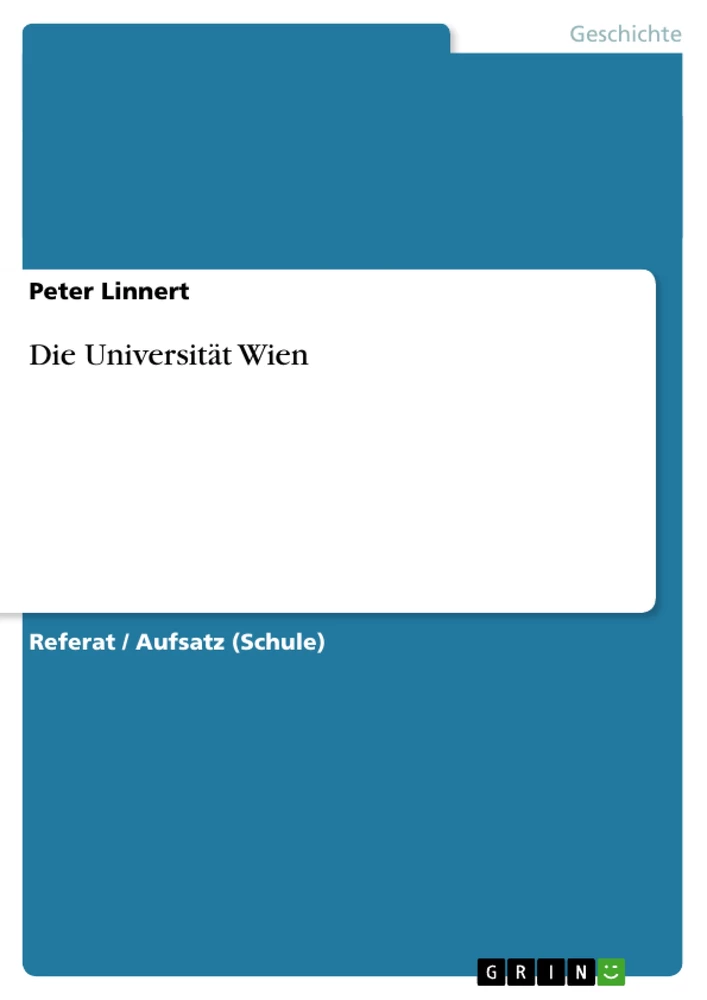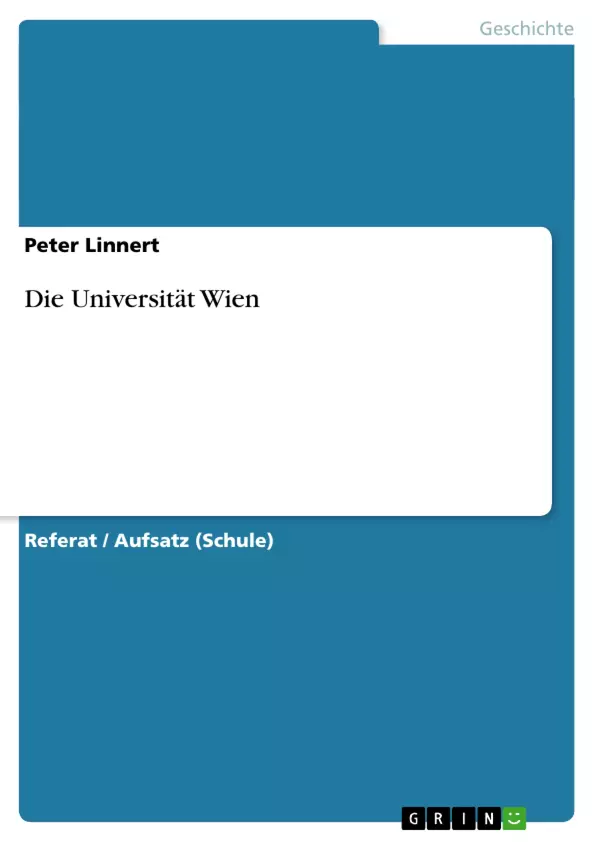Die Universität Wien
Bei einem Rundgang durch die Geschichte der Alma Mater Rudolphina Vindobonensis begegnen wir mitunter vertrauten, ja vielfach selbstverständlichen Bildern und Begriffen, die uns oft eine durch Jahrhunderte bestehende Kontinuität suggerieren. In Wahrheit ist in den meisten Bereichen ein durchaus gravierender Wandel eingetreten, wenn sich auch andererseits ein erstaunliches Beharrungsvermögen, ja ein zäher Traditionalismus hinsichtlich mancher universitärer Formen und Einrichtungen im Laufe der Geschichte erkennen läßt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tatsächlich unternehmen wir eine Reise in eine sehr ferne, mitunter fremdartige Vergangenheit, eine Reise in zumindest teilweise ganz andere Welten. Nicht nur das äußere, sehr veränderliche Erscheinungsbild, die organisatorischen Strukturen und das tägliche Leben in der universitären Gemeinschaft weisen seit der mittelalterlichen Gründungszeit durchaus starke Veränderungen, zum Teil Brüche auf. Rolle, Aufgaben und Ziele der Universität in Staat und Gesellschaft haben sich grundlegend gewandelt. So bildete die vom
österreichischen Landesfürsten begründete und hochprivilegierte Korporation der Lehrer und Schüler, die "universitas magistrorum et scholarium Vindobonensis", die gleichzeitig Rang und Funktion eines "studium generale", einer überregional anerkannten Hochschule, erhielt, einen eigenen akademischen Gerichtsstand (bis 1783) und genoß weitgehenden landesfürstlichen Schutz, der ihre Sicherheit und wirtschaftliche Existenz garantieren sollte.
Als vorrangige Aufgabe war ihr die Verbreitung und Reinhaltung des christlichen Glaubens und die Weitergabe der "erlaubten" Wissenschaften in Form von approbierten Texten und Lehren der herkömmlichen kirchlichen Autoritäten übertragen. Die Gründung der Korporation und des Generalstudiums hatte der habsburgische Landesfürst vorgenommen. Die Lehre und die Erteilung der Lehrbefugnis gingen hingegen vom Papst aus. Die mittelalterliche Universität Wien war demnach keine kirchliche, aber eine kirchennahe Einrichtung des österreichischen Fürsten, die er mit umfassenden Autonomierechten ausgestattet und so der kirchlichen und städtischen Gewalt weitgehend entzogen hatte. Sie war ein Konglomerat aus verschiedenen korporativen Verbänden (Bursen, Kodreien, Kollegien, Fakultäten, akademische Nationen), deren Mitglieder ("supposita") mit der Eintragung in die Matrikel des Rektors rechtlich dem "Dachverband" Alma Mater Rudolphina angehörten und ihm durch Eidesleistung verbunden waren.
Schon in der Zeit des Frühabsolutismus erfolgte eine stärkere Instrumentalisierung der Universität für die Zwecke der Konsolidierung der Landesherrschaft und der konfessionellen Einheit Österreichs. Die ursprünglich frei lesenden Professoren wurden zu staatlich besoldeten Lehrkanzelinhabern ("Ordinarien"), die für die Ausbildung von katholischen Priestern, Ärzten, Beamten und Lehrern zu sorgen hatten. In der nachfolgenden Epoche der Dominanz des Jesuitenordens (1623-1773) trat der schulische Charakter der Universität in den Vordergrund. Das von den Jesuiten eingerichtete und mit der Universität verbundene Akademische Gymnasium diente im Zusammenwirken mit der großen Philosophischen Fakultät primär als eine Vorbildungsstätte für ein späteres Theologiestudium. Jurisprudenz und Medizin waren hingegen an den Rand des Geschehens gedrängt. Die moderne Forschung und Wissenschaft der Neuzeit, die fortschrittlichen Erkenntnisse der Naturwissenschaften und Technik fanden kaum Eingang in die Lehre der Universität. Forschendes Lehren und Lernen waren der Universität durch Jahrhunderte fremd. Dagegen finden wir eine üppige barocke Prunkentfaltung mit neuen repräsentativen Kollegsgebäuden, beeindruckenden Promotionsfeiern - sogar unter den Auspizien des Kaisers (seit 1661) - und den vielbesuchten Aufführungen des von den Jesuiten geleiteten prächtigen Theaters im Akademischen Kolleg, an dem vorwiegend Studenten und Schüler des zur Universität gehörenden Akademischen Gymnasiums agierten.
Der Zugang zum Studium war bis zur Toleranzgesetzgebung der Aufklärungszeit ausschließlich katholischen Studenten vorbehalten, auch der Eintritt in den Lehrkörper und in die akademischen Funktionen war an die Ablegung des Tridentinischen Glaubensbekenntnisses gebunden. Seit 1778 durften Protestanten zu den weltlichen Doktorgraden zugelassen werden. Joseph II. verfügte 1782 die Zulassung von Juden zum juridischen und medizinischen Doktorat. Trotzdem wurde der "katholische Charakter der Universität Wien" noch im 19. Jahrhundert heftig verteidigt, die Erlangung der akademischen Funktionen war für Nichtkatholiken noch lange praktisch unmöglich. Die mehrfach angestrebte Aufnahme der 1821 begründeten Wiener Protestantischen-theologischen Lehranstalt (ab 1850 Fakultät) in den Verband der Universität Wien wurde bis 1922 hinausgezögert.
Die Universitätsreformen unter Maria Theresia und Joseph II. zielten auf eine Beseitigung der kirchlichen Einflüsse ab. Der bislang dominierende Jesuitenorden wurde bis zu seiner Auflösung (1773) schrittweise zurückgedrängt. Dagegen erreichte nun die staatliche Bevormundung des Studiums den höchsten Grad in der Geschichte der Alma Mater Rudolphina. Die Lehre mußte sich streng an approbierten Vorlesungsbüchern orientieren. Der gesamte Lehr- und Prüfungsbetrieb wurde von staatlichen Studiendirektoren kontrolliert. Zudem wurde das korporative Vermögen der Universität vom Staat eingezogen und einem Studienfonds einverleibt. Das bislang beklagte bescheidene Niveau der Lehre wurde insbesondere an der großen Philosophischen Fakultät in der Epoche des aufgeklärten Absolutismus keineswegs erhöht. Hingegen wurde die Distanz zu Wissenschaft und Forschung noch erweitert, indem die Ausbildung von "Staatsdienern" - nicht von Gelehrten - zum Hauptzweck der Universität erklärt wurde. Trotzdem erlebte die Medizinische Fakultät im Gefolge der von Gerard van Swieten eingeleiteten Reformen, der Einführung des Unterrichts am Krankenbett und der Errichtung von Universitätskliniken nach Eröffnung des Allgemeinen Krankenhauses (1784) ihren bisher größten Aufschwung, der in der Ersten Wiener Medizinischen Schule gipfelte. Auch im Rahmen der Rechtswissenschaftlichen Fakultät wurde in dieser Zeit der Grundstein für manche Disziplinen, wie etwa der "Polizei- und Kameralwissenschaft" (Staatslehre), der "Staatsrechnungswissenschaft" und der Statistik gelegt. Die von Studenten und Absolventen der Alma Mater getragene Wiener Revolution von 1848 verhalf nach Jahrzehnten der obrigkeitlichen Knebelung den akademischen Freiheiten, Lehr- und Lernfreiheit, zum Sieg. Sie gab den Anstoß zu den umfassenden Bildungsreformen des nachfolgenden Jahres, die mit dem Namen des Unterrichtsministers Leo Graf Thun-Hohenstein und der Professoren Franz Exner und Hermann Bonitz verbunden sind. Auf der Basis der Verbindung von Forschung und Lehre wurde die Universität Wien nach Humboldt’schem Vorbild neu organisiert und zahlreiche Berufungen ausländischer Kapazitäten eingeleitet. Das wissenschaftliche Niveau wurde in allen Disziplinen deutlich erhöht, die Philosophische Fakutät legte den alten Charakter eines bloßen Propädeutikums für die "höheren Fakultäten" ab und wurde endlich in den Rang einer wissenschaftlichen Lehr- und Forschungseinrichtung erhoben. In den nachfolgenden Jahrzehnten bis zum Ersten Weltkrieg gelang der Alma Mater Rudolphina der größte Aufschwung ihrer Geschichte. In vielen Disziplinen erlangte die "Wiener Schule" Weltruf. Dies gilt besonders für die Medizin, aber auch für andere Fächer wie zum Beispiel Nationalökonomie, Physik, Psychologie, Philosophie, Kunstgeschichte, Musikwissenschaft etc., deren Repräsentanten weltweite Annerkennung fanden.
Seit 1897 wurden nach heftigen Diskussionen endlich auch Frauen zum Studium zugelassen, wobei die Philosophische und die Medizinische Fakultät vorangingen. War ihr Anteil die ersten Jahrzehnte hindurch noch bescheiden, so erhöhte er sich nach dem Ersten Weltkrieg auf etwa 20- 30%. In den 70er-Jahren wurde die 40%-Marke überschritten. Seit Beginn der achtziger Jahre gibt es mehr als 50% weibliche Studierende an der Alma Mater Rudolphina.
Die beiden Weltkriege haben sich verheerend auf die Universität Wien ausgewirkt. Zunächst erfolgte gegen Ende der Monarchie eine weitgehende Abkoppelung der Wiener Wissenschaft von ihren internationalen Kontakten, viele Universitätsangehörige starben in der k. u. k. Armee. In der sogenannten Zwischenkriegszeit wurde der Universitätsboden zu einem Tummelplatz politischer Agitation und gewaltsamer Tumulte. Mehrfach kam es zu vorübergehenden Schließungen aufgrund antisemitischer Ausschreitungen und Krawalle. Ein nicht geringer Teil der Wiener Studenten und der Professoren sympathisierte lange vor dem Anschluß an das Deutsche Reich mit dem Lager der Nationalsozialisten. Mit der Annexion Österreichs setzte dann eine Welle der Vertreibungen und Deportationen ein. Fast die Hälfte des gesamten Lehrkörpers der Universität Wien wurde im Zuge der rassistischen und politschen Verfolgungen seiner Stellung beraubt und durch regimetreue Personen ersetzt. Der schon in den Jahren des Ständestaates einsetzende Exodus der Wissenschaft und die dann nachfolgenden Vertreibungen durch die Nationalsozialisten haben der Wiener Universität empfindliche Wunden zugefügt und ihren internationalen Rang für lange Zeit drastisch gemindert. Nicht einmal jeder Dritte der Vertriebenen kehrte wieder an die Universität zurück. Dazu kamen die Verluste, die der Zweite Weltkrieg an Menschen und Material gefordert hat.
Im Jahre 1945 lagen viele Universitätsgebäude in Trümmern und es bedurfte größter Anstrengungen aller demokratisch gesinnten Kräfte aus Studentenschaft und Lehrkörper, den Wiederaufbau voranzutreiben. In erstaunlich kurzer Zeit - bis 1951 - ist diese Arbeit im Wesentlichen abgeschlossen worden.
Noch im Jahre 1965 konnte die Alma Mater Rudolphina mit starker internationaler Beteiligung in aller Ruhe ihr 600-Jahr-Gründungsjubiläum begehen, während sie drei Jahre später von den Turbulenzen der "68er"- Studentenbewegung erfaßt wurde, die man in W ien jedoch als eine "zahme Revolution" erlebte. Sie richtete sich gegen die herkömmliche Universitätsorganisation, in der allein die Ordinarien das Sagen hatten. "Unter den Talaren - der Muff von tausend Jahren" lautete ihr Kampfruf.
Mit dem Universitäts-Organisationsgesetz 1975 wurde eine der Hauptforderungen aus diesen Tagen, die Demokratisierung der Universität, vollzogen und neben den Professoren auch die Kurien der Assistenten und Dozenten, der Studenten und der allgemeinen Universitätsbediensteten in die Entscheidungsprozesse einbezogen. Es erfolgte ein gründlicher Wandel in der Verwaltungsstruktur der gesamten Universität, mit der freilich auch ein starker Bürokratisierungsschub einherging. Die Vielzahl der nun erforderlichen Sitzungen in den zahlreichen Beratungs- und Entscheidungsgremien wird bis heute immer wieder beklagt. Gleichzeitig wurden 1975 aus den bisherigen fünf Fakultäten acht. Dies kam durch die Teilung der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät in die Rechtswissenschaftliche und die Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche sowie der Philosophischen Fakultät in die Grund- und Integrativwissenschaftliche, die Geisteswissenschaftliche und die Formalund Naturwissenschaftliche Fakultät zustande.
Die rasante Entwicklung der Wissenschaften brachte eine starke Vermehrung der Disziplinen und zahlreiche Neugründungen von Instituten (1999 sind es rund 190). Der besonders seit den frühen siebziger Jahren explosionsartige Zustrom der Studierenden - die Frenquenzen verdoppelten sich seitdem alle zehn Jahre - führte zu den Problemen der Massenuniversität, an der eine individuelle Betreuung in vielen Fächern nicht mehr möglich ist.
Zu diesen Problemen gehört die permanente Raumnot und Dislozierung, die trotz stetiger Erweiterungen nicht beseitigt werden konnte. Zu den größten Universitäts-Neubauten nach 1945 zählen das Neue Institutsgebäude ("NIG", 1962), das Universitäts-Sportzentrum Schmelz (1973), das Biologiezentrum (1982), das "Juridicum" (1984), das "Vienna Biocenter" (Biozentrum Dr. Bohrgasse, 1992); dazu gesellten sich eine Reihe von älteren Gebäuden, die für Universitätszwecke erworben und adaptiert wurden, wie z. B. das Gebäude der Katholisch-theologischen Fakultät (1973), das Archäologiezentrum (1984), das Betriebswirtschaftszentrum (1991/94) etc. Schließlich ist als größter Gebäudezuwachs die großzügige Schenkung des Alten Allgemeinen Krankenhauses durch die Stadt Wien (1988) zu nennen, das nach vorbildlicher Umgestaltung als "Universitätscampus Wien" neu erstanden ist und seit 1998 der Geisteswissenschaftlichen Fakultät zur Verfügung steht.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Alma Mater Rudolphina Vindobonensis?
Die Alma Mater Rudolphina Vindobonensis ist der lateinische Name für die Universität Wien.
Wann wurde die Universität Wien gegründet?
Das Dokument erwähnt das 600-Jahr-Gründungsjubiläum, das 1965 gefeiert wurde, was auf eine Gründung um das Jahr 1365 hindeutet.
Welche Rolle spielte die Universität Wien im Mittelalter?
Die Universität diente der Verbreitung und Reinhaltung des christlichen Glaubens und der Weitergabe der "erlaubten" Wissenschaften. Sie war eine vom Landesfürsten gegründete Institution, die aber auch vom Papst abhängig war, da dieser die Lehrbefugnis erteilte. Sie genoss weitreichende Autonomierechte.
Wie veränderte sich die Universität in der Zeit des Frühabsolutismus?
Die Universität wurde stärker für die Zwecke der Konsolidierung der Landesherrschaft und der konfessionellen Einheit instrumentalisiert. Professoren wurden zu staatlich besoldeten Lehrkanzelinhabern, und der schulische Charakter trat in den Vordergrund, besonders unter der Dominanz des Jesuitenordens.
Welche Rolle spielte der Jesuitenorden an der Universität Wien?
Der Jesuitenorden dominierte die Universität von 1623 bis 1773. Sie richteten das Akademische Gymnasium ein, das primär als Vorbildungsstätte für ein Theologiestudium diente. Jurisprudenz und Medizin waren weniger wichtig.
War die Universität Wien immer für alle Studenten zugänglich?
Nein, bis zur Toleranzgesetzgebung der Aufklärungszeit war der Zugang zum Studium ausschließlich katholischen Studenten vorbehalten. Erst später wurden Protestanten und Juden unter bestimmten Bedingungen zugelassen.
Welche Reformen wurden unter Maria Theresia und Joseph II. durchgeführt?
Die Reformen zielten auf die Beseitigung der kirchlichen Einflüsse ab, insbesondere des Jesuitenordens. Stattdessen erfolgte eine stärkere staatliche Bevormundung des Studiums. Die Ausbildung von "Staatsdienern" wurde zum Hauptzweck erklärt.
Welche Bedeutung hatte die Wiener Revolution von 1848 für die Universität Wien?
Die Revolution verhalf den akademischen Freiheiten, Lehr- und Lernfreiheit, zum Sieg und gab den Anstoß zu umfassenden Bildungsreformen nach Humboldt’schem Vorbild.
Welchen Aufschwung erlebte die Universität Wien im 19. Jahrhundert?
Die Universität wurde nach Humboldt’schem Vorbild neu organisiert, das wissenschaftliche Niveau wurde in allen Disziplinen deutlich erhöht, und die "Wiener Schule" erlangte in vielen Bereichen Weltruf.
Wann wurden Frauen zum Studium zugelassen?
Nach heftigen Diskussionen wurden Frauen ab 1897 zum Studium zugelassen, zunächst an der Philosophischen und der Medizinischen Fakultät. Ihr Anteil erhöhte sich im Laufe der Zeit.
Wie wirkten sich die beiden Weltkriege auf die Universität Wien aus?
Die Weltkriege hatten verheerende Auswirkungen. Es kam zu einer Abkoppelung von internationalen Kontakten, Verlusten im Krieg, Vertreibungen und Deportationen durch die Nationalsozialisten, was den internationalen Rang der Universität minderte.
Wie gestaltete sich der Wiederaufbau nach 1945?
Nach 1945 erfolgte ein Wiederaufbau der zerstörten Universitätsgebäude, der im Wesentlichen bis 1951 abgeschlossen wurde.
Was geschah während der "68er"-Studentenbewegung?
Die Universität wurde von den Turbulenzen der "68er"-Studentenbewegung erfasst, die sich gegen die herkömmliche Universitätsorganisation richtete und die Demokratisierung der Universität forderte.
Welche Veränderungen brachte das Universitäts-Organisationsgesetz 1975?
Das Gesetz brachte die Demokratisierung der Universität, die Einbeziehung der Kurien der Assistenten, Studenten und Universitätsbediensteten in die Entscheidungsprozesse sowie eine neue Verwaltungsstruktur und die Aufteilung der Fakultäten.
Mit welchen Problemen kämpft die Universität Wien heute?
Zu den heutigen Problemen gehören die Massenuniversität, Raumnot, Dislozierung und die Notwendigkeit ständiger Reformen.
- Quote paper
- Peter Linnert (Author), 1999, Die Universität Wien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95228