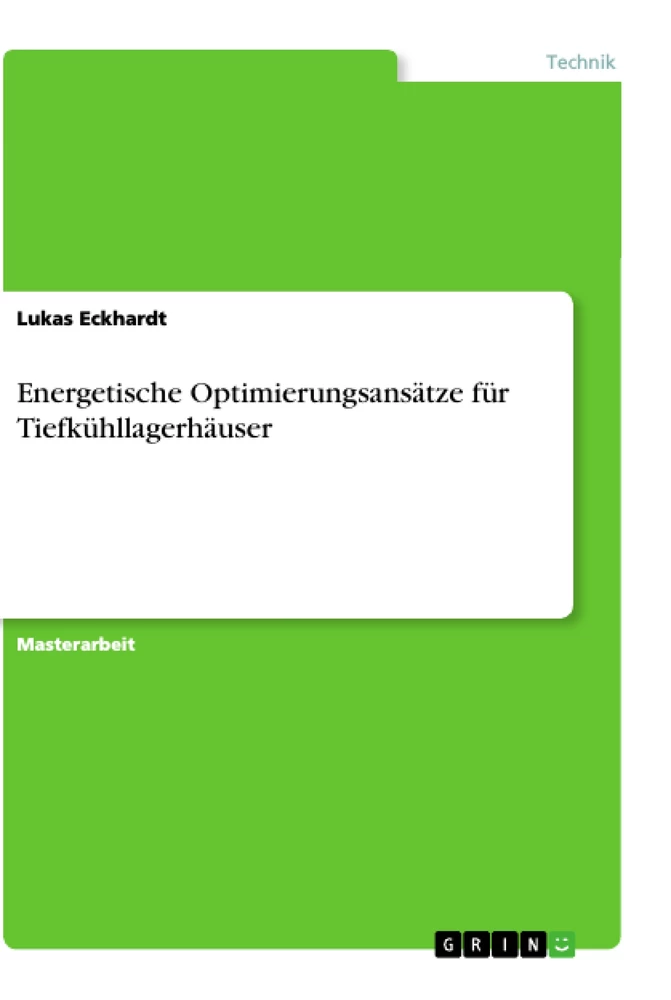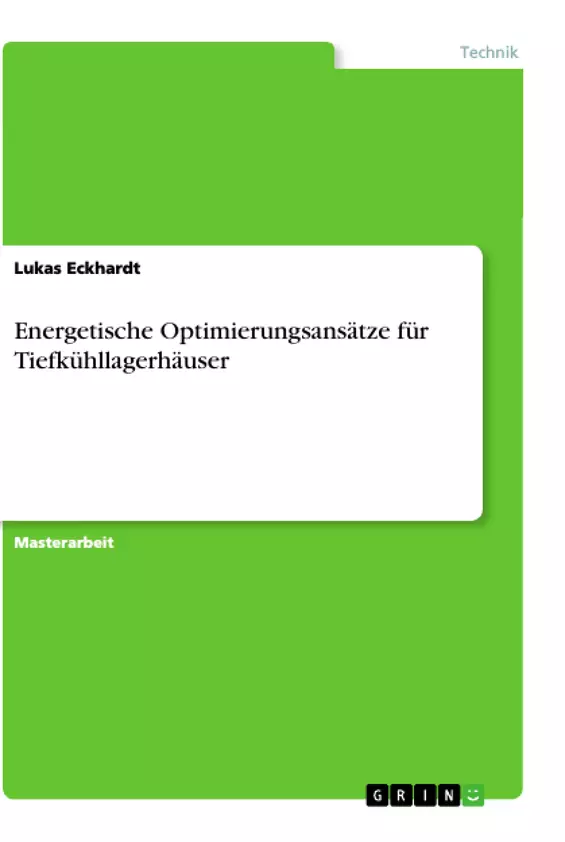Diese Arbeit zeigt energetisch sinnvolle Maßnahmen für Tiefkühllagerhäuser auf, die wirtschaftlich darstellbar sind. Dabei wird zunächst die ökologische und ökonomische Bedeutung der Tiefkühllogistikbranche in der Bundesrepublik Deutschland beschrieben. Anschließend wird dargestellt, wie die Gebäudestruktur und –form den betrieblichen Anforderungen folgt und welche Randbedingungen für das Lagergut gelten.
Im nächsten Abschnitt werden typische Verbrauchswerte anhand von Daten, die während der vergangenen 12 Jahre an 18 Standorten aufgezeichnet wurden, ermittelt und analysiert. Mit den gewonnenen Erkenntnissen wird das „Standard-Tiekühllagerhaus“ für weitere Untersuchungen definiert. Die Gebäudehülle wird im ersten Kapitel des Hauptteils dieser Arbeit näher betrachtet.
Im zweiten Kapitel des Hauptteils werden sogenannte Unterfrierschutzheizungen, die unterhalb der Bodenplatte das Gefrieren des Bodens verhindern, betrachtet. Energieeinsparpotentiale durch verschiedene Ausführungsvarianten werden verglichen. Außerdem wird untersucht, welche Maß-nahmen notwendig sind, um dieses Bauteil gänzlich zu streichen.
Sehr sensible Bauteile stellen die Tore, über die der Warenumschlag abgewickelt wird, dar. Zu diesem Thema werden aktuelle, technische Entwicklungen vorgestellt und untersucht.
Der eigentliche Warenübergang vom LKW in das Tiefkühllager und umgekehrt wird im darauffolgenden Kapitel: Be- und Entladung analysiert. Das fünfte Kapitel behandelt sogenannte Türrahmenheizungen. Es wird geprüft, inwiefern eine Bedarfsgesteuerte Taktung der Heizbänder wirtschaftlich darstellbar ist. Das Kapitel schließt mit einem Vergleich der Investitionskosten für unterschiedliche Kälte-anlagen. Das achte Kapitel stellt die alternative Energiebereitstellung mit Erdgas als Primärenergieträger vor. Dabei wird ein Blockheizkraftwerk mit zwei unterschiedlichen Kälteanlagen kombiniert und die jeweiligen Lebenszykluskosten mit dem konservativen Betrieb einer Kompressionskältemaschine verglichen.
In dem vorletzten Kapitel, wird kurz auf die heute in der Tiefkühlbranche sehr verbreitete Strombeschaffung an der Strombörse eingegangen. Abschließend werden alle Erkenntnisse in einem Gebäudeentwurf zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Kenngrößen TK‐Lager
- C. Schwachstellenanalyse/Optimierung
- 1. Gebäudehülle
- Materialien und Bauteilaufbauten
- Gebäudeform und Ausrichtung
- 2. Unterfrierschutzheizung
- 3. Torsysteme
- 4. Be‐ und Entladung
- 5. Türrahmenheizung
- 6. Beleuchtung
- 7. Kälteanlage
- Verdichter
- Verdampfer
- Verflüssiger
- Kältemittel
- Kaskaden
- 8. Energieursprung
- 9. Energiebeschaffung
- 10. Das perfekte TK‐Lager
- 1. Gebäudehülle
- D. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert energieeffiziente Optimierungsansätze für Tiefkühllagerhäuser, die sowohl wirtschaftlich darstellbar als auch ökologisch sinnvoll sind. Dabei wird die Bedeutung der Tiefkühllogistikbranche in Deutschland beleuchtet und das „Standard-Tiefkühllagerhaus“ anhand von Verbrauchswerten der vergangenen 12 Jahre an 18 Standorten definiert.
- Analyse der Schwachstellen in der Gebäudehülle und deren Auswirkungen auf die Wärmelast
- Bewertung verschiedener Unterfrierschutzheizungen und deren Wirtschaftlichkeit
- Optimierung von Torsystemen zur Reduzierung des Wärme- und Feuchteeintrags
- Untersuchung von Energieeinsparungen durch Ladungsträger und Palettenschleusen
- Bewertung von Kälteanlagen, Kältemitteln und Kaskaden im Hinblick auf Energieeffizienz
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel A: Einleitung
- Kapitel B: Kenngrößen TK‐Lager
- Kapitel C: Schwachstellenanalyse/Optimierung
- Kapitel 1: Gebäudehülle
- Kapitel 2: Unterfrierschutzheizung
- Kapitel 3: Torsysteme
- Kapitel 4: Be‐ und Entladung
- Kapitel 5: Türrahmenheizung
- Kapitel 6: Beleuchtung
- Kapitel 7: Kälteanlage
- Kapitel 8: Energieursprung
- Kapitel 9: Energiebeschaffung
- Kapitel 10: Das perfekte TK‐Lager
Die Einleitung erläutert die Bedeutung der Energieeinsparung in der Tiefkühllogistikbranche und stellt den Aufbau der Arbeit sowie die zentralen Forschungsfragen vor.
Dieses Kapitel präsentiert Daten über die Größe, den Energieverbrauch und den Warenverkehr in deutschen Tiefkühllagerhäusern. Dabei werden der steigende Bedarf an Tiefkühlprodukten und die Bedeutung der Energiekosten für die Branche hervorgehoben. Die einzelnen Stationen in einer Tiefkühlkette werden beschrieben und der Anteil der Lagerung und des Transports an den Treibhausgasemissionen von Tiefkühlkost wird verdeutlicht.
Hier werden typische Energieverbrauchswerte von Tiefkühllagerhäusern ermittelt und auf die verschiedenen Energieverbraucher im Gebäude verteilt. Die Wärmeeinträge durch die Gebäudehülle, die Toröffnungen, die Beleuchtung und die Warenübergabe werden quantifiziert und die Kosten für die jeweilige Wärmeeintragsursache berechnet.
Das Kapitel behandelt die wichtigsten Einflussgrößen auf die Transmissionwärme durch die Gebäudehülle. Der Aufbau von Wänden, Dach und Bodenplatte wird beschrieben und die Schwachstellen im Hinblick auf die Energieeffizienz aufgezeigt. Mögliche Optimierungsansätze wie die Erhöhung der Dämmstärke und die Minimierung des Absorptionsgrades werden erläutert.
Die Unterfrierschutzheizung unterhalb der Bodenplatte wird genauer betrachtet. Verschiedene Ausführungsvarianten werden vorgestellt und hinsichtlich Energieeinsparpotenziale und Wirtschaftlichkeit verglichen. Die Möglichkeiten, auf eine Unterfrierschutzheizung zu verzichten, werden untersucht.
Dieses Kapitel behandelt die Tore für den Warenumschlag als Schwachstelle in der Gebäudehülle. Der Wärmeeintrag durch Toröffnungen wird berechnet und verschiedene Möglichkeiten zur Reduzierung des Luftwechsels, wie z.B. Abdichtende Gummischürzen, Schnelllauftore und Luftschleieranlagen, vorgestellt.
Die Warenübergabe an der Laderampe wird als sensible Schnittstelle in der Logistik betrachtet. Das Kapitel zeigt die Herausforderungen an der Schnittstelle Laderampe auf und untersucht Möglichkeiten, den Wärmeeintrag während der Be- und Entladung von LKWs zu reduzieren.
Die Funktionsweise und der Energieverbrauch von Türrahmenheizungen werden erläutert. Die Bedeutung der bedarfsgerechten Steuerung der Heizbänder für die Energieeffizienz wird hervorgehoben.
Das Kapitel behandelt die Beleuchtung in Tiefkühllagerhäusern. Die Vorteile von Halogen-Metalldampflampen und die neuen Möglichkeiten mit LED-Leuchtmitteln werden vorgestellt.
Der Kreisprozess einer Kälteanlage wird beschrieben und die einzelnen Komponenten: Verdichter, Verdampfer, Verflüssiger und Expansionsventil werden im Detail vorgestellt. Die Wirtschaftlichkeit von verschiedenen Rückkühlvarianten und Kältemitteln wird untersucht.
Dieses Kapitel behandelt die Energiebeschaffung für Tiefkühllagerhäuser. Verschiedene Varianten der Energieerzeugung mit Erdgas und BHKWs werden vorgestellt und im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz verglichen.
Das Kapitel erläutert die Besonderheiten des Strommarktes und zeigt die Möglichkeiten für Tiefkühlhausbetreiber, Strom an der Strombörse zu kaufen und die Kälteanlage bedarfsgerecht zu steuern.
Abschließend wird ein Konzept für ein energieeffizientes Tiefkühllager entworfen, das alle erarbeiteten Optimierungsansätze integriert. Der Entwurf berücksichtigt auch die Möglichkeiten der vollautomatischen Lagerung und der Verwendung von BHKWs.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die energetische Optimierung von Tiefkühllagerhäusern. Die wichtigsten Schlüsselwörter umfassen: Tiefkühlkette, Energieverbrauch, Gebäudehülle, Dämmung, Unterfrierschutzheizung, Torsysteme, Ladungsträger, Kälteanlage, Kältemittel, Kaskaden, Blockheizkraftwerk, Absorptionskältemaschine, Strommarkt, Energiebeschaffung, und Energiemanagement.
- Arbeit zitieren
- Lukas Eckhardt (Autor:in), 2014, Energetische Optimierungsansätze für Tiefkühllagerhäuser, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/953428