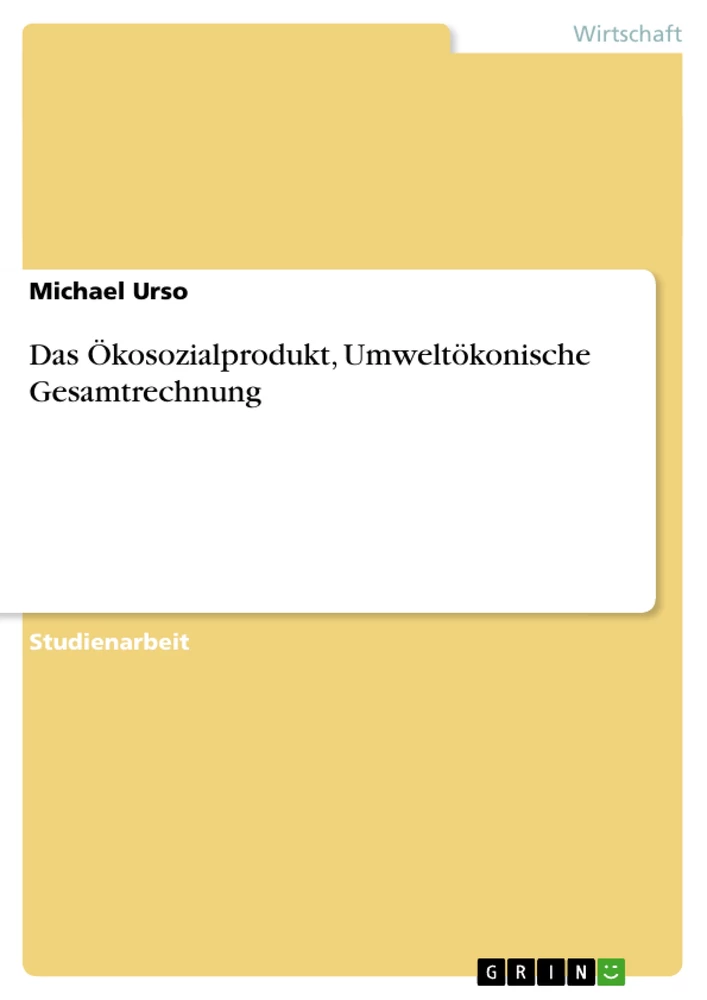Was ist das Bruttosozialprodukt (BSP) und warum ist es unzureichend?
Das Bruttosozialprodukt ist ein Maß für den Wert aller Güter und Dienstleistungen einer Volkswirtschaft. Es wird jedoch als unzureichend angesehen, da es Faktoren wie Schwarzarbeit, Tätigkeiten im Haushalt und den Verbrauch von natürlichen Ressourcen nicht berücksichtigt.